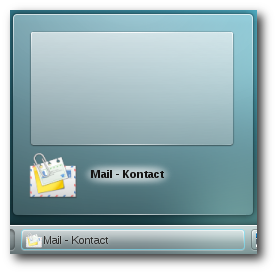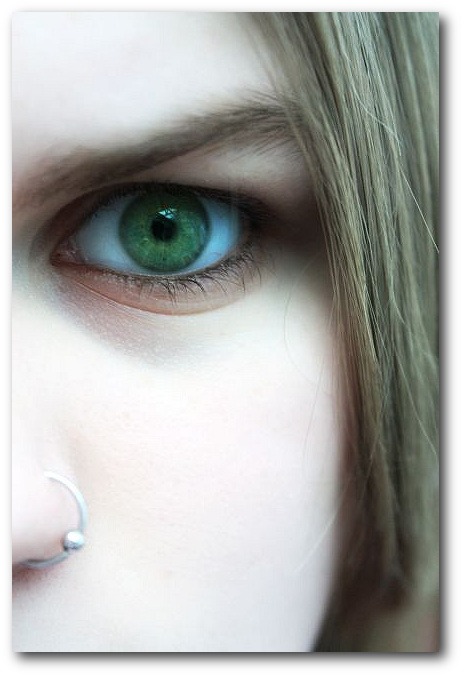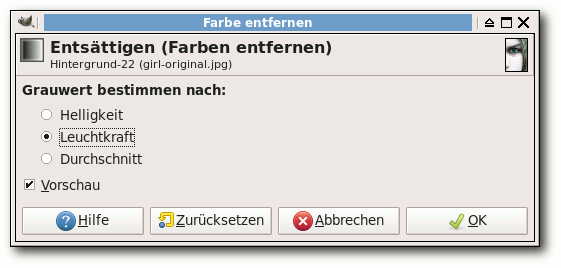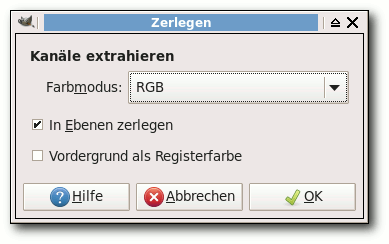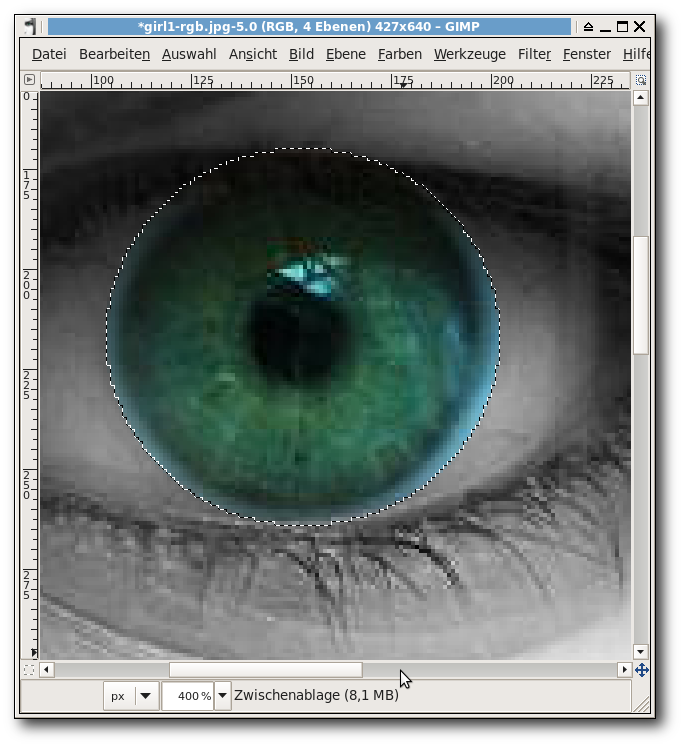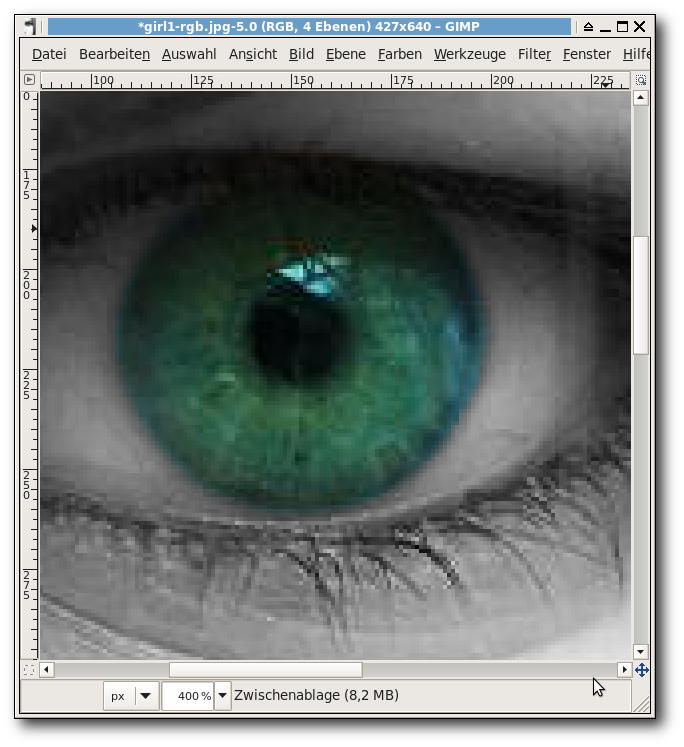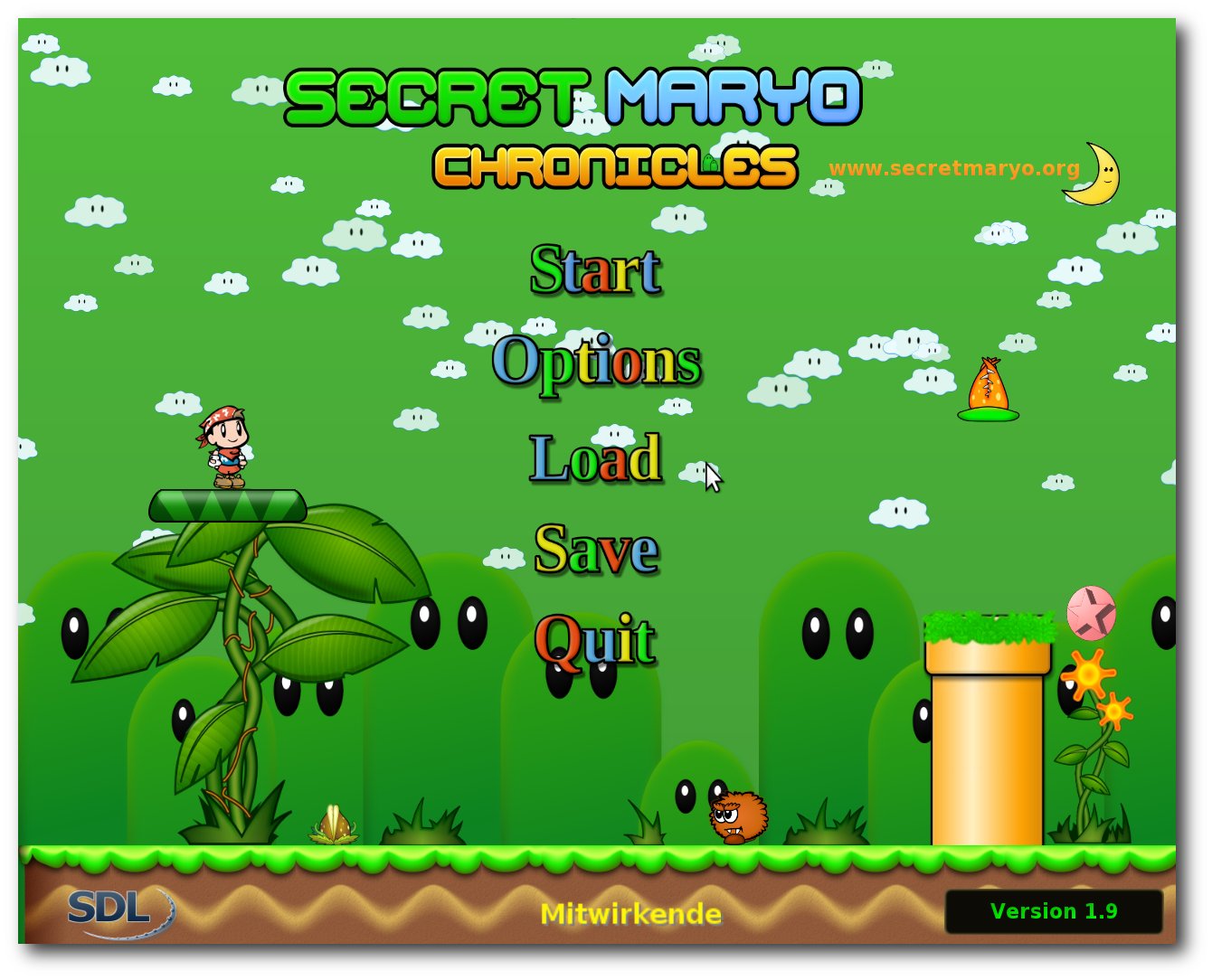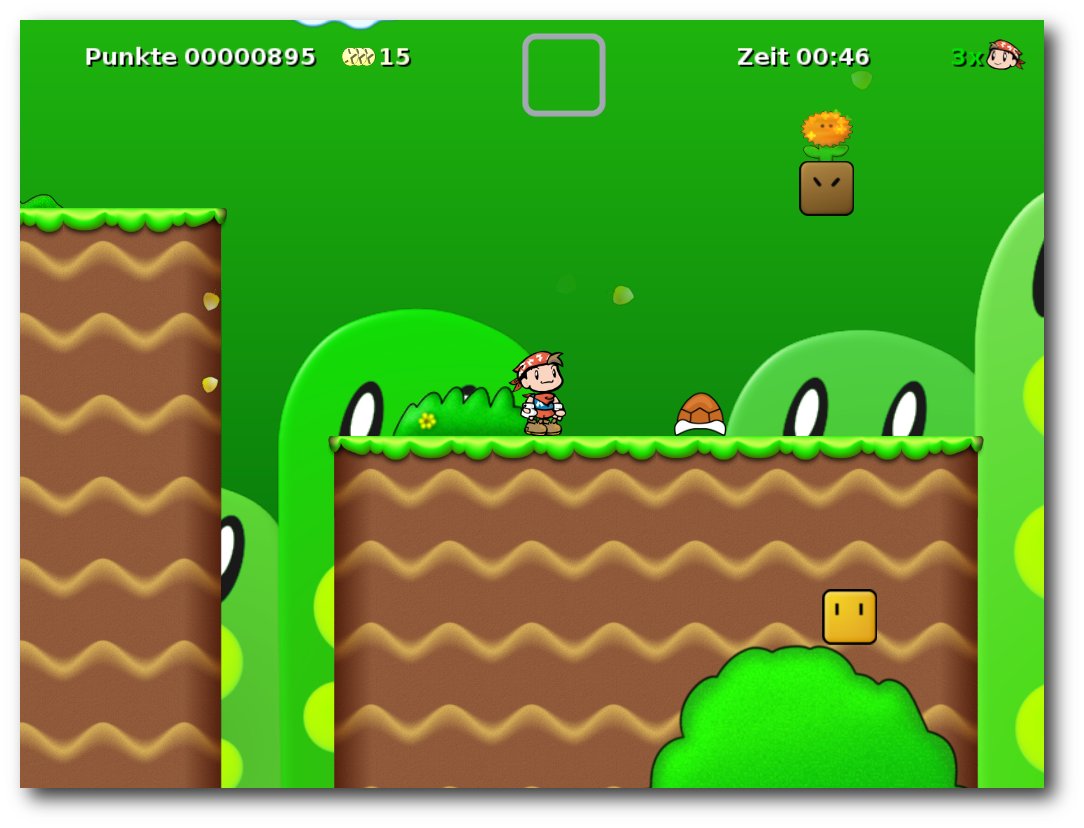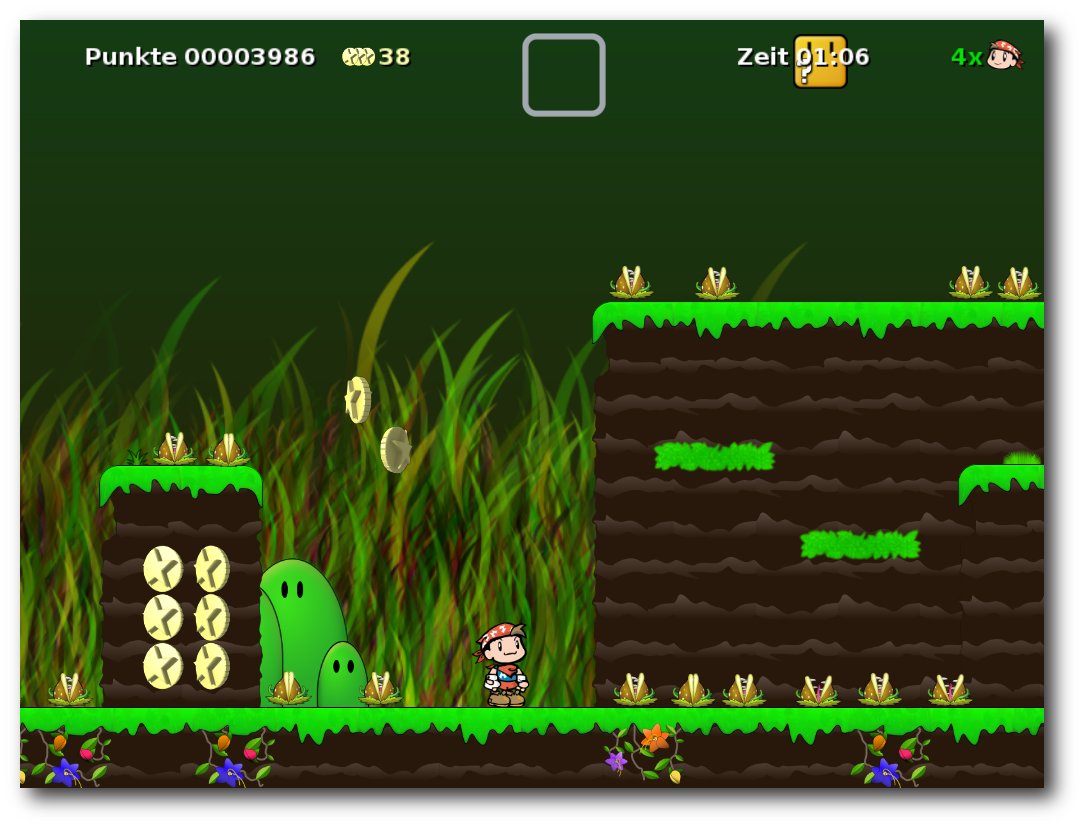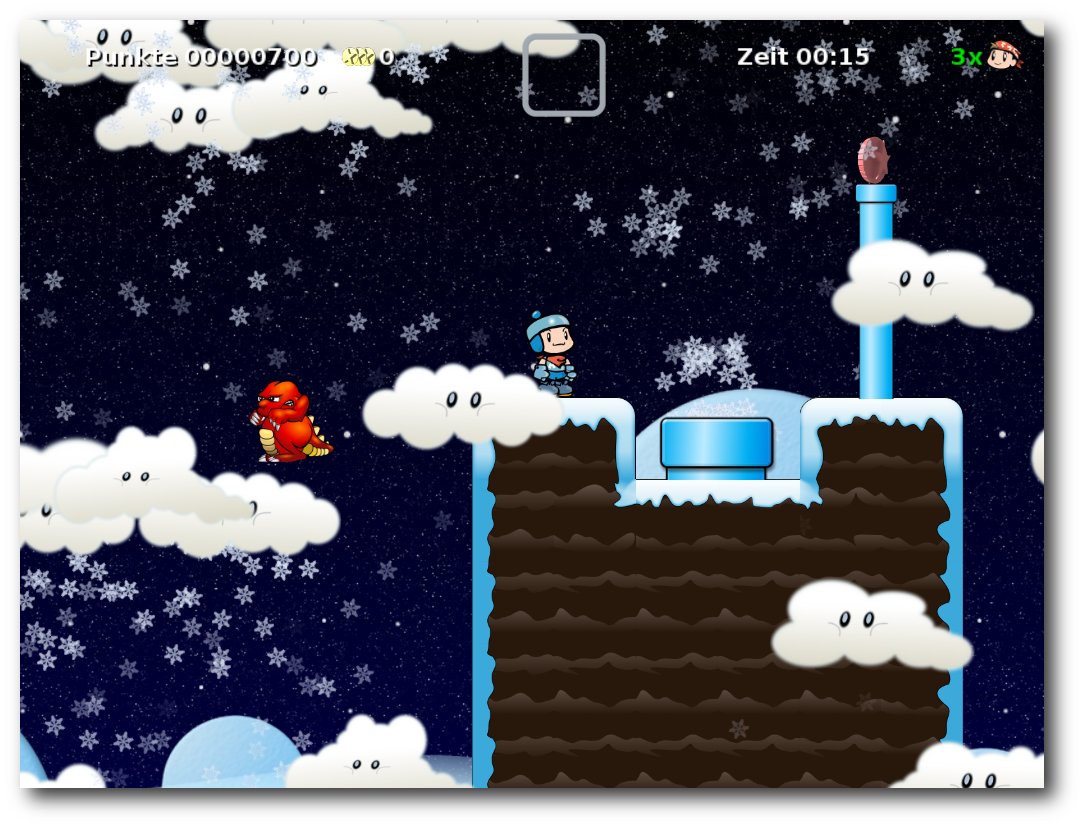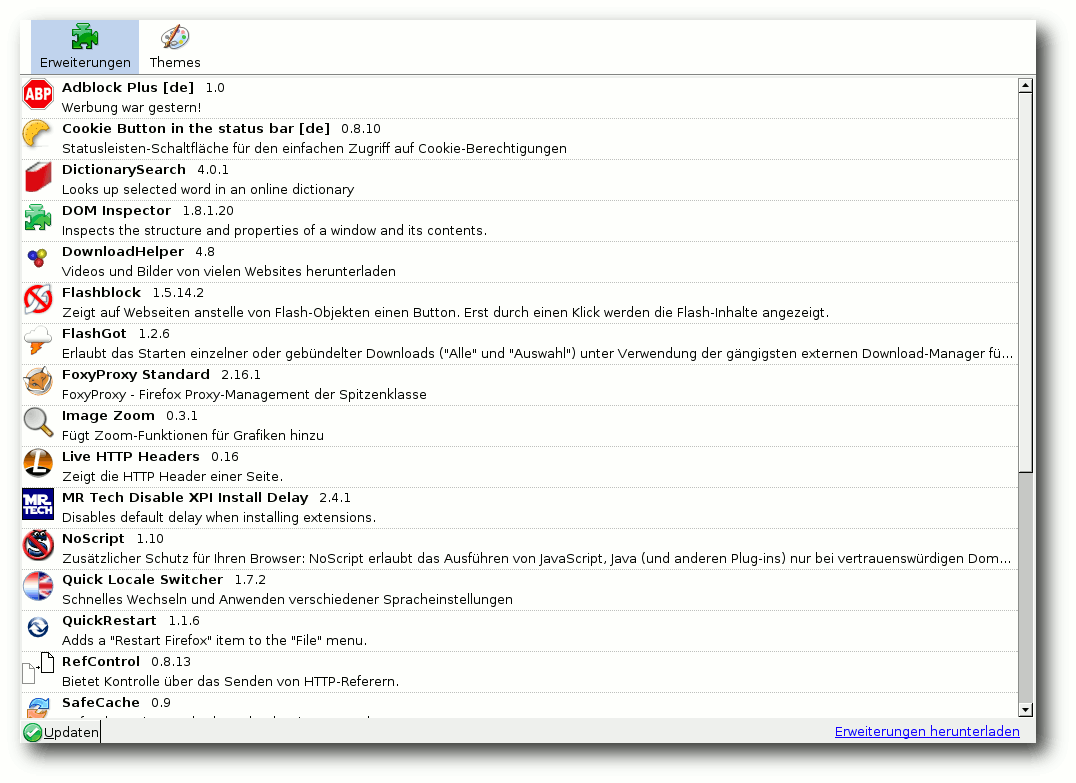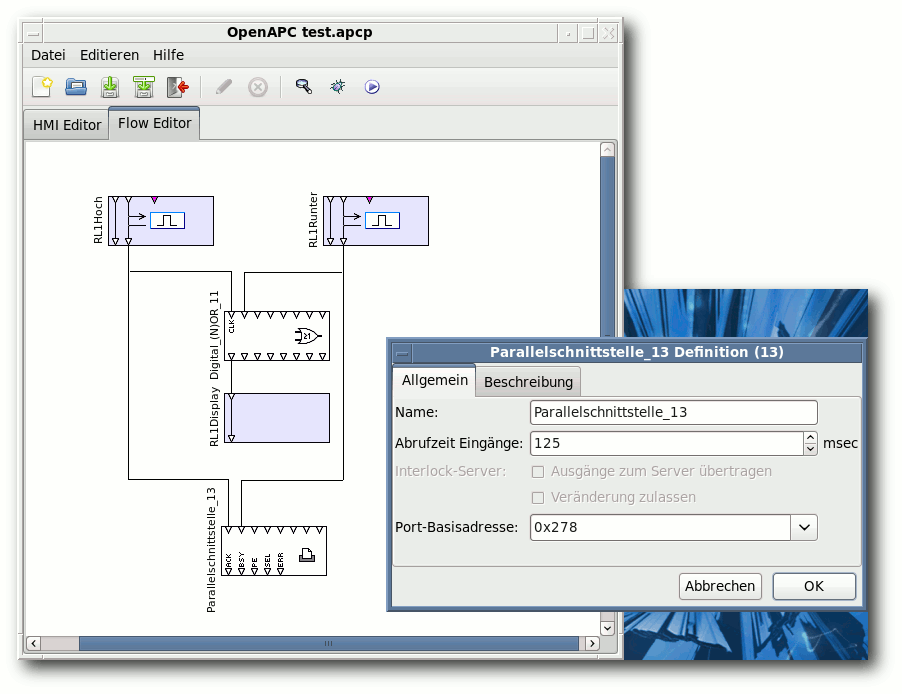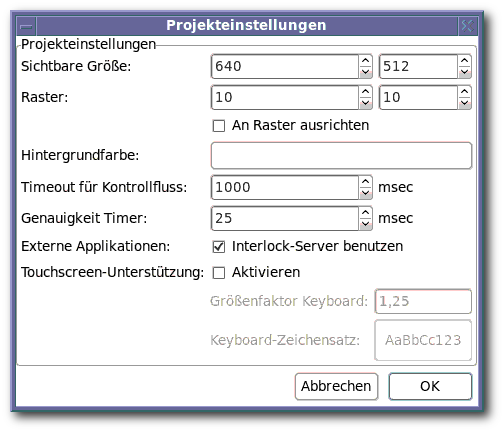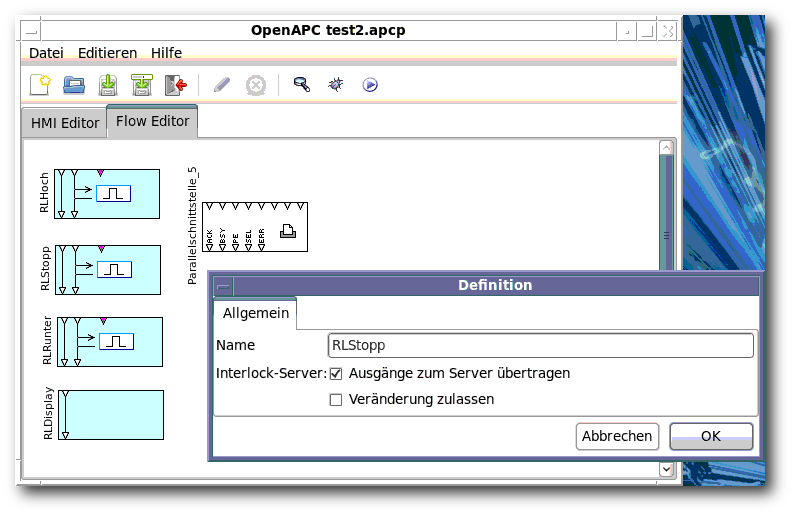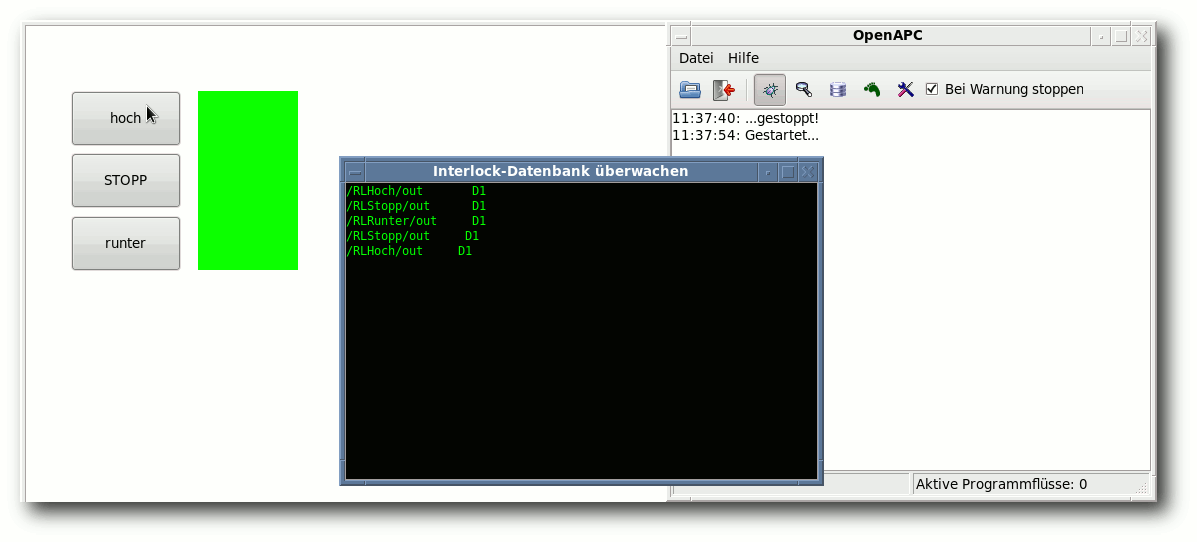Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin März 2011 (ISSN 1867-7991)
Topthemen dieser Ausgabe
Wayland oder warum man X ersetzen sollte
Das X Window System ist mit über 25 Jahren geradezu der Methusalem in der Softwarewelt. Die aktuelle Protokollversion X11 aus dem Jahre 1987 ist vier Jahre älter als die erste Version des Linux-Kernels. Nun scheint die Freie-Software-Gemeinschaft aktiv daran zu arbeiten, X in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken. (weiterlesen)
Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation
Die Pipe ist vielen als eines der unter Unix mächtigsten Werkzeuge bekannt. Sie ermöglicht es, die Ausgabe eines Befehls direkt an einen anderen Prozess zu senden. Tatsächlich stellt die Standardpipe aber nur die einfachste Form der Interprozesskommunikation dar. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, Datenströme effizient zu verarbeiten, um- und weiterzuleiten. (weiterlesen)
GIMP-Tutorial: Farben durch Graustufen hervorheben (Colorkey)
Mit GIMP sind sehr viele schöne Spielereien möglich, einige davon lassen sich sogar sinnvoll einsetzen. Das folgende Tutorial soll zeigen, wie man einzelne Elemente auf Farbfotos hervorheben kann, indem man alles drumherum in Graustufen konvertiert („Colorkey“ genannt). Den einen richtigen Weg gibt es dabei aber nicht; viele Ansätze führen zum Ziel. (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Wayland
Datenströme, Dateideskriptoren und Interprozesskommunikation
Der Februar im Kernelrückblick
Anleitungen
Python – Teil 6
GIMP-Tutorial: Colorkey
Software
Secret Maryo Chronicles
Gesunde Datenkekse backen mit Firefox
Hardware
Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 2)
Community
Rezension: Coders At Work
Magazin
Editorial
Leserbriefe
Veranstaltungen
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Happy Birthday, freiesMagazin!
freiesMagazin feiert fünfjähriges Bestehen
In der Regel gratuliert man sich ja nicht selbst zum Geburtstag,
(außer man hat keine Freunde, die an sowas denken) aber sicherlich
denkt nicht jeder Leser von selbst daran und auch wir wurden etwas
überrascht, sodass wir weder mit Kuchen noch Geschenken aufwarten
können.
Aber am 18. März 2011 ist es soweit: freiesMagazin wird fünf Jahre alt. In
der Initialmeldung war es noch ein reiner Newsletter [1], der dann aber im Laufe der Zeit zu einem eigenen Magazin
heranwuchs, welches sehr erfolgreich Monat für Monat tausende Leser
zu begeistern vermag.
Dafür möchten wir uns bei Ihnen, den Lesern, und natürlich auch bei
allen Autoren recht herzlich bedanken. Ohne diese beiden Parteien gäbe
es kein Magazin. Aber auch hinter den Kulissen werkeln fleißige Hände,
die jeden Monat ihre Zeit opfern, dieses Magazin zu gestalten. Wem Sie
dafür danken können, finden Sie im Impressum.
Wir hoffen, dass es noch weitere fünf Jahre mit freiesMagazin geben wird. Damit
das sichergestellt ist, benötigen wir aber wie immer Ihre Hilfe. Zum
einen freuen wir uns, wenn Sie freiesMagazin an Freunde, Kollegen und
Interessenten weiterempfehlen. Die Downloadzahlen halten sich recht
konstant (mit kleinen Abweichungen), aber die Lesergemeinde scheint
nicht zu wachsen. Berichten Sie also ruhig in Blogs, in Newsportalen
oder am Stammtisch von freiesMagazin.
Zum anderen freuen wir uns aber auch über neue Autoren, die das Magazin
mitgestalten. Wer Anregungen für ein Thema braucht, findet in der
Leserwunschliste [2]
sicherlich etwas passendes. Und falls nicht, freuen wir uns auch so
über jeden Artikel. Vorschläge, Entwürfe und fertige Artikel können
unter  eingereicht werden.
eingereicht werden.
Umfrage zum dritten Programmierwettbewerb
Wie schon in freiesMagazin 02/2011 angekündigt, haben wir aufgrund der
schwachen Teilnehmerresonanz zum dritten Programmierwettbewerb [3] von
freiesMagazin eine Umfrage gestartet [4].
Die Umfrage lief bis zum 27.02.11, und uns
interessierten natürlich die Gründe, warum potentielle Teilnehmer dem
Wettbewerb ferngeblieben sind.
Betrachtet man die Umfrageergebnisse, stellt man fest, dass
die meisten Personen vor allem „fehlende Zeit“ von einer Teilnahme abgehalten
hat – ganze 139 von insgesamt 235 abgegebenen Stimmen machten
dies als Grund für
die Nichtteilnahme aus. Die
parallel zur Umfrage abgegebenen Kommentare weisen dann auch in die gleiche
Richtung: Eingebunden in Beruf, Schule/Studium, Familie etc. bleibt in den
Reststunden des Tages nicht viel Zeit für Wettbewerbe dieser Art. Auch
wenn dies schade ist, nachvollziehbar ist es allemal.
Welche Gründe gab es noch? An zweiter Stelle zeigten 51 Stimmen „fehlende
oder zu späte Information“ über den Wettbewerb als Grund dür die
Nichtteilnahme an.
Auf
gleicher Ebene (ebenfalls mit 51 Stimmen) rangiert der Grund, das die
„Aufgabe zu schwer/kompliziert“ war.
Weitere Stimmen verteilten sich auf die Gründe „Aufgabe/Thema reizte mich nicht“
(40 Stimmen) und „Programmieraufwand zu hoch“ (38 Stimmen).
Dadurch, dass wir den zweiten Wettbewerb mit einer anspruchsvolleren
Aufgabe toppen wollten, haben wir uns also selbst behindert und zu
viele Programmierer verschreckt. Daraus wollen wir eine Lehre ziehen
und werden den nächsten Wettbewerb entsprechend einfacher gestalten.
Vor allem aber die Kritik mit dem nachträglichen Ändern der Regeln
und der komplizierten Bewertungsfunktion werden wir uns zu Herzen
nehmen.
Wann es den nächsten Programmierwettbewerb geben wird, ist noch unklar.
Und auch die Form – ob wieder ein Spiel oder zur Abwechslung eine
echte Anwendung – ist noch nicht entschieden. Der Wunsch nach zweitem
kam auch in den Kommentaren auf [5], wobei wir dann als Redaktion das Problem haben,
einen Gewinner zu küren. Denn objektiv lassen sich nur wenige Kriterien
festlegen, die eine Anwendung besser macht als eine andere. Vorschläge
für neue Spiele als Basis des Wettbewerbs sind aber auch schon bei
uns eingegangen.
Gewinner des Bash-Gewinnspiels
Wer es nicht mitbekommen hat, soll an dieser Stelle darauf
hingewiesen werden, dass es in der letzten Ausgabe von freiesMagazin
02/2011 [6]
im Artikel „Rezension: Bash – kurz & gut” gleichnamiges Buch zu
gewinnen gab. Die Frage war: „Welche neue Shell-Option für die Dateinamenersetzung ist in der Bash 4.0 hinzugekommen ist
und was macht diese?“
Die gesuchte Option nennt sich globstar und und ermöglicht
rekursives Globbing. Über den Ausdruck ** durchsucht man
dann im Gegensatz zu * nicht nur alle Dateien und
Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis sondern zusätzlich auch
den Inhalt aller Unterverzeichnisse etc.
Immerhin zwei Leser wussten die Antwort auf diese Frage. Etwas
schneller war aber Christian H., dem wir noch einmal herzlich
zum Gewinn gratulieren. Das Buch hat er bereits letzten Monat erhalten.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] http://ikhaya.ubuntuusers.de/2006/03/18/es-ist-soweit:-der-ikhaya-newsletter-ist-da/
[2] http://www.freiesmagazin.de/artikelwuensche
[3] http://www.freiesmagazin.de/dritter_programmierwettbewerb
[4] http://www.freiesmagazin.de/20110130-umfrage-teilnahme-dritter-programmierwettbewerb
[5] http://www.freiesmagazin.de/20110130-umfrage-teilnahme-dritter-programmierwettbewerb#comment-1666
[6] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-02
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Martin Gräßlin Das X Window System ist mit über 25 Jahren geradezu der Methusalem in der
Softwarewelt. Die aktuelle Protokollversion X11 aus dem Jahre 1987 ist vier
Jahre älter als die erste Version des Linux-Kernels. Nun scheint die
Freie-Software-Gemeinschaft aktiv daran zu arbeiten, X in den wohlverdienten
Ruhestand zu schicken.
Der Beginn von Wayland
Vor zwei Jahren begann Kristian Høgsberg mit der Entwicklung eines „Display
Servers”: Wayland [1] war geboren. Der Start hätte
nicht schlechter sein können, denn Phoronix [2]
posaunte es zu früh in einer Falschmeldung heraus. Wayland wurde als neuer
X-Server bezeichnet, was es aber nicht
ist [3].
Dies ist wohl immer noch einer der Gründe, warum es so ein starkes Missverständnis
über Wayland gibt und viele zukünftige Nutzer Wayland aus Unwissenheit
grundlegend ablehnen.
Mittlerweile hat die Entwicklung von Wayland deutlich an Geschwindigkeit aufnehmen
können [4], da Intel den Hauptentwickler
angestellt hat, um Wayland für MeeGo zu implementieren. Große Distributionen wie
Ubuntu [5] und
Fedora [6]
haben eine frühe Adaption angekündigt und die Entwickler von X-Fenstermanagern
machen sich bereits Gedanken zur
Portierung [7].
Selbst Keith Packard [8], das Gesicht von X, möchte in Zukunft nur noch
aktiv an der Ablösung von X mitwirken [9].
Die Vergangenheit von X
Um zu verstehen, warum an der Ablösung von X gearbeitet wird, muss man sich
zuerst ein bisschen mit X auseinandersetzen. X hat sich in der Vergangenheit
dank der Erweiterungen als äußerst flexibel gezeigt. Neue Technologien wie
Compositing konnten integriert werden; auch größere Umstellungen wie die
Verlagerung von Kernel Mode Settings in den Linux Kernel hat X überstanden.
Warum kann man also nicht einfach so weiterarbeiten?
X stammt aus den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts und ist entwickelt
für die Anforderungen der 80er Jahre. Vieles, was heute als „Vorteil”
bezeichnet wird, war schlicht und ergreifend eine Notlösung. So gab es noch
keine Shared Libraries [10]; der Code
zum Zeichnen von grafischen Primitiven
hätte für jede Anwendung in den Arbeitsspeicher kopiert werden müssen. Bei
einer solchen Anforderung ist es naheliegend, ein Client/Server-Modell zu
entwickeln, das es den Anwendungen erlaubt, das aufwendige Zeichnen in einen
zentralen Prozess auszulagern und nur ein Protokoll zu verwenden, um
Zeichenoperationen anzustoßen. Somit war die
Netzwerktransparenz [11] von
X11 eher ein Nebenprodukt der historischen Gegebenheiten.
Die Aufgabe des X Window Systems war es also, Zeichenoperationen in Fenstern
auszuführen und die Fenster zu verwalten. Jedes Fenster nimmt einen kleinen
Bereich des Bildschirms ein und X muss dafür sorgen, dass diese Bereiche
neu gezeichnet werden, wenn z. B. ein Fenster geschlossen wird, welches ein
anderes überlappt. Das Konzept des
Fenstermanagers [12] war im
ursprünglichen X nicht einmal vorgesehen und so können Fenster sich selbst
positionieren, die Größe ändern, Fokus anfordern, Tastatur an sich reißen
und so weiter und so fort. Nur der Einsatz von Standards und „common sense”
verhindert, dass es nicht ein wahlloses Chaos gibt und man hat heutzutage
Fenstermanager, die sich darum kümmern, dass die Fenster sich benehmen. So
bietet zum Beispiel der KDE-Fenstermanager KWin über Fensterregeln und
JavaScript-Integration die Möglichkeit, so ziemlich jeden Fehler in
Anwendungen in Bezug auf das Fenstermanagement zu beheben. Anwendungen, die
sich nicht an die gemeinsamen Standards halten, gibt es dabei leider noch
mehr als genug – und dazu zählen auch moderne und häufig verwendete
Anwendungen wie Mozilla Firefox oder OpenOffice.org.
Fenster heute
Heutzutage werden Fenster gänzlich anders auf den Schirm gebracht. Die
primitiven Grafikoperationen wurden längst durch die hardwarebeschleunigte
X-Erweiterung XRender [13] ersetzt. Aber selbst
diese ist mittlerweile in die Jahre gekommen und es wird ihr nachgesagt, langsamer
zu sein als die Software-Implementierung von Qt. Zum Teil litt sie auch unter der
Vernachlässigung seitens der Treiberhersteller, was zu Performanceproblemen
führte [14]. Mittlerweile
ist auch für fast jede Grafikkarte ein guter OpenGL-Treiber vorhanden und
mit Gallium3D [15] steht ein ausreichend
schneller Softwarerenderer zur Verfügung, um Grafikoperationen nun ausschließlich
mit OpenGL durchzuführen. Toolkits wie Qt brauchen somit nur noch eine Rendering
Engine, um sowohl Linux, Embedded Systems, Mac OS X und Microsoft Windows zu
unterstützen.
Ein Fenster nimmt nicht mehr einen wohldefinierten Bereich des Bildschirms
ein und der X-Server ist somit auch nicht mehr dafür zuständig, den Inhalt der
Fenster passend abzuschneiden – heutzutage übernimmt der Compositor diese
Aufgabe. Ein Fenster wird komplett in eine off-screen Pixmap gezeichnet
(„Redirect”) und der Compositor wird über Änderungen
an dieser Pixmap
informiert („Damage”). Der Compositor (meistens Bestandteil des
Fenstermanagers wie z. B. KWin oder Compiz) generiert aus der Pixmap eine
OpenGL-Textur und zeichnet diese auf den Bildschirm („Compositing”). Dabei
kann der Compositor diese auch verändert darstellen, zum Beispiel mit
Transparenz oder um eine Würfelkante herum gelegt.
Probleme der Architektur
Auch wenn die Infrastruktur zum modernen Zeichnen von Fenstern grundsätzlich
funktioniert, sind die Altlasten noch vorhanden und verursachen so ihre
Probleme. So gibt es zwei Varianten von nicht angezeigten Fenstern: ein
Fenster kann klassisch nicht „gemappt” sein (z. B. minimiert) oder der
Compositor kann es beim Rendern ausblenden (z. B. das Filtern in KDEs „Fenster
zeigen”-Effekt). Verwendet man nur die moderne Variante, dass der Compositor
es ausblendet, denkt das Fenster, es sei angezeigt und verhält sich
dementsprechend [16]. Ein Beispiel wäre
ein Videoplayer, der die Anzeige einstellt, wenn er minimiert ist. Umgekehrt
führt ein Unmappen des Fensters dazu, dass der Compositor die Pixmap nicht mehr
zur Verfügung hat und somit das Fenster nicht anzeigen kann.
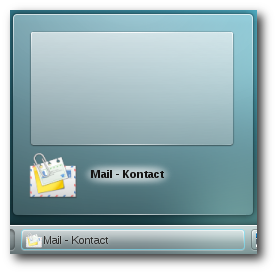
Durch das Minimieren ist das Fenster nicht mehr verfügbar und ein Vorschaubild kann nicht angezeigt werden.
Ein viel größeres Problem ist jedoch, dass X immer noch die heute nicht mehr
benötigten Altlasten mitschleppt und die Architektur immer noch darauf
ausgerichtet ist. Vor allem die Client/Server-Architektur scheint hier die
Schwachstelle zu sein. Der X-Server ist die zentrale Komponente, über die
alles verteilt werden muss. Es werden immer wieder „roundtrips” zum Server
benötigt. Bei einer lokalen Anwendung führt dies „nur” zu vielen
überflüssigen Kontextwechseln [17];
bei einer entfernten Anwendung kann dies
eine Anwendung stark ausbremsen.
Ideale Situation
In einer idealen Situation zeichnet jede Anwendung direkt in einen Puffer
und der Compositor kann diesen Puffer direkt in OpenGL verwenden. Nur noch
der Compositor entscheidet, wo sich ein Fenster befindet, ob es angezeigt
wird oder nicht. Das Fenster selbst muss nichts über die eigentliche
Position wissen und alles wird vom Compositor verwaltet. Tastatur und
Mausereignisse werden vom Compositor weitergeleitet, denn er weiß, für
welches Fenster das Ereignis ist, ob der „Schließen”-Knopf gedrückt wurde und
um wie viele Pixel die Eingabe verschoben werden muss, um ein Fenster über
den Würfel zu bewegen. Eine zentrale Komponente wie den X-Server gibt es
nicht mehr. Und dies ist genau die Architektur von Wayland.

Wayland Logo. © Kristian Høgsberg (modifizierte MIT-Lizenz)
Die Mär der Netzwerktransparenz
Verfolgt man die Diskussionen zu Wayland in diversen linuxnahen Foren, so
scheint die Netzwerktransparenz das Killerfeature zu sein, ohne das niemand
einen Linux-Desktop einsetzen
würde [18].
Jedoch ist fraglich, ob die X-Netzwerktransparenz heute überhaupt noch sinnvoll
ist. Wie oben bereits angesprochen, ist die Netzwerktransparenz eher ein Nebenprodukt der
Anforderungen der 80er, die eine Client/Server-Architektur benötigten.
Heute
zeichnen Anwendungen jedoch mittels OpenGL und nicht mehr über X11. Dies
führt zu einigen unangenehmen Auswirkungen für die Netzwerktransparenz. Das
Protokoll ist optimiert für das Zeichnen von Primitiven mittels X11. Nun
zeichnen die Anwendungen entweder auf Software emuliert (z. B. Qt Raster
Engine) oder hardwarebeschleunigt mittels OpenGL. In vielen Fällen wird
einfach in eine Pixmap gezeichnet und mittels Blitting auf den Bildschirm
bzw. die off-screen Pixmap transferiert. Widget Styles wie z. B. Oxygen aus
dem Hause KDE setzen massiv auf Animationen. Diese benötigen sehr viele
Pixmaps, die jedes Mal an den X-Server übertragen werden. Selbst in einem
lokalen Netzwerk kann hierbei das Protokoll schnell an
die Grenze kommen. Zum
Übertragen von „Video” ist X11 aber nun wirklich nicht gedacht, denn es war
optimiert für die primitiven Anforderungen des letzten Jahrhunderts.
Ein anderes Problem für moderne Anwendungen ist die komplett fehlende
Netzwerktransparenz von D-Bus. Kaum eine Anwendung kommt heute noch ohne
D-Bus aus. Eine Benachrichtigung würde also an den falschen Rechner
gesendet, Application Indicators werden in den falschen Systemabschnitt
integriert, das Menü wird einfach nicht angezeigt und viele weitere Probleme
werden in Zukunft auftreten. Dass die Netzwerktransparenz mit
Wayland nicht mehr funktionieren wird, liegt nicht primär an Wayland, sondern
daran, dass sie nicht mehr zeitgemäß ist.
Als Ersatz für die Netzwerktransparenz wurde vorgeschlagen, diese direkt in
die Toolkits (also GTK+ und Qt) zu integrieren – und dies wäre auch
sinnvoll. Als Beispiel seien hier einmal Icons genannt. Für Icons gibt es
eine freedesktop.org-Spezifikation [19].
Icons können über die verschiedenen Arbeitsflächen hinweg einheitlich angesprochen
und ausgewählt werden. Mit X wird das Icon vom entfernten Rechner geladen und als Bild
übertragen. Es weiß nichts über das verwendete Icon-Theme auf dem
Zielrechner. Verlagert man die Netzwerktransparenz in das Toolkit, könnte die
entfernte Anwendung einfach das Icon vom lokalen Rechner laden, sofern es dort
vorhanden ist. Die komplette Übertragung des Icons ist somit wegoptimiert und
die Anwendung fühlt sich nativer und lokaler an.
Wayland kann auch X-Clients anzeigen und somit ist es auch in
Zukunft möglich, noch die X11-Netzwerktransparenz zu nutzen. Noch auf Jahre
werden Anwendungen X unterstützen. Das Argument der fehlenden
Netzwerktransparenz ist für Wayland einfach nicht haltbar. Nutzer, die von
Wayland profitieren, wissen nicht einmal, was die Netzwerktransparenz ist
oder wofür sie sie einsetzen sollten. Die Zukunft von Wayland liegt mit
Sicherheit auch bei Smartphones. Daher ist es nicht überraschend, dass
Wayland OpenGL ES verwendet und von Intel gesponsort wird.
Wie geht es weiter?
Bis Wayland für die Nutzer einsetzbar wird, wird noch einige Zeit vergehen:
Toolkits müssen portiert werden, um von Wayland zu profitieren,
Desktopumgebungen müssen sich von X lösen und Fenstermanager zu großen
Teilen neu geschrieben werden. Die Arbeit dazu hat bisher höchstens im
konzeptionellen Bereich begonnen. KDE Plasma dürfte von der existierenden
Portierung auf Microsoft Windows profitieren, da es zeigt, dass man Plasma
ohne X11 verwenden kann. Etwas komplizierter dürfte es für X-Fenstermanager
werden. Diese wurden speziell für X entwickelt und gehen so ziemlich überall
davon aus, dass sie auf X laufen. Fenstermanager, die bereits einen
Compositor integrieren, haben hier zumindest einen Vorteil. Jedoch verwendet
kaum ein Fenstermanager OpenGL ES. Der KDE Fenstermanager KWin befindet sich
aktuell in Portierung und wird demnächst in die Hauptentwicklungslinie Einzug
erhalten [20].
Die Fenstermanager müssen nun die X11 Abhängigkeit in Plug-ins auslagern, um
auch ohne X11 starten zu können. Zusätzlich müssen sie das Wayland-Protokoll
verwenden und eine möglichst große Kompatibilität herstellen. Gerade zur
Standardisierung wie die Extended Window Manager
Hints [21] gibt es aktuell
noch keine Bestrebungen. Bis Wayland also voll einsatzfähig ist und die
Nutzer sich von X verabschieden müssen, werden wohl noch Jahre vergehen. Der
Umstieg auf Wayland ist ein wichtiges, aber lang andauerndes Projekt.
Links
[1] http://wayland.freedesktop.org/
[2] http://www.phoronix.com/vr.php?view=13065
[3] http://hoegsberg.blogspot.com/2008/11/premature-publicity-is-better-than-no.html
[4] http://cgit.freedesktop.org/wayland/log/
[5] http://www.markshuttleworth.com/archives/551
[6] http://lists.fedoraproject.org/pipermail/devel/2010-November/145273.html
[7] http://smspillaz.wordpress.com/2010/11/07/compiz-in-a-strange-new-land/
[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Keith_Packard
[9] http://lwn.net/Articles/413335/
[10] http://de.wikipedia.org/wiki/Shared_Library
[11] http://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerktransparenz
[12] http://wiki.ubuntuusers.de/Fenstermanager
[13] http://en.wikipedia.org/wiki/XRender
[14] http://kde.org/announcements/4.1/
[15] http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium3D
[16] https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=189435
[17] http://de.wikipedia.org/wiki/Kontextwechsel
[18] http://www.pro-linux.de/umfragen/2/31/braucht-eine-grafische-oberflaeche-netzwerktransparenz.html
[19] http://standards.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.html
[20] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2010/11/kwin-compiles-for-opengl-es/
[21] http://standards.freedesktop.org/wm-spec/wm-spec-latest.html
| Autoreninformation |
| Martin Gräßlin (Webseite)
ist als KWin-Maintainer an einer Portierung zu
Wayland sehr interessiert.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Frank Stähr Die Pipe ist Vielen als eines der unter Unix mächtigsten Werkzeuge
bekannt. Sie ermöglicht es, die Ausgabe eines Befehls direkt an
einen anderen Prozess zu senden. Tatsächlich stellt die Standardpipe
aber nur die einfachste Form der Interprozesskommunikation dar.
Dieser Artikel beschäftigt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten,
Datenströme effizient zu verarbeiten, um- und weiterzuleiten. Auch
wenn die meisten vorgestellten Technologien und Konzepte sowohl von
der Programmiersprache als auch vom Betriebssystemen unabhängig sind, werden
sie hauptsächlich an der Unix-Shell und vor allem der Bash
verdeutlicht und Hinweise zu C / C++ gegeben.
Hinweis: Dieser Artikel spricht in erster Linie Fortgeschrittene
an, die viel programmieren oder skripten. Aber auch weniger
versierte Nutzer haben keine Verständnisprobleme zu erwarten, wenn
sie die meisten Beispiele ausprobieren und eventuell dem einen oder
anderen weiterführenden Link folgen.
Zurück zum Anfang: Eine „anonyme Pipe“ (deutsch: Rohr, Röhre) [1]
wird mit dem Operator | erzeugt und bindet die Standardausgabe des
ersten an die Standardeingabe des zweiten Befehls. Dies ist auch mehrfach
hintereinander möglich, insgesamt also beispielsweise:
$ dmesg | grep -n USB | tail
Der weniger erfahrene Nutzer mag sich nun sofort die Frage stellen,
ob und warum dieses Prinzip überhaupt wichtig ist – schließlich
scheinen Pipes unter kommerziell vertriebenen Betriebssystemen
praktisch gar nicht relevant zu sein. Dazu kann man mehrere
Antworten geben:
- Zunächst ist eine universelle, portierbare und von der
Benutzeroberfläche unabhängige Interprozesskommunikation (kurz
IPC) [2]
wichtiger Bestandteil der Unix-Philosophie [3] [4]
und hat sich über Jahrzehnte als effizientes Prinzip der
Programmierung und auch Anwendung bewährt. Vor allem beim
wissenschaftlichen Arbeiten, Auswerten von Textdateien und
dergleichen gestalten sich Pipes als zwingend notwendiges Instrument.
- In der Tat macht auch proprietäre Software stark von den verschiedenen
Formen der Interprozesskommunikation Gebrauch, versteckt dies aber in der Regel im Quellcode
einer höheren Programmiersprache. Dem Open-Source-Benutzer
erscheinen die einzelnen Systemabläufe im Gegensatz dazu aber transparenter.
- Und schließlich sei im Gegensatz zum Bisherigen noch gesagt, dass
die Grundidee von Pipes unter Umständen durchaus der von Closed
Source widersprechen kann. Denn ein Programmierer freier Software
achtet besonders auf die Wiederverwertbarkeit seines Werkes, eben
auch und vor allem im Zusammenspiel mit anderen Programmen, während
dies bei kommerzieller Software gerade nicht erwünscht ist, da es
einer möglichen Interaktion mit einem „Konkurrenten“ gleichkommt.
Deswegen und darüber hinaus auch wegen der Anwenderfreundlichkeit
ist unfreie Software oft untrennbar mit einer grafischen
Benutzeroberfläche verknüpft. Dieser Umstand resultiert in einer nur
unerheblichen Bedeutung der Konsole und hat außerdem den
interessanten Nebeneffekt, dass es z. B. unter MS Windows keinen
guten, vorinstallierten Texteditor gibt (siehe „Notepad++ und
Notepad2 – Open-Source-Editoren für Windows“, freiesMagazin 09/2010 [5]).
Alles in allem haben Pipes demnach ihre Berechtigung. Die
Alternative ist das Abspeichern von Zwischenergebnissen in Dateien,
die dann vom nächsten Programm wieder geladen werden. Abgesehen von
der umständlichen Befehlsfolge ergeben sich daraus je nach Umsetzung
verschiedene Schwierigkeiten:
Möchte man die diversen
Programmausführungen aus Effizienzgründen nicht nacheinander,
sondern parallel laufen lassen, kommt die Frage auf, wann die IPC
eigentlich beendet ist; bei großen Datenmengen kann man nicht auf im
RAM liegende Dateisysteme zurückgreifen (siehe den vorletzten Abschnitt
„Dateien im Arbeitsspeicher“) und hat somit das Problem
kostspieliger I/O-Operationen, da Schreib- und Leseprozesse auf die
und von der Festplatte sehr zeitaufwändig sind.
Umleitungen
Nichtsdestotrotz stellen Dateien in der Praxis die wichtigsten
Datenquellen und -senken dar.
Operatoren < und >
Für Umleitungen verwendet die Unix-Shell [6]
die einfachen Pfeiloperatoren < und >, die symbolisch die Richtung
des Datenflusses anzeigen. Dabei leitet < die nachfolgende Datei zur
Standardeingabe des aktuellen Befehls, > gibt die Standardausgabe
des Befehls in die nachfolgende Datei aus. Möchte man alle Zeilen
einer Datei nach einem gewissen Suchbegriff filtern, ginge das
beispielsweise mit
$ <infile grep suchbegriff >outfile
Diese Schreibweise mag dem einen oder anderen vielleicht etwas
ungewohnt vorkommen, schließlich akzeptiert der grep-Befehl ja auch
Dateinamen als Argument:
$ grep suchbegriff infile >outfile
Hier ist allerdings problematisch, dass der Name der Eingabedatei
nicht klar gekennzeichnet ist, er könnte z. B. dem Suchbegriff ähneln
– längere Befehle können so unübersichtlich werden.
$ cat infile | grep suchbegriff >outfile
ist dagegen keine Lösung, denn abgesehen von dem höheren
Schreibaufwand und der unschönen Zweckentfremdung des Befehls cat
– dieser verkettet mehrere Dateien – wird auf diese Weise ein ganz
neuer, unnötiger Prozess gestartet [7].
Darüber hinaus unterstützen nicht alle Befehle das Einlesen von
Dateien per Parameterübergabe, die Konsole ist generell sogar
Standard. Man kann in den obigen Befehlen etwa die Ausgabedatei
weglassen, oder die Eingabedatei – oder beides. Weiterhin können, da
keinerlei Verwechslungsgefahr der Datenströme besteht, die
Dateiumleitungen von Ein- und zu Ausgabe im Befehl vollkommen
beliebig positioniert werden, sodass die vierte Variante
$ >outfile grep <infile suchbegriff
identisch zu den anderen drei ist. Man sollte sich in diesem Fall
noch einmal darüber im Klaren sein, dass <infile kein
Kommandozeilenparameter von grep ist – genausowenig wie
>outfile in den vorherigen Beispielen. Beide werden vor dem
Aufruf von grep von der Shell interpretiert.
Die Zieldatei wird, sollte sie schon existieren, ohne Rückfrage überschrieben. Daher ist es im Übrigen auch möglich, sie mit
$ >outfile
zu leeren. Dies ist etwa für Logdateien sinnvoll. Abgesehen von dem
minimalen Aufwand hat diese Methode den Vorteil, dass Prozesse, die
gerade in diese Datei schreiben, nicht neu gestartet werden müssen.
Würde man beispielsweise per
$ cp original ziel
eine große Datei erstellen und sie währenddessen in einer zweiten Konsole mit
$ rm ziel && touch ziel
versuchen zu leeren, so gibt es im besten Fall keine Fehlermeldung,
das gewünschte Ergebnis erhält man aber definitiv nicht. Denn der
Schreibvorgang verliert wegen der Löschaktion das korrekte
Datei-Handle auf ziel, nach seinem Abschluss werden daher alle
geschriebenen Daten verworfen und es bleibt wegen des
touch-Befehls lediglich eine vollkommen leere Datei übrig. Korrekt
ist somit
$ >ziel
wobei außerdem die Zugriffsrechte von ziel erhalten bleiben.
Auch wenn sich dieser Artikel an der Bash orientiert, sei noch
gesagt, dass der Befehl in einigen Shells nicht funktioniert, in
diesem Falle hilft stattdessen
$ : >outfile
Dabei ist der Doppelpunkt der „Nullbefehl“, also eine Art Platzhalter
– er hat keine Ausgaben, ignoriert alle Eingabeströme und Parameter
und vermeldet dem Betriebssystem eine erfolgreiche Ausführung, d. h.
den Rückgabewert 0.
Es ist aber auch möglich, die Ausgabe mittels >> statt >
an existierende Dateien anzuhängen:
$ ls >> verzeichnisliste
Hier-Dokumente
Damit kommt sofort die Frage auf, welche Funktion der Operator <<
erfüllt. Unglücklicherweise passt die Antwort weder zur Logik der
drei anderen Operatoren noch erschließt sich einem der Sinn der
Anwendung auf Anhieb: << erzeugt ein sogenanntes „Hier-Dokument“
(auch Heredoc) [8]. Das
ermöglicht es, eine längere Zeichenkette direkt in der Kommandozeile
zu tippen und an die Standardeingabe weiterzuleiten. Nach << folgt
ein Delimiter, der das Ende des einzugebenden Textes anzeigt. Der
Aufruf
$ grep foo << ende | sort
> foo
> bar
> eof foo
> ende
mündet in der Ausgabe
eof foo
foo
Was ist passiert? Der Eingabestring lautet
foo
bar
eof foo
und wird direkt als Standardeingabe an grep übergeben. Aus ihm
werden alle Zeilen, die foo enthalten, gefiltert und das Resultat
sortiert. Genauso ginge
$ grep foo << eof | sort
> foo
> bar
> eof foo
> eof
Um die Zeichenkette zu beenden, muss der Trenner, hier eof statt
wie vorhin ende, also ganz alleine in der letzten Zeile stehen,
auch Leerzeichen sind dann verboten. Er ist frei wählbar, sollte
aber natürlich mit keiner der Eingabezeilen identisch sein.
Zu diesem Kommando gibt es zwei Alternativen:
- Ruft man grep ohne Eingabedatei auf, wird wie oben automatisch
die Standardeingabe gewählt. Liegt diese noch nicht vor, verlangt
sie das Terminal per Prompt. Folglich
$ grep foo | sort
Zur Endmarkierung des anschließend manuell einzugebenden Strings
genügt die Tastenkombination „Strg“ + „D“, sie sendet ein End-of-File [9] an die Pipe.
- Die Eingabe kann natürlich auch über eine Datei erfolgen.
Diese beiden Methoden bringen aber Probleme mit sich: Zum einen
steht in einem (nicht-interaktiven) Skript „Strg“ + „D“ nicht zur
Verfügung, zum anderen möchte man manchmal keine externe Datei
involvieren, sondern dessen Inhalt direkt niederschreiben. Nun
erschließt sich einem auch der Name etwas besser: Hier-Dokument. Es
handelt sich somit um eine Datei, die einfach nur an Ort und Stelle
definiert wird. Damit ist der <<- ähnlich wie der <-Operator ein
weiteres Instrument der Konsole, das das Skripten angenehm machen
kann, aber keine zwingende Daseinsberechtigung besitzt.
Für Shell-Skripte bietet es sich noch an, vor den Trenner einen
Bindestrich zu setzen, da dann führende Tabs, aber nicht
Leerzeichen, im Heredoc ignoriert werden. Das erhöht die Lesbarkeit.
(Tabulatorzeichen können im Prompt nicht direkt erzeugt, sondern
müssen vorher maskiert werden – in den meisten Shells mit „Strg“ + „V“.)
$ cat <<- 42
Dies ist Zeile 1 der Nachricht.
Dies ist Zeile 2 der Nachricht.
Dies ist die letzte Zeile der Nachricht.
42
Im Internet-FAQ-Archiv [10]
findet man noch einige andere Anwendungen und Tricks.
Hier-Dokumente werden auch von Perl, Python, PHP und anderen
Sprachen zur Verfügung gestellt, teils in anderer Syntax. Ein
nützlicher Spezialfall ist der Hier-String [11],
der durch <<< eingeleitet und ein einfaches „Enter“ abgeschlossen wird. Statt
$ echo "sqrt(25.000)" | bc
kann man sich einen Prozess sparen:
$ bc <<< "sqrt(25.000)"
Da die Anführungszeichen die Zeichenkette eindeutig definieren, ist
auch eine andere Reihenfolge erlaubt:
$ <<< "sqrt(25.000)" bc
Dateideskriptoren
Mehrere Befehle in geschweiften Klammern bilden Einheiten.
Eventuelle Ein- und Ausgaben werden dann so gehandhabt, als ob nur
ein Befehl aufgerufen würde.
$ { touch /Tresor; echo 23; }
gibt zwei Zeilen aus. Man beachte das Leerzeichen nach der öffnenden
Klammer und das zweite Semikolon. Leitet man das Resultat nun aber
per >output in eine Datei um, macht man eine interessante
Feststellung: Eine Zeile landet in dieser Datei, die Fehlermeldung
wird aber weiter auf der Konsole ausgegeben. Das Betriebssystem kann
folglich verschiedene Arten von Ausgaben voneinander unterscheiden,
ohne dass die entsprechenden Kanäle explizit dem Anwender angezeigt
werden.
Das entsprechende Konzept sind die „Dateideskriptoren“ (auch
Datei-Handles, Handles) [12].
In POSIX-konformen Systemen [13]
sind sie im Grunde lediglich nicht-negative, ganze Zahlen, die vom
Kernel an bestimmte Ein- oder Ausgabeströme gebunden werden. Dies
mag unnötig technisch wirken – die Idee lässt sich dahingehend
abstrahieren, dass Zahlen als Identifikatoren für Datenströme
dienen, denn sie werden pro Prozess bzw. pro Shell eindeutig
vergeben. Mit Handles umgeht man komplexe Aufgaben wie etwa Pufferung.
Als Standard sind die ersten drei Werte in der Konsole bereits
reserviert: 0 für die Standardeingabe, 1 für die Standardausgabe und
2 ist der Kanal der Fehlerausgabe. Gerade der letzte Deskriptor ist
sehr sinnvoll, um fehlerhafte Programmausführungen vom Rest zu
trennen. Die Kanäle kann man mit den Umleitungsoperatoren auch
direkt ansprechen, dazu folgende Beispiele:
Analog verhält es sich auch mit dem Eingabeoperator <, es sind damit
auch andere (sogar mehrere!) Eingabeströme möglich. Dies erscheint
etwas seltsam, da standardmäßig nur einer reserviert ist. Bisher
kann man bereits ein paar allgemeine Regeln
aufstellen [14]:
- m>&n übergibt die Ausgabe, die normalerweise an Handle m geht, an
Handle n.
- m<&n nimmt eine Eingabe aus Handle m entgegen, die aber
ursprünglich aus Handle n stammt.
- Zwischen Umleitungssymbolen und Deskriptoren dürfen keine
Leerzeichen stehen. In anderen Fällen, etwa Dateien, sind sie
hingegen erlaubt.
- Quell- und Zieldateideskriptoren, d. h. die Zahlen hinter den
spitzen Klammern, werden mit dem Symbol & gekennzeichnet.
- Die Angabe von > ist ein Synonym für 1> und < entspricht 0<.
- Außerdem schließt n>&- bzw. n<&- den Kanal n.
Mit einem kurzen &>file landen sowohl Standard- als auch
Fehlerausgabe in einer Datei, was folglich äquivalent zu >file
2>&1 ist. Genauso ist &>>file gleichbedeutend zu >>file 2>&1.
Analog kann man beide Kanäle mit - & an eine Pipe übergeben. Ein
einfaches - & : unterdrückt so sehr effizient die komplette
Rückmeldung der Ausführung. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn von
einem Programm lediglich der Exit-Code benötigt wird. Eine
Alternative ist die Umleitung in den „Mülleimer“ von Unix mittels
&> /dev/null [15].
exec
Dateideskriptoren kann man mit exec [16]
dauerhaft umhängen oder neu erstellen. Dabei sollten
sie nicht größer als 9 sein, da sie dann mit Dateideskriptoren, die
die Shell intern nutzt, in Konflikt geraten könnten. Mittels
$ exec 5>logfile
öffnet man logfile über Kanal 5 als Datensenke und kann anschließend
beliebig viele Ausgaben mit >&5 oder speziell Fehlermeldungen mit
2>&5 an diese leiten. Erst mit
$ exec 5>&-
wird der Schreibvorgang abgeschlossen und die Datei würde bei
Wiederholung dieser Befehlsabfolge überschrieben werden.
Ganz ähnlich gestaltet sich die Verwendung einer Datei als
Datenquelle, und sogar beides ist möglich: Eine Datei, die zumindest
ein paar Textzeilen enthalten sollte, wird per
$ exec 6<>rwfile
zum Lesen und Schreiben geöffnet. Nun könnte man mit
$ head -n 2 <&6
$ echo overwrite >&6
zunächst die ersten beiden Zeilen auslesen und anschließend etwas in
die Datei schreiben. Mit diesen und ähnlichen Kommandos wird
ersichtlich, dass der Deskriptor immer eine bestimmte Position im
Datenstrom hat, die stets an das Ende der zuletzt berührten
Zeichenkette gesetzt wird und dort auch mit neuen Lese- oder
Schreibvorgängen beginnt; bei letzteren wird byteweise
überschrieben. Es ist egal, mit welchem der Befehle
$ exec 6>&-
$ exec 6<&-
man das Handle schließt.
Deskriptoren haben vielfältige Anwendungen, von denen einige im
Folgenden näher erläutert werden.
Ausgaben dauerhaft in eine Datei umleiten
Mit einem einfachen exec >logfile würde leider der Deskriptor
verloren gehen, daher muss er vorher gesichert werden:
$ exec 6>&1
$ exec >logfile
Zunächst zeigt Kanal 6 auf 1, also auf das Terminal, die zweite
Zeile leitet 1 in eine Datei.
$ ls # und diverse andere Befehle
Die Konsole gibt dann nur noch eventuelle Fehlermeldungen aus. Ein
abschließendes
$ exec 1>&6 6>&-
stellt den Ursprung wieder her: 1 zeigt auf 6, also auf das
Terminal, 6 wird geschlossen. Ganz analog kann man so die
Standardeingabe an eine Datei binden.
Mit diesem Beispiel sieht man auch, dass exec nicht mit
Verknüpfungen arbeitet, sondern echte Kopien erstellt – nur so ist
es möglich, Sicherheitskopien derart zu verwalten. Für Kanal 1 bzw.
für die Konsole bietet aber auch das Betriebssystem eine solche
Sicherheitskopie, das Terminal versteckt sich nämlich in der Datei
/dev/tty. Obige Befehlsfolge entspricht daher:
$ exec >logfile
$ ls # und anderes
$ exec >/dev/tty
Die Logdatei kann man sich jeweils anzeigen lassen:
$ more logfile
Versteckte Informationen für die GUI
Wie bereits erläutert stellen viele proprietäre Programme von Haus
aus eine grafische Benutzeroberfläche bereit, die nicht nur
schmückendes Beiwerk ist, sondern sich ohne Weiteres weder
austauschen noch überhaupt entfernen lässt und den Benutzer in
seinen Möglichkeiten einschränkt. Die Verschmelzung von GUI und
Programmfunktionalität dient in erster Linie der einfachen
Bedienbarkeit, was natürlich nichts Schlechtes ist, denn so können
die verschiedenen Teilmodule besser
aufeinander abgestimmt werden.
Unter Umständen
ist es eben sehr praktisch, wenn die GUI gewisse
Informationen von der ausführenden Anwendung erhält.
Ein wirklich gutes Programm läuft allerdings grundsätzlich ohne
Benutzeroberfläche, ist also auf seine Funktionalität beschränkt. Im
Folgenden sollen die Vorteile von beiden Herangehensweisen mittels
Meldungen an die Benutzeroberfläche verknüpft werden. Solche sind
aber leider nicht immer über die voreingestellten Kanäle 1 und 2
möglich, denn 2 ist wirklich nur für Fehlermeldungen, während 1
gemäß Unix-Philosophie standardmäßig keine Rückmeldung auf den
Bildschirm gibt. Für so eine Aufgabe sind zusätzliche
Dateideskriptoren vorteilhaft.
Als Beispiel soll ein Programm copy.sh betrachtet werden, dass
eine einzelne Datei kopiert, d. h., einen Spezialfall von cp
darstellt. Es könnte in etwa so aussehen:
#!/bin/bash
size=$(stat -c%s "$1")
if [ $size -lt 9900 ]; then
cp "$1" "$2"
exit 0;
fi
exec 3<"$1" 4>"$2"
puffer=$(($size/100))
for ((i=0; i <= 100; i++)) do
<&3 head -c $puffer >&4
{ echo $i >&7; } 2>/dev/null
done
exec 3<&- 4>&-
Listing: copy.sh
Der head-Befehl kopiert die Quelle immer blockweise ins Ziel,
kleine Dateien werden hingegen auf einmal kopiert. Interessant ist
Zeile 14, sie liefert über Kanal 7 eine Fortschrittsanzeige des
laufenden Prozesses in Prozent. An dieser Stelle wurde auch noch
etwas getrickst, denn normalerweise muss dieser neue Deskriptor erst
definiert werden. Stattdessen wird die Fehlermeldung
bash: 7: Bad file descriptor
direkt nach /dev/null geleitet.
Das Skript kann mit
$ ./copy.sh quelldatei zieldatei
ausgeführt werden und beendet sich im Erfolgsfall wie gewünscht
still und leise, genau wie cp. Wer den Code ausprobieren möchte,
muss bedenken, dass die Anwendung aus didaktischen Gründen sehr
einfach gehalten ist und daher auf einige Sicherheitsabfragen und
Komfort verzichtet, die Quelldatei muss beispielsweise existieren.
Zur Erstellung einer (in diesem Fall recht rudimentären) grafischen
Oberfläche kann man Zenity [17]
verwenden, welches einfache Dialoge und Fenster bietet und unter
GNOME meist vorinstalliert ist (siehe „Zenity und KDialog“,
freiesMagazin 03/2007 [18]).
Somit enthält das Skript copy_gui.sh lediglich:
#!/bin/bash
exec 7>/dev/null
./copy.sh "$1" "$2" 7>&1 | zenity --progress
exec 7>&-
Listing: copy_gui.sh
Die Prozentzahlen werden von Kanal 7 entgegengenommen, an die
Standardausgabe geleitet und über eine anonyme Pipe an Zenity
weitergegeben, das – mit den richtigen Optionen aufgerufen – den
Rest erledigt. Der Aufruf ist wie eben
$ ./copy_gui.sh quelldatei zieldatei
Bei großen Dateien sieht man nun sehr gut die Fortschrittsanzeige
des Kopiervorgangs. Das KDE-Pendant zu Zenity ist im Übrigen
KDialog, entsprechend müsste die entscheidende Zeile
./copy.sh "$1" "$2" 7>&1 | kdialog --progressbar
lauten.
Auch C kann mit der Funktion
int write(int fd, const void *puffer, size_t bytezahl)
direkt einen beliebigen Dateideskriptor anschreiben, z. B. Kanal 8 per
write(8, "Hallo\n", 6);
Es ist in C++ mit der richtigen Bibliothek [19] sogar möglich,
aus einem gegebenen Kanal das zugehörige stream-Objekt zu bestimmen,
daher entspricht der Codeschnipsel
fdostream output(8);
output << "Hallo\n";
dem obigen.
TCP-Verbindungen offenhalten
Unter Unix ist alles eine Datei – Laufwerke, Geräte und sogar
Dateideskriptoren sowie TCP- und UDP-Verbindungen. Daher ist
$ date >&5
identisch zu
$ date >/dev/fd/5
und
$ echo message >/dev/tcp/host/port
schickt eine Nachricht an einen Port eines bestimmten Hosts, z. B.
einer Internetadresse. Die Shell kümmert sich dabei automatisch um
den Verbindungsaufbau, Datenübertragung und abschließenden
Verbindungsabbau. Man beachte, dass schon der Ordner tcp gar nicht
existiert, man also den größten Teil des Pfades manuell, d. h. ohne
Autovervollständigung, eingeben muss [20].
Zum Testen kann man dafür die Netcat-Programme verwenden, die über
das Paket nmap installiert werden.
$ nc -l 5555
startet einen Server, der nun auf eine eingehende Verbindungen wartet, während
$ cat >/dev/tcp/localhost/5555
in einer anderen Konsole desselben Rechners eine Nachricht an diesen
sendet. Oder von ihm empfängt:
$ read </dev/tcp/localhost/5555
Auf der Serverseite kann man nun eine Zeile absenden und sie sich
mit echo $REPLY beim Client ansehen. Nachteilhaft ist hier, dass
die Verbindung jeweils nach einer Datenübertragung sofort beendet
wird. Abhilfe schafft
$ exec 4>/dev/tcp/localhost/5555
auf Seiten des Clients.
Da TCP nach erfolgreichem Verbindungsaufbau nicht mehr zwischen
Server und Client unterscheidet, sind statt > auch die spitzen
Klammern < oder gar <> möglich. Nun ist die Verbindung an
Dateideskriptor 4 gebunden und es können beliebig viele Daten
ausgetauscht werden; beendet wird erst mit
$ exec 4>&-
Statt TCP ist auch UDP als Protokoll möglich.
Dateien offenhalten
Generell werden mit Handles also Schreib- und Lesezugriffe von
Prozessen auf gewisse Datenströme – meistens eben Dateien –
offen gehalten. Als letzte Verdeutlichung betrachte man noch den
Löschbefehl [21]. rm ist von
allen Befehlen unter Unix sicherlich einer der erstaunlichsten:
Vielen mag bekannt sein, dass Dateien nicht vollständig gelöscht,
sondern der Einfachheit halber nur aus dem Dateisystem entfernt
werden, der eigentliche Inhalt wird bei späteren Schreibzugriffen
zufällig überschrieben. Viel interessanter ist aber das Verhalten
bei Dateien, auf die noch ein Deskriptor gesetzt ist: Zunächst wird
dann nur der Verzeichniseintrag gelöscht, der belegte Speicherplatz
wird aber vom Betriebssystem erst freigegeben, wenn der Deskriptor
geschlossen wird. Bis dahin können die Daten noch ausgelesen werden.
Dieses Verhalten macht sich beispielsweise dadurch bemerkbar, dass
man eine Mediendatei noch abspielen kann, obwohl sie bereits
verschoben oder gar gelöscht ist.
Möchte man eine Datei einlesen, verarbeiten und unter demselben
Namen abspeichern, lässt sich dieser Effekt geschickt einsetzen. Ein
$ <infos head -n 2 >infos
wird wahrscheinlich scheitern, da infos vor der Prozessausführung
vom Schreibvorgang geleert wird. Stattdessen könnte man verwenden:
$ exec 3<infos
$ rm infos
$ <&3 head -n 2 >infos
$ exec 3<&-
Diese Befehlsabfolge ist allerdings eher ein Trick und nicht
unbedingt für die Anwendung geeignet, kürzer und naheliegender
erscheint nämlich die Alternative
$ <infos head -n 2 >tempfile
$ mv tempfile infos
die jedoch das theoretische Problem mit sich bringt, dass tempfile
eine schon existierende Datei überschreiben könnte – zur Absicherung
wäre tatsächlich also doch noch mehr Aufwand nötig. Darüber hinaus
kann man durch Streichen von exec 3<&- erreichen, dass man zu
einem beliebigen späteren Zeitpunkt auf die Ursprungsdatei zugreifen
und etwa mit
$ <&3 head -n 2
die nächsten beiden Zeilen auslesen kann.
Benannte Pipes
Pipes sind unidirektional und bieten, da Shell-Kommandos von links
nach rechts abgearbeitet werden, keine Möglichkeit, Ergebnisse „nach
vorne“ zurückzureichen. Außerdem gelten anonyme Pipes nur zwischen
Eltern- und Kindprozessen, beide müssen also vereinfacht gesagt in
„derselben Zeile“ gestartet werden. Eine Lösung dieser Probleme sind
„benannte Pipes“, auch FIFOs genannt (englisch: Named
Pipes) [22]. Trotz ihrer
geringen Bekanntheit eignen sie sich optimal für IPC im lokalen
Netz, auch auf Grund ihrer leichten Handhabbarkeit.
Eine FIFO wird mit
$ mkfifo npipe
erzeugt und erscheint einem fast wie jede andere Datei: Sie kann
kopiert, verschoben, umbenannt und gelöscht werden, besitzt
Zugriffsrechte usw. Bei einer Auflistung via ls -l npipe fällt
allerdings schon der Dateityp „p“ auf [23].
Der Inhalt einer FIFO befindet sich allein im Arbeitsspeicher, im
Dateisystem wird ihre Größe immer mit Null angezeigt. Außerdem
benötigt sie, um Daten halten zu können, zumindest einen lesenden
oder einen schreibenden Prozess.
Ein Beispiel fürs Verständnis:
$ echo Hallo Welt > npipe
schiebt eine Zeichenkette in die FIFO. An dieser Stelle kann man
zunächst keinen weiteren Befehl eingeben, denn benannte Pipes
arbeiten grundsätzlich blockierend. Das heißt, obwohl der
echo-Befehl nach seiner Ausführung eine EOF-Bedingung erfüllt, darf
der Schreibvorgang nicht beendet oder beispielsweise mit „Strg“ + „C“
gar vorzeitig abgebrochen werden, denn dann gingen die Daten
verloren. Stattdessen muss man von einer anderen Konsole aus die
Eingabe auslesen, etwa mit
$ more npipe
Interessanterweise können die beiden Befehle sogar in umgekehrter
Reihenfolge gestartet werden. Die FIFO blockiert lesenden und
schreibenden Prozess so lange, bis über sie eine Verbindung zwischen
den beiden hergestellt ist und alle Zeichen übertragen werden
können. Eine einmal aufgebaute Verbindung darf dabei
nicht vom Leser
abgebrochen werden, da dann die Pipe zerstört wird und alle noch
gehaltenen Informationen verloren gehen.
Bidirektionale Interprozesskommunikation
Zwei Programme, die jeweils von der Standardeingabe lesen und auf
die Standardausgabe schreiben, können so über eine benannte Pipe
sehr effizient kommunizieren. Eigentlich erforderte jede
Kommunikationsrichtung eine FIFO, aber zusammen mit einer anonymen
Pipe genügt
$ <npipe programm1 | programm2 >npipe
Die Kommunikation könnte man darüber hinaus noch mit einem
$ echo "erster Wert" >npipe
anstoßen. Sobald npipe vom einen Prozess Daten erhält, leitet sie
sie an den anderen weiter. Es gibt keine Endlosschleife, die
permanent überprüft, ob Daten vorliegen, und auch das Ende der
Kommunikation wird durch das Schließen der schreibenden Seite
automatisch angezeigt und erscheint der lesenden wie das Ende einer
regulären Datei. Auch der Fall, dass eventuell zu viele Daten
vorliegen, die nicht so schnell vom Leser verarbeitet werden können,
stellt kein Problem dar, denn dann wird schlicht der schreibende
Prozess blockiert. Das bedeutet, benannte Pipes bringen naturgemäß
eine Flusskontrolle mit sich, im Übrigen genau wie anonyme. Der
Pufferspeicher ist für beide unter Linux allerdings sehr beschränkt,
bei größeren Datenmengen
wird daher meist auf die Methode des
Blockierens zurückgegriffen.
Da die stattgefundene IPC zwischen den Programmen nicht auf der
Konsole sichtbar ist, empfiehlt sich zusätzlich noch der Befehl
tee. Er leitet nicht nur die Standardein- an die -ausgabe weiter,
sondern kopiert sie außerdem noch in alle Dateien, die tee als
Argumente übergeben bekommt:
$ <npipe programm1 | tee log_1zu2 | programm2 | tee log_2zu1 >npipe
Mit der Option -a kann tee den Datenstrom auch an bestehende
Dateien anhängen, statt sie zu überschreiben.
Benannte wie auch anonyme Pipes können in C und anderen höheren
Programmiersprachen direkt erzeugt und verwaltet werden [1] [24] [25].
Prozesssubstitution
Aber damit noch nicht genug. Wie bereits erläutert stellen die
geschweiften Klammern in der Unix-Shell die logische Kapselung von
Befehlen dar. Im Gegensatz dazu erzeugen die runden Klammern eine
eigene Subshell, in der beispielsweise eigene lokale Variablen
gelten. Man vergleiche nur
$ katze=Felix
$ ( katze=Mauzi; echo $katze )
Mauzi
$ echo $katze
Felix
mit einem anschließenden
$ { katze=Minka; echo $katze; }
Minka
$ echo $katze
Minka
Die Bash verknüpft Subshells auf eine wirklich clevere Weise mit
FIFOs: Setzt man eine spitze Klammer ohne Leerzeichen vor eine
Subshell, gibt sie stattdessen an die äußeren Befehle den Namen
einer temporären FIFO zurück, aus der Daten ausgelesen oder in die
welche geschrieben werden, je nachdem, ob man < oder > setzt. Die
Subshell wiederum liefert oder empfängt die Daten über ihre
Standardaus- oder -eingabe.
$ cmp <(ls /ordner1) <(ls /ordner2)
überprüft somit, ob zwei Ordner die gleichen Dateinamen beinhalten.
„Prozesssubstitution“ [26]
ist also immer dann hilfreich, wenn Dateien als Datenquelle oder
-senke zwingend erforderlich sind und abgesehen von dieser Einschränkung
an Ort und Stelle weiterverarbeitet werden können.
Möchte man eine Eingabe vervielfachen, um damit verschiedene Befehle
abzuarbeiten, ginge etwa
$ ls | tee >(grep foo | wc >foo.count) >(grep bar | wc >bar.count) | grep baz | wc >baz.count
Anwendung: Programmierwettbewerb
Die bisherigen Wettbewerbe von freiesMagazin erforderten in der
Regel IPC im lokalen Netz. Ein typisches Szenario ist die
Organisation eines Spiels zwischen zwei Clients, also Bots, durch
einen Server. Dieser könnte so konzipiert sein, dass er mit
$ server input1 input2 output1 output2
gestartet wird. Die vier Argumente sind dabei allesamt Ein- oder
Ausgabedateien: input1 enthält alle Befehle, die Bot 1 an den
Server schickt, output1 alle, die er vom Server erhält; analog
input2 und output2. Die Bots selbst empfangen und senden
Nachrichten über die Kanäle 0 und 1, in C++ beispielsweise via
std::cin und std::cout. Mittels Prozesssubstitution können zwei
der vier Datenströme realisiert werden, die anderen beiden benötigen
manuell angelegte FIFOs. Um sicherzustellen, dass man keine
bestehenden Dateien überschreibt, kann man mit mktemp eine
temporäre Datei erzeugen. Da aber gar keine reguläre Datei gewünscht
ist und mktemp den Dateinamen zurückgibt, kann mit der Option -u
auch die eigentliche Erzeugung unterdrückt werden:
$ pipe1=$(mktemp -u); pipe2=$(mktemp -u);
$ mkfifo $pipe1 $pipe2
$ server <(<$pipe1 bot1) <(<$pipe2 bot2) $pipe1 $pipe2
$ rm $pipe1 $pipe2
Genauso ginge
$ server $pipe1 $pipe2 >(bot1 >$pipe1) >(bot2 >$pipe2)
Die Idee lässt sich offensichtlich auf beliebig viele Clients
verallgemeinern. Der Durchlauf könnte auch noch mit tee geloggt
werden, oder aber der Server speichert die Konversation oder
zumindest die Spielergebnisse selbstständig ab.
Die Vorteile dieses Verfahrens sind offensichtlich:
- Die Programmierung der Bots ist so am einfachsten, denn in
praktisch jeder Programmiersprache sind die Dateideskriptoren 0 und
1 sehr leicht ansprechbar.
- Die Bots sind auf ihre Funktionalität beschränkt, was auch einem
guten Programmierstil entspricht. Schließlich weiß man nie, in
welcher Umgebung sie später eingesetzt werden.
- Gleiches gilt natürlich auch für den Server.
FIFOs erlauben auch mehrere schreibende Prozesse, der Server bekommt
dann allerdings nicht automatisch die Information mitgeliefert, von
welchem Client die Nachricht stammt. Theoretisch sind sogar mehrere
lesende Prozesse möglich, was aber nur selten sinnvoll ist, da mit
jeder Leerung des Puffers nur ein Empfänger die Daten erhält – und
zwar ein zufälliger.
Sockets
Muss ein Bot nun doch über das lokale Netz hinaus aktiv werden, so
empfiehlt sich statt einer aufwändigen Änderung des Quellcodes die
Verwendung eines externen Programms. Der Befehl ncat, ebenfalls im Paket nmap enthalten,
bietet dafür die Option -e, die alle Ein- und Ausgaben eines
Programms mit der von ncat verwalteten Netzverbindung verdrahtet.
Zur Veranschaulichung hilft wieder ein kleines Beispiel: Nach dem
Start eines Servers mit
$ nc -l 5555
initiiert der Befehl
$ ncat -e bot localhost 5555
in einer anderen Konsole desselben Rechners die TCP-Verbindung. Auf
der Serverseite kann man nun Befehle manuell eingeben. Statt
localhost ist natürlich auch hier eine beliebige Internetadresse
möglich.
Für kompliziertere Aufgaben – mehrere Bots, ein automatisierter
Server – genügt die Konsole allerdings nicht mehr. Hier hilft nur
noch Socketprogrammierung. Auf Grund der Komplexität dieses Themas
wird nur auf die vielen Hilfen des Internets wie etwa
zotteljedi.de [27] verwiesen und
in diesem Artikel nicht weiter darauf eingegangen. Wichtig ist aber,
dass unter Unix tatsächlich auch der Dateityp „Socket“ zur Verfügung
steht. Liegt bereits ein fertiger Server wie oben vor, der Ein- und
Ausgabedateien liest, kann man folglich statt regulären Dateien und
statt FIFOs auch diese Sockets verwenden. Unter Unix ist eben
wirklich alles eine Datei. Allerdings muss man dann beachten, dass
Sockets grundsätzlich bidirektional arbeiten – ein weiterer Vorteil
gegenüber Pipes.
Dateien im Arbeitsspeicher
Was ist nun aber, wenn man einen Datenstrom nicht sofort verarbeiten
kann oder will oder aber mehrmals benötigt, wenn also reguläre
Dateien alternativlos sind? Für diesen Fall gibt es das „Temporary
File System“ tmpfs [28], das unter
jedem moderneren Linux bei /dev/shm eingebunden ist. Dessen Inhalt
liegt komplett im Arbeitsspeicher, sodass I/O-Operationen sehr
schnell ablaufen. Der Ordner /dev/shm funktioniert grundsätzlich
wie jeder andere, er kann Verzeichnisse und Dateien enthalten, die
gelesen, kopiert und gelöscht werden können. Nur muss man sich im
Klaren darüber sein, dass bei einem Neustart alles verloren geht.
Außerdem ist die Größe dieses Laufwerks beschränkt, sie liegt
standardmäßig bei der Hälfte des Arbeitsspeichers. Der genaue Wert
ergibt sich aus
$ df -h /dev/shm
Dieser Speicher ist aber rein virtuell, tatsächlich reserviert ist
nur der RAM, der auch wirklich von Dateien belegt ist und damit
gebraucht wird. Dies ist der entscheidende Unterschied zur
RAM-Disk [29], die ihrerseits aber
den Vorteil der Betriebssystemunabhängigkeit besitzt. Eine Änderung
der Größe bzw. der maximalen Größe von tmpfs ist möglich:
# mount -o remount,size=3G /dev/shm
Auch wenn notfalls Speicher auf die Swap-Partition ausgelagert wird,
sollte man an dieser Stelle allerdings wissen, was man tut, da
falscher Gebrauch zu Systeminstabilität führen kann.
Temporäre, oft gebrauchte Dateien können somit effizient
zwischengespeichert werden [30].
Fazit
Programme werden so entworfen, dass sie mit anderen Programmen
verknüpft werden können, und sie verarbeiten Textströme, denn dies
ist die universelle Schnittstelle – mit solchen simplen Regeln wurde
einst der Startschuss für die verschiedenen Formen der
Interprozesskommunikation gegeben. Als Anwender muss man abhängig
von der Situation jeweils nur die geeignetste wählen und hat die
Möglichkeit, eigene Skripte und Programme modular aufzubauen, Code
und andere Programme wiederzuverwenden und so effizient Kosten
einzusparen.
Dateideskriptoren handhaben nicht nur multiple Datenströme, sondern
fassen auch alle Arten von Ein- und Ausgabe einheitlich und intuitiv
zusammen. Dies ist sonst nur aus C++ bekannt, wo Datenquellen und
-senken gleichförmig mit >> und << angesprochen werden. Damit bietet
die Unix-Shell eine hohe Skalierbarkeit von Code, obwohl sie nur eine
Skriptsprache ist, und verspricht vielseitige Anwendungen vom
Programmierwettbewerb bis hin zu professionellen High-End-Produkten.
Denn in unixoiden Betriebssystemen beziehen sich Dateideskriptoren
nicht nur, wie ihr Name sagt, auf reguläre Dateien, sondern auch auf
Verzeichnisse, block- und zeichenorientierte Geräte, Sockets sowie
anonyme und benannte Pipes.
Wer alle diese Möglichkeiten der Shell zu nutzen weiß, wird
sicherlich der Aussage von
Dennis Ritchie,
Programmierer und Miterfinder von Unix, zustimmen: „Unix ist
einfach. Es erfordert lediglich ein Genie, um seine Einfachheit zu
verstehen.“ [31]
Links
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Pipe_(Informatik)
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Interprozesskommunikation
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Unix-Philosophie
[4] http://sites.inka.de/mips/unix/unixphil.html
[5] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-09
[6] http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-Kompendium:_Shellprogrammierung
[7] http://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Tipps_und_Tricks
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Here_document
[9] http://de.wikipedia.org/wiki/End_of_File
[10] http://www.faqs.org/docs/abs/HTML/here-docs.html
[11] http://tldp.org/LDP/abs/html/x17471.html
[12] http://en.wikipedia.org/wiki/File_descriptor
[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Operating_System_Interface
[14] http://tldp.org/LDP/abs/html/io-redirection.html
[15] http://www.faqs.org/docs/abs/HTML/zeros.html
[16] http://www.linuxtopia.org/online_books/advanced_bash_scripting_guide/x13082.html
[17] http://wiki.ubuntuusers.de/Zenity
[18] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2007-03
[19] http://www.josuttis.com/cppcode/boost/fdstream.hpp
[20] http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Redirections
[21] http://de.wikipedia.org/wiki/Rm_(Unix)
[22] http://linuxreviews.org/man/fifo/index.html.de
[23] http://wiki.ubuntuusers.de/Rechte#Dateitypen
[24] http://pronix.linuxdelta.de/C/Linuxprogrammierung/Linuxsystemprogrammieren_C_Kurs_Kapitel5.shtml
[25] http://pronix.linuxdelta.de/C/Linuxprogrammierung/Linuxsystemprogrammieren_C_Kurs_Kapitel5b.shtml
[26] http://tldp.org/LDP/abs/html/process-sub.html
[27] http://www.zotteljedi.de/socket-tipps/
[28] http://de.wikipedia.org/wiki/Tmpfs
[29] http://de.wikipedia.org/wiki/RAM-Disk
[30] http://www.howtoforge.de/howto/lagern-von-dateienverzeichnissen-im-arbeitsspeicher-mit-tmpfs/
[31] http://www.brainyquote.com/quotes/authors/d/dennis_ritchie.html
| Autoreninformation |
| Frank Stähr
nutzt Linux seit 2005 und benötigt es vor allem für sein
Studium, da es die umfassendsten Werkzeuge für wissenschaftliches
Arbeiten bietet. Mit Interprozesskommunikation musste er sich
kürzlich näher beschäftigen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der
fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben
Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen,
erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge
behält.
Linux 2.6.38
2.6.38-rc4 [1] fiel mit nur wenig mehr als 4000 geänderten Code-Zeilen äußerst klein aus, vermutlich eine Nachwirkung der eine Woche zuvor zu Ende gegangenen australischen Linux-Konferenz linux.conf.au, bei der einige Entwickler gebunden waren. So hatte diese Version außer kleineren Korrekturen kaum etwas zu bieten.
Die fünfte Vorabversion [2] war jedoch bereits wieder größer und auch interessanter: Die im November begonnene Aufräumaktion (siehe „Der November im Kernelrückblick“, freiesMagazin 12/2010 [3]) im Bereich der Treiber für zeichenorientierte Geräte („Character Devices“) wurde fortgesetzt. Nachdem Mitte Januar einige bereits in die tty-Umgebung ausgelagerte Komponenten wieder zurückgeholt wurden, buk man erst einmal wieder kleinere Brötchen mit der Auslagerung des virtio_console-Treibers in den Bereich der Terminal-Schnittstelle tty. Ganz so klein waren die Brötchen dann doch nicht, denn diese Aktion trug durch die Größe des Treibers ganz schön auf und stach damit aus den anderen Änderungen deutlich heraus, genauso wie die Verlagerung eines Teils der Dokumentation aus dem PowerPC-Bereich in den architekturunspezifischen Devicetree („Geräte-Baum)“. Die Hoffnung auf die endgültige Beseitigung eines Problems mit der neuen Funktion „RCU filename lookup“ zerschlug sich schon wenige Stunden nach Veröffentlichung des -rc5 [4].
Die Version 2.6.38-rc6 [5] fiel wieder kleiner aus, Torvalds hob dann auch nur die Beseitigung eines Speicherfehlers hervor, von dem zwar nur sehr wenige betroffen waren, der jedoch die Entwickler mehrere Wochen in Atem hielt. Daneben wurde noch alter Code aus dem iSCSI-Treiber target entfernt.
Nachdem Torvalds sich von seiner ersten (und nach seiner eigenen Ansicht auch letzten) „Night before Oscar party“ [6] erholt hatte, gab er auch noch 2.6.38-rc7 [7] frei. Diese Version fiel wieder etwas kleiner aus. Den Hauptanteil machten Fehlerkorrekturen aus, zum Beispiel die Rücknahme eines Patches, der bei Operationen mit dem TPM (Trusted Platform Module) [8] den Timeout auf den niedrigstmöglichen Wert setzt, wenn er mit 0 angegeben ist. Mit dem Patch sollten Fehler verhindert werden, die zu langen Startzeiten führen können. Der Kernel-Entwickler Ted T'so stieß damit jedoch auf Probleme, als die Operationen des TPM zu schnell auf einen Timeout liefen.
Daneben gab es noch Optimierungen an dem Treiber für Atheros WLAN-Chips ath5k, die ein schnelleres Umschalten der Kanäle ermöglichen.
Unterstützung für Notebooks von Samsung
Greg Kroah-Hartman kündigte auf der Linux Kernel Mailing List die Verfügbarkeit neuer Treiber an, die künftig die Spezialfunktionen aller bekannten Samsung-Notebooks unterstützen [9]. Insbesondere soll damit die Display-Hintergrundbeleuchtung regelbar sein, Tasten für die Steuerung der Leistungsstufen und für Sonderfunktionen nun auch funktionieren und Probleme mit dem Ein-/Ausschaltknopf für die WLAN-Schnittstelle der Vergangenheit angehören. Der Treiber befindet sich derzeit im Kernel-Zweig linux-next und wird voraussichtlich in 2.6.39 aufgenommen werden.
Ralink-Treiber
Kroah-Hartman war im Februar äußerst umtriebig. Nach einem Besuch bei Ralink in Taiwan kam in die Weiterentwicklung der Treiber für deren WLAN-Chips neuer Schwung [10]. Derzeit profitiert davon der rt2x00-Treiber, der um Unterstützung für aktuellere Chips erweitert wird.
Die Ralink-Entwickler werden künftig direkt die Treiber im Kernel pflegen. Bislang oblag dies der Community, Ralink stellte dieser lediglich den Code zur Verfügung. Kroah-Hartman hatte bei seinem Besuch mit den Entwicklern darüber gesprochen, wie eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Kernel-Entwicklern aussehen sollte.
Kurz erläutert: „Commit, Patch“
Änderungen am Quelltext einer Software werden meist als Patch bereitgestellt. Ein Patch enthält die Information, an welcher Stelle im ursprünglichen Quelltext Änderungen vorgenommen werden, sodass nicht die Verteilung des gesamten Quelltextes nach einer Änderung notwendig ist. Versionsverwaltungssysteme nutzen im allgemeinen Patches um Änderungen aufzunehmen und zu verteilen, dadurch kann die Menge der übertragenen Daten zwischen dem zentralen Repository und den lokalen Kopien der Entwickler verringert werden.
Commits beschreiben im Versionsverwaltungssystem Git Änderungen, die gegen einen Zweig (Branch) vorgenommen werden. Dieser enthält Informationen über den Urheber der Änderung, den Einreicher und eine kurze Beschreibung. Dazu kann ein Commit zum einen Patch beinhalten, aber es kann damit auch ein anderer Zweiges mit allen darin enthaltenen Commits wieder dem Hauptentwicklungszweig zugeführt werden, Was auch als Merge bezeichnet wird. Die meisten Commits aus Torvalds Feder zum Beispiel sind Merges, die die Zweige einzelner Entwickler oder ganzer Subsysteme in den offiziellen Kernel zurückführen.
|
Links
[1] http://lkml.org/lkml/2011/2/7/403
[2] http://lkml.org/lkml/2011/2/15/977
[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-12
[4] http://lkml.org/lkml/2011/2/16/100
[5] http://lkml.org/lkml/2011/2/21/433
[6] http://torvalds-family.blogspot.com/2011/02/pearls-before-swine.html
[7] http://lkml.org/lkml/2011/3/1/407
[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
[9] http://www.pro-linux.de/news/1/16690/linux-treiber-fuer-samsung-notebooks.html
[10] http://www.pro-linux.de/news/1/16692/ralink-vervollstaendigt-linux-wlan-treiber.html
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer
wirft gerne einen Blick auf die Kernel-Entwicklung, um mehr über die
Funktion von Linux zu erfahren und um seine Mitmenschen mit seltsamen
Begriffen und unverständlichen Abkürzungen verwirren zu können.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Daniel Nögel Im fünften Teil dieser Reihe (siehe freiesMagazin
02/2011 [1])
wurde die Fehlerbehandlung in Python besprochen. Darüber hinaus
wurde der Grundstein für eine kleine Musikverwaltung gelegt. Bisher
wurden Funktionen implementiert, die ein gegebenes Verzeichnis
rekursiv nach Musikdateien durchsuchen und dann deren ID-Tags
auslesen. In diesem Teil soll die Musikverwaltung um eine
Datenbank erweitert werden, die bequem durchsucht werden kann.
Die Datenbank
Als Datenbank wird in diesem Fall SQLite eingesetzt [2].
Bei SQLite handelt es sich um ein SQL-Datenbanksystem, das ohne
Server-Software auskommt und daher auch neben der
SQLite-Programmbibliothek selbst keine weitere Software auf dem
Zielrechner erfordert. SQLite unterstützt viele SQL-Sprachbefehle,
ist aber in einigen Bereichen simpler gehalten als beispielsweise
MySQL.
Für die Verwendung in Python muss neben der
SQLite-Programmbibliothek (sqlite3) noch die entsprechende
Python-Schnittstelle installiert werden. Diese findet sich in Ubuntu
beispielsweise im Paket python-sqlite2.
Das im letzten Teil erstellte Python-Skript soll nun um eine
Datenbankanbindung erweitert werden. Wer bei den Ergänzungen den
Überblick verliert, kann das fertige Skript musicdb.py auch direkt
herunterladen und dort die Änderungen nachvollziehen.
Die neuen Importe
Zunächst müssen einige Importe ergänzt werden:
import sqlite3
import subprocess
from optparse import OptionParser
import codecs
from textwrap import dedent
from random import shuffle
Hier werden eine ganze Reihe neuer Module und Funktionen eingeführt.
sqlite3 stellt schlicht die Schnittstelle zum SQLite-Datenbanksystem
bereit [3].
Bei subprocess handelt es sich um ein Modul, mit dem aus Python
heraus andere Prozesse gestartet werden können. Darüber hinaus
können mit dem Modul Signale an diese Prozesse gesendet werden oder
STDOUT bzw. STDERR ausgelesen werden. Auch das Schreiben nach STDIN
ist mit subprocess möglich [4].
In diesem Skript wird es später lediglich benötigt, um das
Medienwiedergabeprogramm Totem zu starten und einige MP3s damit
abzuspielen.
Das Modul optparse hält verschieden Werkzeuge bereit, um die
Optionen und Argumente von Skripten auszuwerten. Auch lassen sich
damit recht einfach Übersichten der möglichen Optionen
erstellen [5].
Neu ist das Modul codecs [6].
Mit dessen Funktion open() kann später bequem eine Datei mit einer
beliebigen Zeichenkodierung geschrieben werden.
Die Funktion dedent aus dem Modul textwrap wird später im Skript
dazu genutzt, eine mehrzeilige, eingerückte Zeichenkette ohne
Einrückungen ausgeben zu
können [7].
Einzig das Modul random sollte aus den vorherigen Teilen dieser
Reihe bereits bekannt sein. Es stellt verschiedene Zufallsfunktionen
zur Verfügung. Die Funktion shuffle durchmischt eine gegebene
Liste schlicht, sodass sich damit beispielsweise eine
Wiedergabeliste durchmischen
ließe [8].
Die Datenbankanbindung
Als nächstes soll nun die Datenbankanbindung des Skripts erstellt
werden. Diese besteht aus zwei Klassen: einer Cursor-Klasse und
einer Datenbank-Klasse. Beide Klassen verfügen aber über eine
Neuerung, die hier kurz erläutert werden soll.
Das Schlüsselwort with
Das Schlüsselwort with ist ein Sprachelement, das es seit Python
2.5 gibt [9]. Es wird
besonders häufig beim Arbeiten mit Dateien eingesetzt, weshalb es
auch an diesem Beispiel erörtert werden soll. Für gewöhnlich wird
beim Umgang mit Dateien ein Konstrukt wie das folgende benötigt:
handler = open("datei.txt", "r")
try:
print handler.read()
finally:
handler.close()
In Zeile 1 wird dabei eine Datei geöffnet und das daraus
resultierende Datei-Objekt an den Namen handler gebunden. In Zeile
3 wird der Inhalt der Datei ausgegeben. Der try...finally-Block
stellt sicher, dass das Datei-Objekt anschließend in jedem Fall
geschlossen wird – auch wenn beim Auslesen der Datei in Zeile 3
eventuell Fehler aufgetreten sind. Die Konstruktion
„Vorbereiten, Bearbeiten, Aufräumen“ ist allerdings auch in
anderen Zusammenhängen so häufig anzutreffen, dass ab Python 2.5 mit
with eine deutliche Vereinfachung für derartige Fälle eingeführt
wurde:
with open("datei.txt", "r") as handler:
print handler.read()
Auch hier wird zunächst die Datei open.txt zum Lesen geöffnet und
das daraus resultierende Datei-Objekt an den Namen handler
gebunden. Allerdings erfolgt die Zuweisung des Namens hier durch das
Schlüsselwort as. In Zeile 2 wird – wie gehabt – der Inhalt der
Datei ausgegeben. Damit sind die beiden Schritte „Vorbereiten“ und
„Bearbeiten“ abgehandelt. Das Aufräumen erfolgt mit dem Verlassen
der Kontrollstruktur, also am Ende des with-Blocks. Es muss nicht
explizit durchgeführt werden. Wie funktioniert das?
Seit Python 2.5 gibt es zwei neue spezielle Methoden, die Objekte
implementieren können: __enter__ und __exit__. Die Methode
__enter__ ist für die Vorbereitung zuständig und wird implizit
beim Betreten des with-Blocks aufgerufen. Der Rückgabewert dieser
Methode wird dann an den mit as angegebenen Namen gebunden –
oben also an den Namen handler. Die Methode __exit__ wird
beim Verlassen des with-Blocks aufgerufen – unabhängig davon, ob ein
Fehler aufgetreten ist oder nicht.
Diese Konstruktion wird im Folgenden auch für die Datenbank
verwendet. Da die SQLite-Schnittstelle für Python von Haus aus noch
keinen Gebrauch von diesem neuen Sprachmittel macht, wird es hier
selbst implementiert.
Der Cursor
SQLite kennt sogenannte Cursor, mit denen Datensätze in
Datenbanken ausgelesen und bearbeitet
werden [10].
In der Regel folgt auch das Arbeiten mit Cursorn dem Schema
„Vorbereiten, Bearbeiten, Aufräumen“, weshalb sich hier die
Verwendung der with-Anweisung empfiehlt.
Das bisherige Skript aus dem letzten Teil wird nun um diese
Klasse ergänzt:
class Cursor(object):
def __init__(self, connection):
self.connection = connection
def __enter__(self):
self.cursor = self.connection.cursor()
return self.cursor
def __exit__(self, type, value, traceback):
self.cursor.close()
Es handelt sich hierbei letztlich nur um einen sogenannten
„Wrapper“, der die Verwendung von SQLite-Cursorn mit with
ermöglicht. Später könnte ein Aufruf wie folgt aussehen:
with Cursor(connection) as cursor:
cursor.machetwas()
connection ist dabei eine Referenz auf ein
SQLite-Connection-Objekt, das eine offene Datenbankverbindung
verwaltet. In Zeile 1 wird nun zunächst eine Instanz der
Cursor-Klasse erstellt und connection als Parameter übergeben. In
der Methode __init__ wird die Referenz auf das Connection-Objekt
an das Attribut self.connection gebunden. Erst danach wird durch
den with-Block die Methode __enter__ des Cursor-Objektes
aufgerufen. Hier wird nun das SQLite-Cursor-Objekt durch den Aufruf
self.connection.cursor() erstellt. Das Objekt wird an das Attribut
self.cursor gebunden und mittels des Schlüsselwortes return
zurückgegeben. Da der Rückgabewert der Methode __enter__ in
with-Blöcken an den hinter as angegebenen Namen gebunden wird,
steht nun eine Referenz auf das SQLite-Cursor-Objekt unter
dem Namen cursor zur Verfügung. In Zeile 2 des Beispiels kann so
bequem auf das SQLite-Cursor-Objekt zugegriffen werden. Mit dem
Verlassen des with-Blocks würde schließlich die Methode __exit__
aufgerufen werden, in der das Cursor-Objekt korrekt geschlossen wird.
Noch einmal zur Erinnerung: Die Cursor-Klasse fungiert hier
lediglich als Wrapper.
Ohne sie sähe jeder Zugriff auf SQLite-Cursor wie folgt aus:
cursor = connection.cursor()
try:
cursor.machetwas()
finally:
cursor.close()
Die Datenbankklasse
Als nächstes soll nun die eigentliche Datenbankanbindung realisiert
werden:
class DatabaseConnector(object):
def __enter__(self):
path = os.path.dirname(os.path.abspath((__file__)))
self.db_path = os.path.join(path, "music.db")
if not os.path.exists(self.db_path):
self.create_database()
self.connection = sqlite3.connect(self.db_path)
self.connection.row_factory = sqlite3.Row
return self
def __exit__(self, type, value, traceback):
self.connection.close()
def create_database(self):
sql = u"""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mp3s (
id INTEGER PRIMARY KEY,
artist STRING,
title STRING,
album STRING,
length INT,
path STRING UNIQUE
)"""
connection = sqlite3.connect(self.db_path)
with Cursor(connection) as cursor:
cursor.execute(sql)
connection.close()
def search(self, search):
search = u" search = search.replace(" ", " print search
sql = u"""
select *
from mp3s
where artist like ? or
album like ? or
title like ?
"""
with Cursor(self.connection) as cursor:
return cursor.execute(sql, (search, )*3).fetchall()
def get_all_songs(self):
with Cursor(self.connection) as cursor:
return cursor.execute("SELECT * FROM mp3s").fetchall()
def insert_songs(self, songs):
print "Inserting MP3s"
sql = u"""INSERT OR IGNORE INTO mp3s (
artist,
title,
album,
length,
path
) VALUES (
:artist,
:title,
:album,
:length,
:path
)
"""
with Cursor(self.connection) as cursor:
cursor.executemany(sql, songs)
self.connection.commit()
def count(self):
sql = "select count(id) from mp3s"
with Cursor(self.connection) as cursor:
return cursor.execute(sql).fetchone()[0]
Listing: musicdb-databaseconnector.py
Auch die Klasse DatabaseConnector kennt die Methode __enter__ und __exit__ und
ist damit auf die Verwendung mit with ausgelegt. In der Methode
__enter__ werden dabei alle relevanten Vorbereitungen für die
Erstellung der Datenbankverbindung getroffen. Zunächst wird der
Ordner des Skriptes per
os.path.dirname(os.path.abspath((__file__)))
ermittelt und an den Namen path
gebunden [11].
In dem selben Ordner soll nun auch die Datenbank music.db abgelegt
werden. Existiert diese Datenbank noch nicht, wird sie mit der
Methode create_database() erstellt. Anschließend wird durch den
Aufruf
self.connection = sqlite3.connect(self.db_path)
eine Verbindung zu dieser Datenbank erstellt und das
Connection-Objekt an das Attribut self.connection gebunden. Mit
der Zeile
self.connection.row_factory = sqlite3.Row
wird SQLite angewiesen, die Ergebnisse in Form von
Row-Objekten [12]
darzustellen. Dadurch lassen sich die Ergebnisse von
Datenbankabfragen später sehr leicht über Schlüsselworte ansprechen.
Neben der Methode __enter__, die die Datenbankverbindung schlicht
wieder schließt, kennt die Klasse DatabaseConnector weiterhin noch
die Methoden search, get_all_songs, insert_songs und count.
Hier werden jeweils verschiedene Datenbankzugriffe getätigt; es
kommt jeweils die oben vorgestellte Cursor-Klasse zum Einsatz. Die
Bedeutung der einzelnen SQL-Abfragen sollte weitestgehend bekannt
oder aus dem Kontext ersichtlich sein. Im Rahmen dieser Einführung
ist eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der SQL-Syntax leider
nicht möglich. Eine Übersicht der SQL-Befehle findet sich allerdings
auf der Homepage des SQLite-Projektes [13].
Dennoch sollen einige Anmerkungen zu kleinen Besonderheiten gemacht
werden.
In der Methode search werden dem Suchbegriff Prozentzeichen voran-
und nachgestellt, außerdem werden Leerzeichen durch Prozentzeichen
ersetzt. Hierbei handelt es sich lediglich um die SQL-typischen
Wildcard-Zeichen. Am Ende der Methode insert_songs findet sich
außerdem dieser Aufruf:
cursor.executemany(sql, songs)
Damit wird eine Liste von mehreren Liedern in die Datenbank
eingetragen. songs ist in diesem Fall eine Liste von Tupeln nach
folgendem Schema:
[
("Kuenstler", "Titel", "Album", "Laenge", "Pfad"),
("Kuenstler", "Titel", "Album", "Laenge", "Pfad"),
...
]
So können sehr effizient große Mengen von Titelinformationen in die
Datenbank übernommen werden. Durch das anschließende
connection.commit()
werden die Änderungen übernommen. Dieser Aufruf muss immer dann
erfolgen, wenn schreibend auf die Datenbank zugegriffen wurde.
Ansonsten wären die Änderungen bei der nächsten Abfrage noch nicht
sichtbar.
Wiedergabelisten erstellen
Die Musikverwaltung soll in der Lage sein, Lieder, die auf eine
Suche passen, in eine Wiedergabeliste zu speichern. Dazu wird das
Skript um folgende drei Funktionen erweitert:
def generate_extended_playlist(songs):
playlist = [u"#EXTM3U\n"]
for id, artist, title, album, length, path in songs:
playlist.append("#EXTINF:{0},{1} - {2}\n".format(int(length), artist,
title))
playlist.append("{0}\n".format(path))
return u"".join(playlist)
def generate_simple_playlist(songs):
return u"\n".join(hit["path"] for hit in songs)
def dump(playlist, path, encoding="utf-8"):
with codecs.open(path, "w", encoding=encoding) as fh:
fh.write(playlist)
Die ersten beiden Funktionen erwarten jeweils eine Liste songs.
Diese Songs sind im Fall dieses Skripts eigentlich Row-Objekte, wie
sie von der Methode search des DatabaseConnectors zurückgegeben
werden. Diese Row-Objekte verhalten sich dahingehend wie Listen und
Dicts, als dass sie den Zugriff über Schlüsselworte ebenso
ermöglichen, wie über Listen-Indizes.
Die Funktion generate_simple_playlist erstellt nun schlicht eine
Zeichenkette mit Pfadangaben, getrennt durch einen Zeilenumbruch (\n).
Die Zeile mutet zunächst recht kompliziert an:
return u"\n".join(hit["path"] for hit in songs)
Dies ist aber nur eine kompaktere
und effizientere Variante für folgenden Code (siehe Abschnitt
„Kleine Aufgabe“ unten):
paths = []
for hit in songs:
paths.append(hit["song"])
return u"\n".join(paths)
Die so erstellte Zeichenkette mit Pfandangaben kann als einfache
m3u-Liste gespeichert werden. Sollen außerdem noch
Meta-Informationen in der Wiedergabeliste gespeichert werden, muss
eine erweiterte m3u-Liste erstellt werden. Dies geschieht durch die
Funktion generate_extended_playlist. Auch hier wird eine
Zeichenkette erstellt, die später als Wiedergabeliste gespeichert
werden kann. Allerdings wird dabei zunächst der Umweg über eine
Liste gegangen: Jeder Eintrag in der Liste repräsentiert später eine
Zeile. Mit
playlist = [u"#EXTM3U\n"]
wird die Liste playlist direkt initial befüllt, sodass die spätere
Wiedergabeliste in der ersten Zeile die Information enthält, dass es
sich um eine erweiterte Wiedergabeliste handelt. In der folgenden
for-Schleife werden die einzelnen Lieder durchlaufen. Für jedes
Lied wird dabei ein Listen-Eintrag mit Meta-Informationen
(#EXTINF) und ein Listeneintrag mit der dazugehörigen Pfadangabe
erstellt. Erst in der letzten Zeile der Funktion wird aus der Liste
playlist mit Hilfe der Methode join eine Zeichenkette, die
direkt zurückgegeben wird.
Die dritte Funktion dump schreibt schließlich eine gegebene
Zeichenkette (in diesem Fall die Wiedergabelisten) in eine Datei.
Statt der Funktion open kommt dabei allerdings die gleichnamige
Funktion aus dem Modul codecs zum Einsatz. Diese Funktion hat den
Vorteil, dass die gewünschte Ziel-Kodierung direkt wählbar ist (hier
UTF-8).
Startbedingungen
In einem letzten Schritt wird nun der Block
if __name__ == "__main__":
...
komplett ersetzt:
if __name__ == "__main__":
parser = OptionParser()
parser.add_option("-s", "--scan", dest="add", help="add_directory",
metavar="DIR")
parser.add_option("-f", "--find", dest="search",
help="Search database for tags", metavar="TERM")
parser.add_option("--shuffle", dest="shuffle", metavar="INT", type="int",
help="Takes randomly INT various songs from database")
parser.add_option("-p", "--playlist", dest="playlist", metavar="FILE",
help="Write the search results to a playlist (requires -s)")
parser.add_option("-t", "--totem", dest="totem", action="store_true",
help="Play the search result (requires -s)")
parser.epilog = dedent("""
'musikverwaltung' is a simple commandline music database. You are
only able to add directories and search for tags.
""")
options, args = parser.parse_args()
if not (options.search or options.shuffle) and \
(options.playlist or options.totem):
parser.error(dedent("""
Writing / Playing playlists is only possible after a search.
Use -f / --find plus searchterm"""))
with DatabaseConnector() as database:
if options.add:
songs = read_recursively(options.add)
database.insert_songs(songs)
print
print "Number of MP3s in your database: {0}".format(
database.count())
elif options.search or options.shuffle:
if options.search:
searchterm = options.search.decode("utf-8")
print
songs = database.search(searchterm)
else:
songs = database.get_all_songs()
shuffle(songs)
songs = songs[:options.shuffle]
if songs:
print generate_simple_playlist(songs)
if options.playlist:
if not options.playlist.lower().endswith(".m3u"):
options.playlist += ".m3u"
dump(generate_extended_playlist(songs), options.playlist)
if options.totem:
command = ["totem", "--enqueue"]
for song in songs:
command.append(song["path"])
subprocess.Popen(command)
else:
print u"No results found for '{0}'".format(searchterm)
else:
parser.print_help()
Listing: musicdb-main.py
Darin wird zunächst eine Instanz des OptionParser erzeugt und an den
Namen parser gebunden. In den folgenden Zeilen werden die
verschiedenen Optionen definiert, die das Skript später kennt. Die
Methode add_option fügt jeweils eine weitere Option hinzu und
definiert die dazugehörigen Schalter (beispielsweise -s oder
--scan), das Schlüsselwort, über das die Option später ausgelesen
wird (dest) und einen kurzen Hilfetext (help). Es gibt eine
Reihe weiterer Möglichkeiten, die einzelnen Optionen genauer zu
spezifizieren (etwa metavar oder type, vgl.
Dokumentation [14]).
In der Zeile
options, args = parser.parse_args()
dieses Codeblocks wird der OptionParser mit
parse_args() angewiesen, die Parameter, mit denen das Skript
gestartet wurde, auszuwerten. Im Ergebnis werden die Optionen an den
Namen options gebunden, die Argumente an den Namen args.
Ab der Zeile
if not (options.search or options.shuffle) ...
beginnt die Auswertung der Parameter. Durch diese und die danach folgenden drei
Zeilen wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Nutzer die
Schalter -t oder -p übergeben hat, ohne mit --shuffle oder
--find eine Auswahl von Musikstücken zu treffen. parser.error()
gibt die übergebene Zeichenkette aus und beendet das Skript.
In der Zeile
with DatabaseConnector() as database:
kommt die oben implementierte Klasse DatabaseConnector
zum Einsatz; sie wird im with-Block an den Namen database
gebunden. In der nächsten Zeile wird geprüft, ob mit den Schaltern
-s oder --scan ein Verzeichnis übergeben wurde. Ist dies der
Fall, enthält options.add eine Pfadangabe als Zeichenkette und der
Ausdruck options.add ist wahr. In diesem Fall wird das angegebene
Verzeichnis mit der im letzten Teil umgesetzten Funktion
read_recursively() ausgelesen. Die so gefundenen
Titelinformationen werden mit der Methode insert_song() in die
Datenbank geschrieben. Anschließend wird noch die Gesamtzahl der
Titel in der Datenbank auf der Konsole ausgegeben.
Ab der Zeile
elif options.search or options.shuffle:
werden die Optionen --shuffle und -f bzw. --find
behandelt. Im Fall einer Suche wird die Zeichenkette zunächst
dekodiert und an den Namen searchterm gebunden. Die so
erstellte Unicode-Zeichenkette kann dann an die Suchfunktion der
Datenbank übergeben werden. Das Ergebnis wird an den Namen songs
gebunden. Im Alternativfall ohne Suche wird eine Zufallsfunktion umgesetzt.
Dazu werden zunächst mit get_all_songs() alle Lieder aus der
Datenbank ausgelesen und zufällig angeordnet. Durch
songs = songs[:options.shuffle]
wird dann ein Ausschnitt dieser Gesamtliste an den Namen songs
gebunden. Die Größe des Ausschnitts hat der Benutzer zusammen mit
der Option --shuffle übergeben.
Dieses Vorgehen ist natürlich nicht besonders effizient: Wer 40.000
Lieder in seiner Datenbank hat, möchte sicher nicht, dass alle diese
Lieder zunächst ausgelesen werden, nur um 100 zufällige Lieder davon
auszuwählen. Sehr viel eleganter wäre hier eine Lösung via SQL:
SELECT * FROM mp3s ORDER BY RANDOM() LIMIT 20
Damit werden direkt 20 zufällige Lieder aus der Datenbank
ausgelesen. Die im Skript umgesetzte Variante sollte in der Praxis
also eher nicht eingesetzt werden. Sie besticht aber in diesem Fall
dadurch, dass sie durch die Verwendung des random-Modules und die
Nutzung von Slices Techniken einsetzt, die in den
vorherigen Teilen bereits diskutiert wurden.
In den beiden if-Blöcken von options.search wurden die
ausgewählten Lieder jeweils an den Namen songs gebunden. Für das
weitere Vorgehen ist es nicht von Bedeutung, wie die Auswahl der
Lieder zustande kam. Mit if songs: wird lediglich geprüft, ob
überhaupt Lieder ausgewählt wurden (eine leere Liste wird als
falsch ausgewertet). Nachfolgend wird eine Wiedergabeliste
erstellt und gespeichert, falls die entsprechend Option options.playlist gesetzt
wurde. Dabei wird der vom Nutzer angegebene Dateiname um .m3u
erweitert, falls er nicht darauf endet. Am Ende kommt das subprocess-Modul zum Einsatz, wenn die Option -t bzw.
--totem gesetzt wurde. Die Funktion Popen, die Totem ausführen
soll, erwartet die Parameter in Form einer Liste. Diese wird
initial mit totem und --enqueue befüllt und danach um
die Pfadangaben der ausgewählten Musikstücke erweitert. So entsteht
eine Liste nach dem Schema:
["totem", "--enqueue", "song1.mp3", "song2.mp3"]
Die entsprechende Befehlszeile in der Shell sähe wie folgt aus:
$ totem --enqueue song1.mp3 song2.mp3
Totem wird also mit der Option --enqueue gestartet, die alle
folgenden Musikstücke an die Wiedergabeliste anhängt.
Schließlich deckt dieser Codeblock noch zwei weitere Eventualitäten
ab: Der vorletzte else-Block ist von Bedeutung, wenn die Liste songs leer ist,
also beispielsweise die Suche keine Treffer ergab. Das letzte else gibt einen Nutzungshinweis auf der Konsole aus, wenn
weder die Optionen add, search noch shuffle gesetzt wurden.
Kleine Aufgabe
Mehrfach wurden kleine Fragestellungen oder Aufgaben erbeten, die
die Leser bis zum Erscheinen des nächsten Teils zu lösen hätten. Im
Abschnitt „Startbedingungen“ oben wird auf eine mögliche Alternative
zur derzeitigen Shuffle-Funktion hingewiesen. Interessierte Leser
könnten versuchen, die dort vorgeschlagenen Änderungen zu
implementieren, indem sie die Klasse DatabaseConnector um eine
shuffle()-Methode erweitern und das Skript so anpassen, dass diese
Methode statt der jetzigen Variante zur Auswahl der Zufallstitel
eingesetzt wird.
Wer sich darüber hinaus noch vertiefend mit dem Skript beschäftigen
möchte, kann sich die Funktion generate_simple_playlist einmal
näher ansehen. Der Einzeiler im Funktionsrumpf hat es bei näherer
Betrachtung in sich, dort kommt ein sogenannter „Generator-Ausdruck“
zum Einsatz [15].
Schlusswort
Mit diesem sechsten Teil hat die einführende Vorstellung von Python
eine kleine Zäsur erreicht. In Form der Musikdatenbank wurde mit
Hilfe der vorgestellten Technologien und Werkzeuge erstmals ein
(etwas) größeres Projekt in Angriff genommen, das zum
Experimentieren und Erweitern einlädt.
Die Python-Reihe soll auch weiterhin fortgesetzt werden, allerdings
wird sich der Abstand der einzelnen Teile etwas vergrößern und
ab sofort voraussichtlich zweimonatlich erscheinen.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-02
[2] http://www.sqlite.org/
[3] http://docs.python.org/library/sqlite3.html
[4] http://docs.python.org/library/subprocess.html
[5] http://docs.python.org/library/optparse.html
[6] http://docs.python.org/library/codecs.html
[7] http://docs.python.org/library/textwrap.html#textwrap.dedent
[8] http://docs.python.org/library/random.html#random.shuffle
[9] http://effbot.org/zone/python-with-statement.htm
[10] http://docs.python.org/library/sqlite3.html#sqlite3.Cursor
[11] http://docs.python.org/library/os.path.html#module-os.path
[12] http://docs.python.org/library/sqlite3.html#sqlite3.Row
[13] http://www.sqlite.org/lang.html
[14] http://docs.python.org/library/optparse.html
[15] http://www.python.org/dev/peps/pep-0289/
| Autoreninformation |
| Daniel Nögel (Webseite)
beschäftigt sich seit drei Jahren mit Python. Ihn überzeugt
besonders die intuitive Syntax und die Vielzahl der unterstützten
Bibliotheken, die Python auf dem Linux-Desktop zu einem wahren
Multitalent machen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Mit GIMP sind sehr viele schöne Spielereien möglich, einige davon lassen sich
sogar sinnvoll einsetzen. Das folgende Tutorial soll zeigen, wie man einzelne Elemente
auf Farbfotos hervorheben kann, indem man alles drumherum in Graustufen konvertiert
(„Colorkey“ genannt). Den einen richtigen Weg gibt es dabei aber nicht; viele Ansätze
führen zum Ziel.
Als Vorlage für das Tutorial dient das Halbportät „Green“ von Shelby H. [1],
welches unter Creative-Commons-Lizenz CC-BY-
SA-2.0 [2] auf Flickr
veröffentlicht wurde.
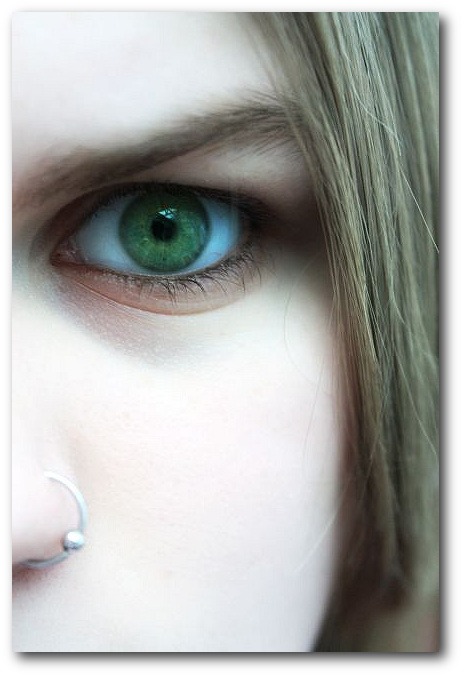
Das Grün der Iris soll am Ende hervorgehoben sein.
Graustufenbild erzeugen
Bevor man anfängt, irgendetwas am Bild zu ändern, legt man sich von der Originalebene
eine Kopie an, indem man im Ebenendialog mit der rechten Maustaste auf die Ebene
„Hintergrund“ klickt und dort „Ebene duplizieren“ auswählt. Das geht natürlich auch im
Menü unter „Ebene -> Ebene duplizieren“ oder per Tastenkürzel
„Umschalt“ + „Strg“ + „D“. Die neue Ebene „Hintergrund-Kopie“ wird automatisch
ausgewählt, mit dieser arbeitet man nun. Falls etwas schief geht, hat man so sofort das
Original wieder parat.
Graustufen über Bildmodus
Graustufenbilder kann man auf sehr viele Arten in GIMP erzeugen. Der einfachste Weg ist
wohl die Wahl über
„Bild -> Modus -> Graustufen“. Dabei wird aber das ganze Bild in Graustufen
gewandelt, also auch die Originalebene.
Graustufen über Sättigung
Über „Farben -> Entsättigen“ ist der zweite
Weg.
Im folgenden Dialog kann man den Grauwert nach „Helligkeit“, „Leuchtkraft“ oder
„Durchschnitt“ bestimmen lassen. Je nach Auswahl ist das Resultat verschieden
hell-/dunkellastig. Die Unterschiede sind im Dr. Web Magazin gut
dargestellt [3].
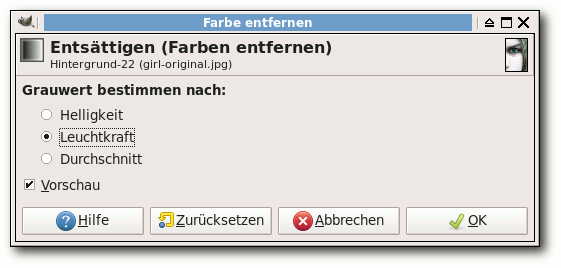
Über „Farben -> Entsättigen“ kann man leicht ein Graustufenbild erzeugen.
Ein dritter Weg führt über den Dialog „Farben -> Farbton/Sättigung“. Dort muss
man einfach nur den Regler bei „Sättigung“ auf „-100“ stellen. Ein vierter ist ähnlich über
„Farben -> Einfärben“, in dessen Dialog man ebenfalls nur den Regler bei
„Sättigung“ auf „-100“ stellen muss.
Graustufen über RGB-Farbtrennung
Mit dem fünften (und letzten) Weg hat man die meiste Kontrolle über das Ergebnis. Man
wählt „Farben -> Komponenten -> Zerlegen“. In dem Dialog wählt man als
Farbmodus „RGB“ aus und setzt einen Haken vor „In Ebenen zerlegen“. Mit einem Klick
auf „OK“ öffnet sich ein neues Bild mit den drei Ebenen für die Kanäle Rot, Grün und Blau.
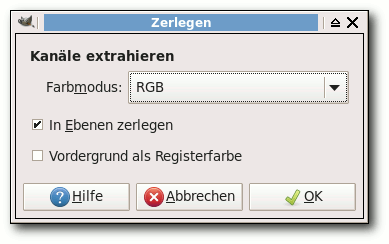
Dialog zum Zerlegen des Bildes in die einzelnen RGB-Kanäle.
Nun hat man die Wahl, wie man diese Kanäle kombiniert oder ob man nur einen Kanal
nimmt. Die Ebenen ordnet man für das Beispiel hier per Drag & Drop so an, dass „Blau“
ganz oben steht, darunter „Grün“ und
ganz unten „Rot“. Im Ebenendialog klickt man dann auf „Grün“, um die grüne
Ebene auszuwählen. Als „Deckkraft“ am Regler darüber stellt man „50,0“ ein. Danach
wählt man die oberste, blaue Ebene und stellt als „Deckkraft“ den Wert „20,0“ ein.
Die Werte kann man natürlich nach Belieben verändern oder Ebenen auch komplett
ausblenden.
Ob man sich wirklich die Mühe machen will, ein Bild auf diese Art in Graustufen
zu wandeln, kann jeder durch Experimentieren selbst herausfinden. Den meisten
wird vielleicht die automatische Entsättigung auf den oberen Wegen ausreichen.

Der erste Schritt ist getan: Alles ist grau.
Farbe hervorheben
Je nach Art der Graustufenwahl hängt es davon ab, wie man die grüne Augenfarbe
nun am Einfachsten hervorhebt.
Hervorheben bei Entsättigung
Bei den Methoden zwei bis vier von oben (Graustufen über Entsättigung)
markiert man erst den Bereich, der farbig bleiben soll und entfernt dann
im Rest die Farbe. Für die Markierung gibt es wieder verschiedene Wege.
Da die Iris rund ist, kann man natürlich ganz simpel über die Kreisauswahl
(„E“) einen Kreis um die Iris ziehen. Bei unregelmäßigen Objekten
hilft aber eher die Freihandauswahl („F“). Über diese kann man
man das Objekt nachzeichnen. Damit man einen feineren Übergang beim
Ausschneiden erhält, lohnt es sich, nach der Markierung über „Auswahl -> Vergrößern“
die Auswahl um einige wenige Pixel zu vergrößern, um diesen Bereich
dann per „Auswahl -> Ausblenden“ wieder zu „verkleinern“. Als
Resultat schneidet man das Ergebnis nicht einfach hart an den Kanten
ab, sondern hat einen leichten Übergang zwischen Grau und Grün.
Eine weitere und etwas feinere Auswahl erhält man über die Schnellauswahlmaske.
Diese aktiviert man über „Auswahl -> Schnellmaske umschalten“
bzw. „Umschalt“ + „Q“. Es legt sich dann ein leicht transparenter
Rotstich über das Bild. Nun wählt man einen Pinsel als Malwerkzeug aus
(„P“) und malt auf diesem roten Film das aus, was man später behalten
will. Durch das Malen „löscht“ man sozusagen die rote Farbe. Hat man zu viel
bemalt, kann man durch den Radierer wieder das Rot hinzufügen. Mittels
„Umschalt“ + „Q“ schaltet man zurück zur normalen Auswahlansicht. Wie im
Abschnitt zuvor kann man die Maske noch vergrößern und dann die Ränder etwas
ausblenden, um einen weicheren Übergang zu erhalten.

Auf der Schnellmaske kann man per Malwerkzeug auswählen.
Wenn man dies erledigt hat, invertiert man die Auswahl über „Auswahl -> Invertieren“ bzw.
„Strg“ + „I“. Danach wählt man je nach Wunsch
einer der obigen
Methoden 2 bis 4, um den ausgewählten Bereich zu entsättigen, d. h. in
Graustufen zu wandeln. Die anderen beiden Wege können so nicht angewandt
werden.
Weitere Arten des Freistellens von Objekten (so nennt man diese Technik)
findet man im Gimp-Forum-Wiki [4].
Sehr oft wird auch mit Ebenenmasken gearbeitet, auf denen man malt.
Hervorheben bei RGB-Farbtrennung
Nachdem man die einzelnen RGB-Ebenen wie oben arrangiert hat, wandelt man das
Bild erst einmal wieder in RGB-Farben über „Bild -> Modus -> RGB“. Danach
wechselt man zum Originalbild und kopiert dieses über „Bearbeiten -> Kopieren“
bzw. „Strg“ + „C“ in die Zwischenablage. Diese Kopie fügt man im derzeitigen
Graustufenbild per „Bearbeiten -> Einfügen als … -> Neue Ebene“ als neue Ebene
ein. Sollte die neue Ebene „Zwischenablage“ im Ebenendialog nicht ganz oben stehen,
schiebt man diese per Drag & Drop ganz nach oben, sodass das Graustufenbild wieder
farbig ist und identisch zum Original aussieht.

Die drei RGB-Kanäle als Graustufen und das Originalbild aus der Zwischenablage.
Im nächsten Schritt muss man nun nur noch alles außer dem Auge entfernen. Man kann
dazu den Bereich wie im Abschnitt „Hervorheben bei Entsättigung“ beschrieben
auswählen, invertiert dann die Maske über
„Auswahl -> Invertieren“ bzw.
„Strg“ + „I“ und löscht mittels „Bearbeiten -> Löschen“ bzw. „Entf“
einfach alles außer dem Auge.
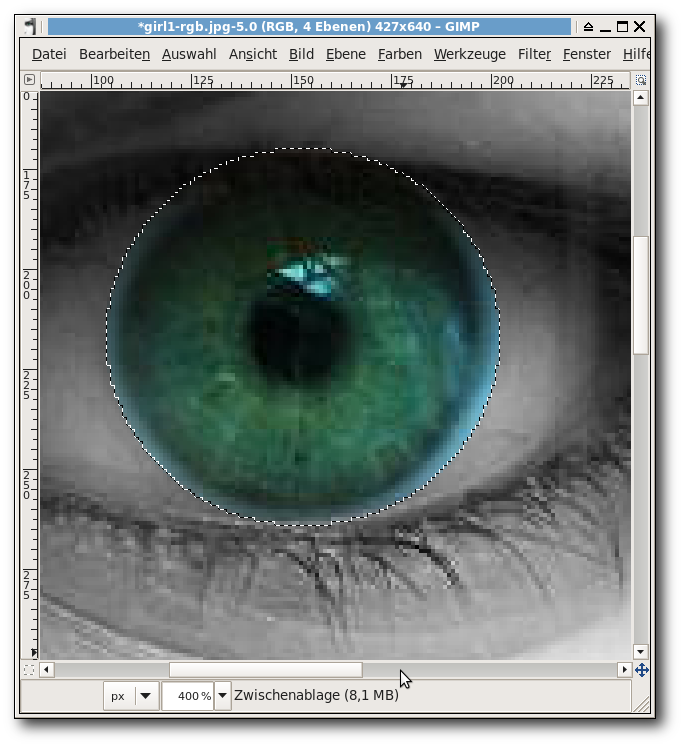
Das Auge wurde grob ausgewählt und alles drumherum gelöscht.
Wer Probleme mit dem Ausschneiden hat, kann auch den umgekehrten Weg gehen. Über
die rechteckige („R“) oder runde Auswahl („E“) markiert man zuerst die Iris
grob, invertiert die Maske und löscht alles außerhalb. Danach wählt man das
Radierwerkzeug aus („Umschalt“ + „E“). „Harte Kanten“ dürfen dabei nicht aktiviert
sein. Nun umrundet man die Iris mit dem Radierer, aber noch nicht exakt an dem Bereich,
den man erhalten will. Es bleibt dann ein türkiser Rand stehen. Damit die
Übergänge etwas weicher sind, stellt man „Deckkraft“ des Radierers auf „50,0“ und zieht
dann mit dem „Rand“ des Radierers über den türkisen Bereich. Auf die Art verschwindet
das Türkis unmerklich und vermischt sich besser mit dem Grau dahinter. Der Übergang
wirkt so wesentlich weicher. Natürlich kann
man auch einen kleineren Radierer nehmen
bzw. das Werkzeug skalieren und so das überschüssige Türkis entfernen.
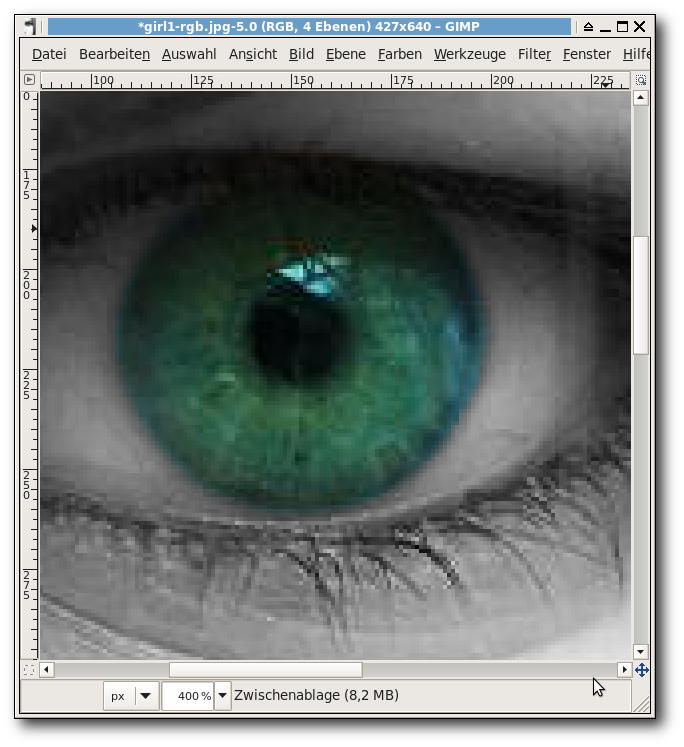
Nach der Bearbeitung sollte man keine scharfen Kanten zwischen Farbe und Grau sehen.
Im Endergebnis wurde zusätzlich noch das Weiß der Augen aus dem blauen RGB-
Kanal kopiert und sowohl Kontrast als auch Helligkeit ein wenig erhöht, um die
Augenfarbe noch mehr hervorzuheben.

Jetzt stechen die grünen Augen wirklich hervor.
Hervorheben bei Graustufen
Für die korrekte Arbeit mit den Graustufen sollte man wie folgt vorgehen: Man öffnet das
Originalbild, kopiert dieses über „Bearbeiten -> Kopieren“ bzw. „Strg“ + „C“
in die Zwischenablage und wählt dann „Bearbeiten -> Einfügen als … -> Neues Bild“
bzw. „Umschalt“ + „Strg“ + „V“. Diese Kopie wandelt man in Graustufen wie oben beschrieben.
Der weitere Verlauf ist identisch zu „Hervorheben bei RGB-Farbtrennung“, d. h. das Bild wird wieder in RGB gewandelt, das farbige Original als neue Ebene darübergelegt und so weiter.
Kontrast erhöhen
Um den Effekt des farbigen Ausschnitts noch mehr hervorzuheben, lohnt es sich bei
manchen Bildern mit den Kontrast- und Helligkeitswerten zu experimentieren. Da der
Effekt aber nur auf eine Ebene angewandt werden kann, erstellt man am besten aus dem
bisherigen Ergebnis eine neue Ebene über „Ebene -> Neu aus Sichtbarem“. Mit
dieser kann man weiterarbeiten.
Den Kontrastdialog findet man unter „Farben -> Helligkeit/Kontrast“. Dort kann
man den Kontrast etwas erhöhen (z. B. auf „10“), die Helligkeit im Gegensatz dazu etwas
erniedrigen.
Im Beispielbild „Green“ ergibt sich dadurch aber keine echte Verbesserung. Zur
Verdeutlichung des Effekts wurde aber ein zweites Bild auf die gleiche Art und Weise wie
oben beschrieben verändert. Das Bild „Nostalgia“ von Joel Montes de Oca [5]
steht auch unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA-2.0 [2].

Das zweite Beispiel im Original, …

… nach der Überarbeitung …
Ein zweiter Weg, den Farbeffekt
durch eine Kontrasterhöhung hervorzuheben, besteht darin, dass man die oberste, per „Ebene -> Neu aus Sichtbarem“
erstellte, Ebene einfach per „Umschalt“ + „Strg“ + „D“ dupliziert und als Modus dann
„Überlagern“ auswählt.

… und nach dem Überlagern bzw. Kontrasterhöhung.
Farbe ändern
Als letztes Gimmick soll die Augenfarbe des Mädchens noch geändert werden, falls
jemand
beispielsweise blaue Augen bevorzugt. Hierzu gibt es auch wieder mehrere
Möglichkeiten der Realisierung. Die Einfachste (die hier vorgestellt werden soll) ist, dass
man nur den Farbton für das Auge ändert. Dafür benötigt man aber entweder die
identische Auswahl der Iris wie zuvor oder eine eigene Ebene, auf der nur das Auge zu
sehen ist, die man durch Linksklick im Ebenendialog auswählt.
In beiden Fällen wählt man danach „Farben -> Einfärben“. Im folgenden Dialog
wählt man für „Farbton“ den Wert „222“, „Sättigung“ stellt man auf „35“ und die
„Helligkeit“ auf „2“. Natürlich kann man die Werte verändern, wie man möchte, obige
Einstellungen sorgen für eine schöne blaue Farbe. Danach kann man noch im
Helligkeit/Kontrast-Dialog den „Kontrast“ auf „30“ und die „Helligkeit“ auf „25“ erhöhen.

Auch mit blauen Augen wirkt das Bild sehr gut.
Hinweis: Für eine bessere Darstellung wurde die Pupille zuvor ausgeschnitten, um von der Farbtonänderung nicht betroffen zu sein.
Weitere Tutorials dieser Art
Im Internet gibt es zahlreiche Tutorials, die sich mit dem Entfernen von Farbe
beschäftigen, um einzelne Bildelemente hervorzuheben. Eine gute Anleitung gibt es bei
GimpUsers.de [6], im Dr. Web
Magazin [7] oder im Wiki des deutschen
GIMP-Forums [8].
Aber auch der umgekehrte Weg ist möglich, das heißt ein reines Schwarz-Weiß-Bild zu
kolorieren und Elemente darauf hervorzuheben. Ein gutes Tutorial gibt es bei
GimpUsers.de [9]. Oder man
färbt gleich das ganze Bild ein, wie im GIMP-Forum-Wiki zu
lesen [10].
Links
[1] http://www.flickr.com/photos/shelbychicago/3158762838/
[2] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de
[3] http://www.drweb.de/magazin/gimp-tutorial-schwarzweis-bilder-bearbeiten/
[4] http://wiki.gimpforum.de/wiki/Tutorials#Freistellen
[5] http://www.flickr.com/photos/joelmontes/4952740989/
[6] http://www.gimpusers.de/tutorials/colorkey-zug
[7] http://www.drweb.de/magazin/gimp-tutorial-2-farbfoto-in-schwarzweiss-umwandeln-einzelne-farben-erhalten/
[8] http://wiki.gimpforum.de/wiki/Colorkey_Anwendungen
[9] http://www.gimpusers.de/tutorials/blackwhite-color-1
[10] http://wiki.gimpforum.de/wiki/Colorieren_von_Schwarz-Wei%C3%9F_Fotos
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
spielt gerne mit GIMP, auch wenn er längst nicht
alle Funktionen beherrscht oder kennt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Marvin Gülker
Wenn verschiedenfarbige Pilze und Blumen jemanden wachsen oder ihn Feuer- und
Eisbälle schleudern lassen, Schildkrötenpanzer zwischen beweglichen
Plattformen rotieren oder aus Blöcken Münzen hervorkommen – an was denkt
man dann? Super Mario? Falsch! Es ist Secret Maryo Chronicles [1],
das zwar ursprünglich von Super Mario
inspiriert ist, sich aber langsam davon wegbewegt.
Installation
Secret Maryo Chronicles ist in den Paketquellen der meisten
Linux-Distributionen verfügbar, wird jedoch gelegentlich (etwa unter Ubuntu)
in das eigentliche Spiel und die dazugehörige Musik aufgeteilt. Ein übliches
Kürzel für den doch etwas langen Namen ist SMC, und so findet man unter
Ubuntu Secret Maryo Chronicles als Pakete smc und smc-music, unter Arch Linux
im „community“-Repository unter dem Namen smc, worin auch die Musik enthalten
ist. Alternativ kann Secret Maryo Chronicles auch aus den unter der GNU
GPL Version 3 [2] stehenden Quellen
kompiliert werden. Das Quellarchiv der aktuellen
Version 1.9 [3] sowie das
Musik-Paket [4] (unter „Windows“)
stehen auf den Projektseiten zum Herunterladen bereit. Eine Anleitung zum
Kompilieren findet man im Wiki [5] des
Projektes.
Start
Wenn man sich Secret Maryo Chronicles über die Paketverwaltung installiert
hat, wird sich vermutlich im jeweiligen Spiele-Menü ein neuer Eintrag
befinden. Ansonsten kann man das Spiel mit dem Befehl smc
aus dem Terminal starten.
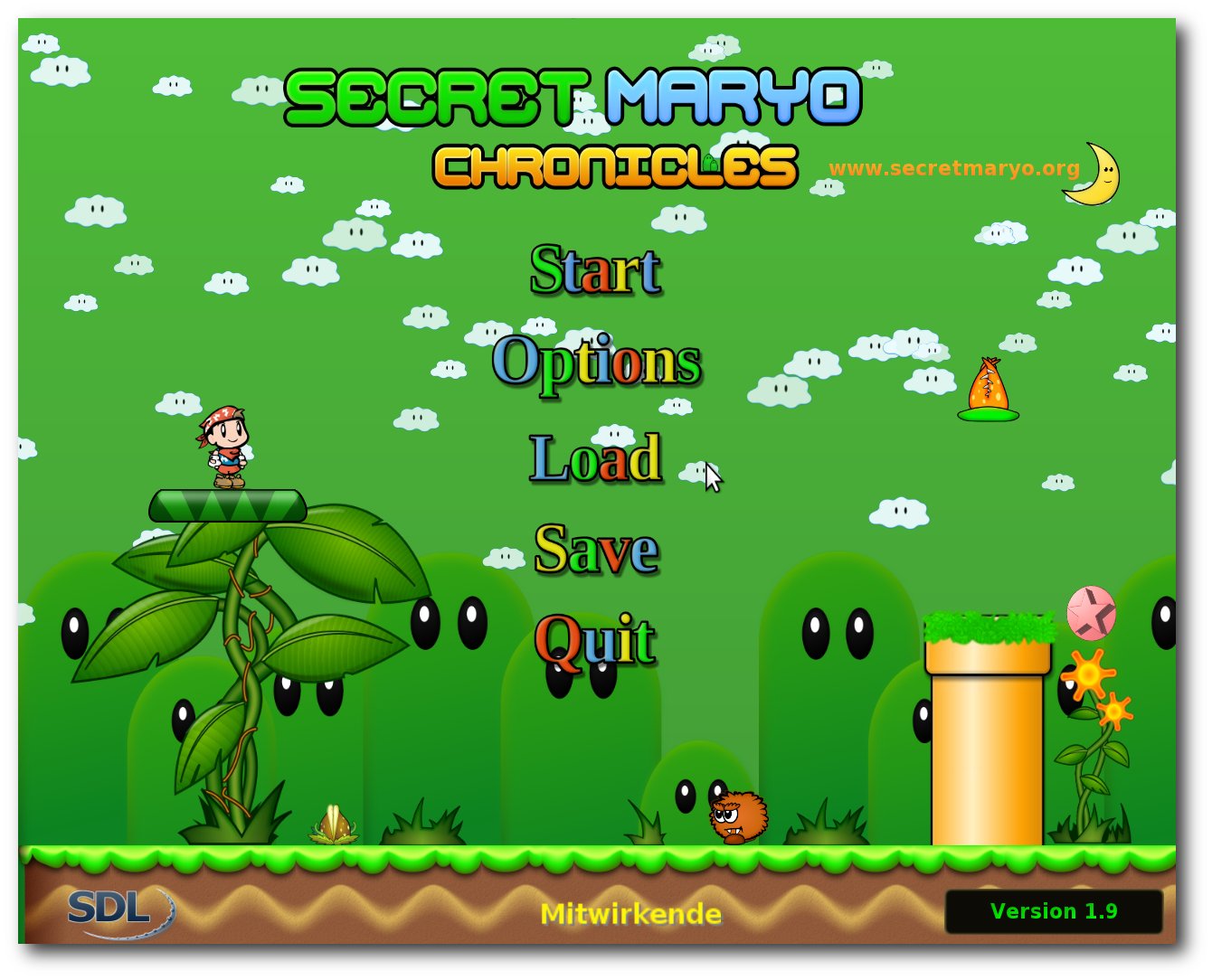
Startbildschirm von Secret Maryo Chronicles
Sodann wird, nachdem die Spielgraphiken auf die korrekte Größe skaliert im
„Cache“ gespeichert wurden, der Startbildschirm mit den folgenden Optionen
angezeigt:
- Start: Eine Welt oder ein Level spielen
- Options: Optionen wie Bild- und Tonqualität einstellen oder auch ein Gamepad
einrichten
- Load: Ein gespeichertes Spiel laden
- Save: Macht aus dem Startmenü wenig Sinn, aber im Spiel kann man hier speichern
- Quit: Beendet Secret Maryo Chronicles
Auf Weltreise
Über den Menüpunkt „Start“ erreicht man direkt
das Menü zur Auswahl der
Spielwelt, wo momentan nur eine zur Verfügung steht. Mit einem Klick auf
„World 1“ und daraufhin auf „Enter“ betritt man die besagte Welt,
worauf man sich auf der „Weltkarte“ wiederfindet. Hier hangelt man sich
von Level zu Level, die im Laufe der Zeit immer schwieriger und anspruchsvoller
werden. Immer wenn man ein Level abgeschlossen hat, wird das nächste
freigeschaltet und man wandert auf der Weltkarte einen Punkt weiter. Münzen
und andere Boni, die man in einem Level eingesammelt hat, bleiben dabei
erhalten und es besteht auch die Möglichkeit, in ein bereits abgeschlossenes
Level zurückzukehren und es noch einmal zu spielen – was durchaus sinnvoll
ist, denn viele Level enthalten versteckte „Geheimnisse“, d. h. schwer
erreichbare Areale, in denen ein oder mehrere 1-Up-Pilze, also Pilze, die der
Hauptfigur Maryo ein Extra-Leben verschaffen, versteckt sind. Je mehr man davon
hat, desto besser: Zu Beginn hat Maryo nämlich nur drei Leben – und die sind
schnell verwirkt, wenn man wieder einmal in einen Abgrund gefallen ist oder von
einem Schildkrötenpanzer gerammt wurde.
Die Steuerung ist einfach und schnell erklärt: Die Pfeiltasten „Pfeil links“ und „Pfeil rechts“
dienen der horizontalen Steuerung von Maryo, mit „Pfeil hoch“ können Lianen erklommen
und Türen geöffnet werden. „Pfeil runter“ bewirkt ein Ducken seitens Maryo, wodurch
unliebsame Dinge einfach über ihn hinwegfliegen können. Zum Springen benutzt
man die Taste „S“, für besondere Aktionen wie etwa das Aufheben eines
herumliegenden Schildkrötenpanzers „A“. „Enter“ dient zum Auslösen eines
zuvor eingesammelten Gegenstandes, der in dem blauen Kästchen am
oberen
Bildschirmrand angezeigt wird. Wem die Steuerung nicht gefällt oder wer lieber
ein Gamepad benutzen möchte, kann mit „Esc“ das Menü aufrufen und unter
„Options -> Controls“ die entsprechenden Einstellungen machen.
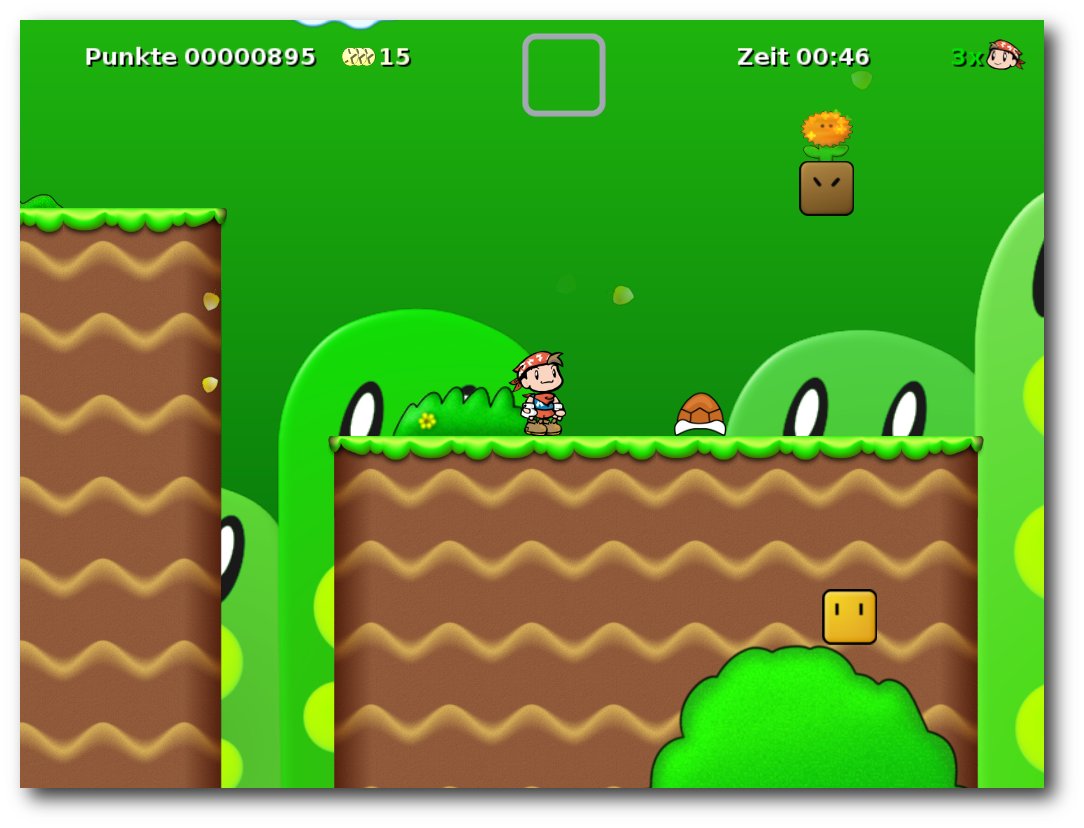
Hält man „A“ jetzt gedrückt und berührt den Schildkrötenpanzer, hält Maryo ihn fest.
Ein Tipp für Ungeduldige: Hält man die Aktionstaste gedrückt, rennt Maryo
und springt auch etwas höher. So kann man nicht nur Level schneller
abschließen, sondern erreicht gelegentlich auch Gebiete, in die man sonst
nicht gelangt wäre.
Achte auf Münzen!
Wann immer Münzen im Blickfeld erscheinen, sollte man sie einsammeln, denn wenn
man 100 Stück gesammelt hat, erhält Maryo ein Extra-Leben. Eine
besondere Rolle nehmen die roten Münzen ein: Sie sind meist schwerer
erreichbar, doch zählen sie für fünf gewöhnliche Münzen.
Abgesehen davon gibt jede eingesammelte Münze Punkte, und die braucht man:
Früher oder später möchte man nämlich speichern, und wenn man dies nicht
gerade auf der Weltkarte tut, berechnet das Spiel dafür 3.000 Punkte. Wer die
nicht hat (nachzulesen am oberen Bildschirmrand links), muss ohne Netz und
doppelten Boden agieren.
Mehr Level
Hat man die vorgegebene Welt einmal durchgespielt, ist aber noch lange nicht
Schluss. Mit Secret Maryo Chronicles werden zahlreiche weitere Level
mitgeliefert, die vom Schwierigkeitsgrad Ultraleicht bis Irrwitzig reichen.
Jedes dieser (und auch der in die Welt integrierten Level übrigens) kann
einzeln gespielt werden, indem unter dem Menüpunkt „Start“ der Reiter
„Level“ angewählt wird. Hat man sich für ein Level entschieden, wählt
man es an und klickt auf „Enter“.
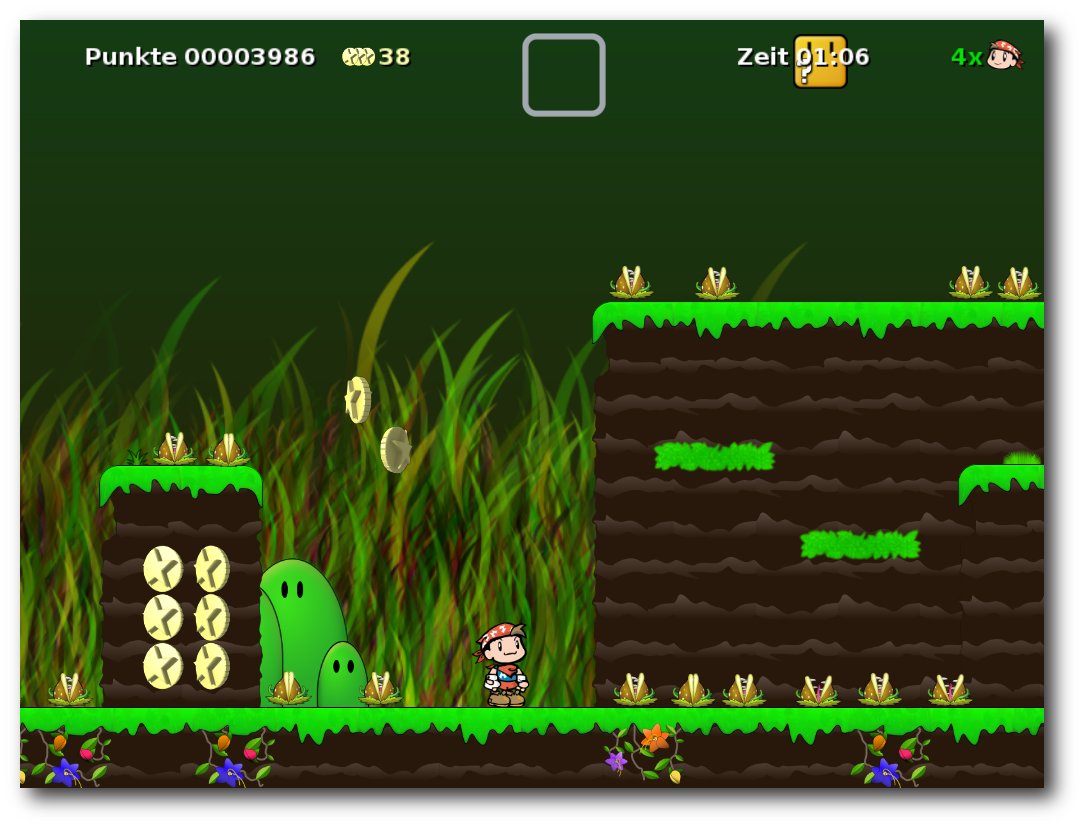
Spätere Level weisen einen höheren Schwierigkeitsgrad auf!
Level im Eigenbau
Secret Maryo Chronicles bietet noch ein weiteres Extra: einen äußerst
mächtigen Level-Editor.
Start des Editors
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Level-Editor zu aktivieren: Entweder drückt
man im laufenden Spiel die Taste „F8“ oder man erstellt ein leeres Level, indem
man im „Start“-Menü den Reiter „Level“ anwählt und den Knopf
„New“ anklickt. „Edit“ verhält sich simultan dazu; hiermit können
bestehende Level bearbeitet werden, „Delete“ löscht vorhandene Level
wieder.
Bedienung
Die Bedienung des Editors mag zwar zu Anfang gewöhnungsbedürftig wirken, sie
ist jedoch recht effizient, wenn man einmal mit ihr warm geworden ist. Die
folgenden Dinge sind möglich:
| Tastaturbefehle im Level-Editor |
| Taste | Effekt |
| Pfeiltasten | Bewegung der Kamera |
| „Pos1“ | Springt zum Ursprung des Koordinatensystems |
| „Ende“ | Springt zum Levelausgang |
| Nummernblock | Pixelgenaues Verschieben einzelner Elemente oder Duplizierung |
| „Strg“ + „C“ | Ausgewählte Objekte in die Zwischenablage kopieren |
| „Strg“ + „V“ | Objektauswahl aus der Zwischenablage einfügen |
| „Strg“ + „X“ | Wie „Strg“ + „C“, aber die Objekte werden ausgeschnitten |
| „Strg“ + „S“ | Level abspeichern |
| „F8“ | Level abspeichern und testen |
| |
Alles, was an Spielobjekten zur Verfügung steht, kann über das Menü am
linken Bildschirmrand abgerufen werden, das aufklappt, wenn man mit der Maus
darüberfährt; durch Klicken und Ziehen wird das gewünschte Objekt in der
Spielwelt platziert, wo sich die Möglichkeit, aktuell gewählte Objekte
pixelgenau zu bewegen, bezahlt macht, denn: Wenn ein Stück Boden auch nur ein
einziges Pixel höher ist als das Vorhergehende, stoppt Maryo dort und man
müsste springen, um das „Hindernis“ zu passieren. Solche minimalen
Verschiebungen können, weil man sie im Spiel nicht direkt erkennt, sehr
ärgerlich sein.
Eine weitere Möglichkeit, Objekte zu erstellen, ist das Duplizieren. Dazu
klickt man mit der mittleren Maustaste oder dem Mausrad auf das zu verdoppelnde
Objekt, hält gedrückt und betätigt zugleich eine der Richtungstasten auf dem
Nummernblock, woraufhin eine Kopie des Objekts an die gewählte Seite angelegt
wird. Es lohnt sich, diese Fingerakrobatik zu lernen, denn sie
erleichtert das
Erstellen langer, ebener
Passagen wie etwa des Bodens ganz ungemein. Vorsicht ist
jedoch geboten, wenn man mehrere Objekte zugleich gewählt hat (möglich, indem
man einen Kasten mittels linker Maustaste um Objekte aufzieht): Je nachdem, wie
viele Objekte man gewählt hat, dupliziert der Editor schon einmal gern den
halben Level, noch dazu mit teils riesigen Lücken zwischen den einzelnen
Objekten. Das kann gewollt sein, muss es aber nicht.

Der Editor in Aktion …
Massiv oder passiv?
Jedes gewöhnliche Objekt kann einen von fünf verschiedenen Typen besitzen:
Massive Objekte sind komplett undurchlässig und stets ein sicherer Standpunkt
für Maryo (von eventuellen Gegnern einmal abgesehen). Ist ein Objekt hingegen
halbmassiv, so kann Maryo von unten durch das Objekt hindurchspringen und
anschließend darauf stehen. Oder aber man lässt sich mit Hilfe von „Pfeil runter“
wieder hindurchfallen. Für Dekoration aller Art gibt es die zwei Status passiv
und front-passiv, die Objekte entweder im Hinter- (passiv) oder Vordergrund
(front-passiv) platzieren, sodass Maryo keinerlei Interaktion mit ihnen pflegen
kann. Der fünfte Typ ist bekletterbar. Er ist vor allem für Kletterpflanzen
praktisch, kann aber auch (etwa für Geheimnisse) auf andere Objekte angewendet
werden. So eingestellte Objekte können von Maryo mithilfe der Pfeiltaste „Pfeil hoch“
erklommen werden.
Um zwischen den verschiedenen Typen umschalten zu können, betätigt man die
Taste „M“, wenn das gewünschte Objekt ausgewählt ist; auch eine Anwendung auf
mehrere Objekte zugleich ist möglich, selbst dann, wenn die Objekte zunächst
unterschiedliche Typen besitzen sollten. Der jeweilige Typ eines Objekte kann
auch an der Farbe der Auswahl festgemacht werden: Massive Objekte sind rot
umrandet, halbmassive gelb, bekletterbare violett und passive sowie
front-passive grün.
Individuelle Einstellungen
Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Hat man einmal sein Level erstellt,
kann man noch Feineinstellungen vornehmen. Viele Objekte bieten individuelle
Einstellungen, die mit einem Doppelklick auf das jeweilige Objekt aufgerufen
werden können; so kann etwa bei einem beweglichen Gegner wie der Kreissäge
die Geschwindigkeit und Rotationsrichtung eingestellt werden oder die
Zeitspanne, nach der eine fallende Plattform endgültig den Halt verliert.
Aber abgesehen von diesen „kleinen“ Einstellungen können auch im
„Großen“ solche vorgenommen werden. Klickt man im Menü am linken
Bildschirmrand den Punkt „Settings“ an, so kann man für den
gesamten Level geltende Einstellungen treffen: Der Reiter „Main“ enthält
allgemeine Daten wie etwa den Namen des Autors und die Größe des Levels in
Pixeln, über „Background“ können Hintergrundbilder und -farben definiert
werden und mithilfe des Reiters „Global Effect“ können levelweite Effekte
wie zum Beispiel Schneeflocken oder fallende Blätter realisiert werden.
Auf beide Punkte soll im Folgenden noch ein wenig näher eingegangen werden, weil
sie leider nicht ganz so selbstverständlich bedienbar sind, wie man vielleicht
annehmen würde.
Hintergrundeinstellungen
Da ist zunächst die Einstellung „Gradient“, die den Farbverlauf des
Hintergrundes kontrolliert. Zunächst einmal muss man wissen, dass diese Farben
grundsätzlich hinter einem Hintergrundbild angezeigt werden, sodass man nicht
befürchten muss, hier plötzlich alles rot zu zeichnen, wenn man nur einen
Sonnenaufgang andeuten wollte. Die erste der beiden
„Gradient“-Einstellungen gibt dabei die Farbe am oberen Levelrand an, die
zweite die am unteren. Secret Maryo Chronicles bildet aus beiden automatisch
einen vertikalen Farbverlauf.
Um ein Hintergrundbild hinzuzufügen, klickt man den Knopf „Add“ an
(„Delete“ würde eines löschen) und wählt anschließend den neu
erstellten Eintrag 0.000110 an (diese Zahl entspricht der weiter unten
erläuterten Z-Koordinate). Gelegentlich ist der Eintrag ein wenig
widerspenstig, aber mit genügend Zeit schafft man es eigentlich immer, ihn
auszuwählen.
Unter „Filename“ gibt man die Bilddatei des Hintergrundbildes an. Der Pfad
ist relativ zum Verzeichnis pixmaps/ im Installationsordner, also etwa
/usr/local/share/smc/pixmaps/, wobei sich die meisten Hintergrundbilder jedoch
im Verzeichnis pixmaps/game/background/ befinden. Bei der Auswahl des
Hintergrundbildes lohnt es sich im Übrigen, den Vollbildmodus von Secret Maryo Chronicles
über „„Esc“ (Hauptmenü) -> Options -> Video -> Vollbild“
abzuschalten, sodass man leichter die Dateinamen einsehen und
abtippen kann, da ein integriertes Durchsuchen der Dateistruktur noch nicht
vorhanden ist.
Die Einstellungen „Speed X“ und „Speed Y“ geben die Geschwindigkeit an,
mit der das Bild mit der Kamera mitscrollt, in der Regel sind die Standardwerte
in Ordnung. Mithilfe der „X-“ und „Y-Position“ kann man den genauen
Startpunkt des Hintergrundbildes angeben, sodass auch der Verwendung mehrerer
Hintergrundbilder in einem Level nichts im Wege steht. Man kann auch
Hintergrundbilder übereinander legen, indem man „Z“ entsprechend
konfiguriert; Bilder mit höherer Z-Koordinate landen weiter vorne, solche mit
geringerer weiter hinten.
Über das leicht kryptische Akronym „Const V. X“ und das Y-Pendant kann
eine fixe Geschwindigkeit des Hintergrundbildes eingestellt werden, sodass sich
etwa Wolken im Hintergrund stets nach rechts bewegen.
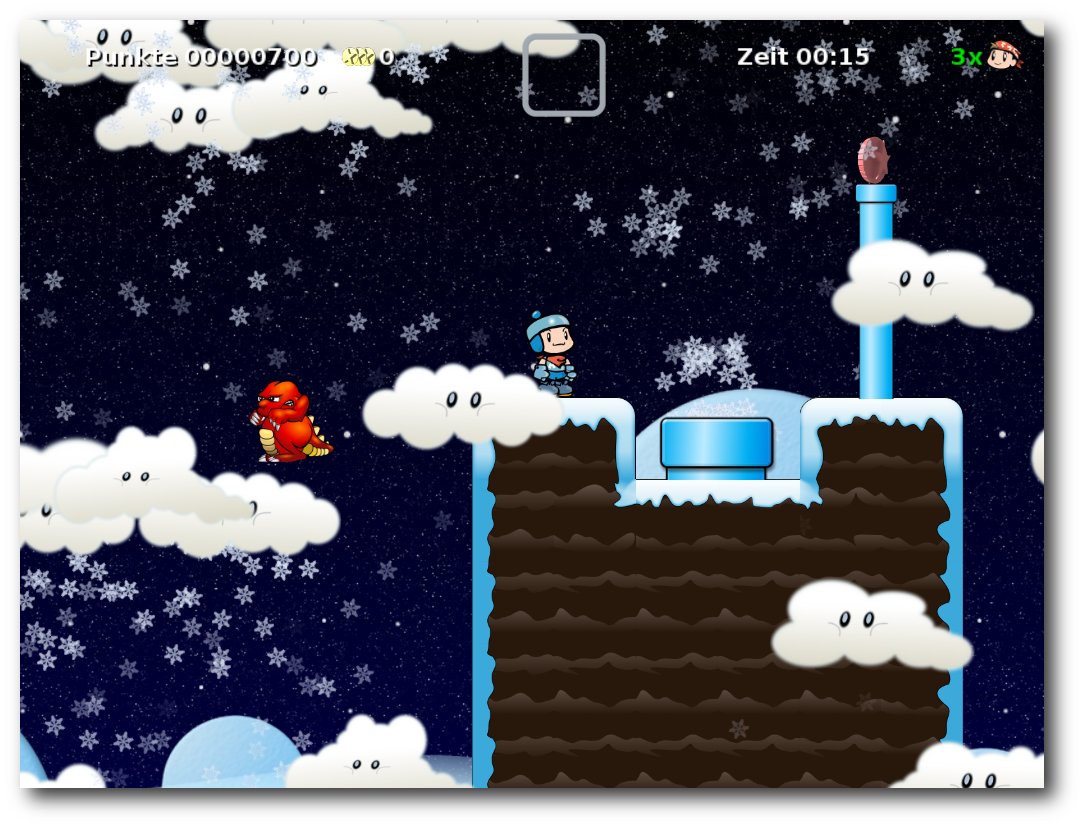
… und dieselbe Stelle im Spiel.
Globaler Effekt
Wie schon zuvor beschrieben, lässt sich ein globaler Effekt wie etwa
Schneeflocken über das „Settings“-Menü am linken Bildschirmrand
einstellen. Nachdem man dort den Reiter „Global Effect“ ausgewählt hat,
wird man zuerst einmal
mit einer wahren Fülle an Optionen bombardiert, die
aber alle ihren Sinn haben.
Die am einfachsten und schnellsten beschriebene Option ist „Type“. Hier
gibt es nämlich nur „Disabled“ (kein globaler Effekt) und „Default“
(es gibt einen globalen Effekt) einzustellen. Möchte man einen Effekt
haben, sollte man ihn logischerweise auf „Default“ stellen.
„Image“ gibt die Grundgraphik des Effekts an, im von mir gewählten
Beispiel also das Bild einer einzelnen Schneeflocke. Wie schon bei den
Hintergrundbildern ist der anzugebende Pfad relativ zum pixmaps/-Verzeichnis,
worin sich der für Effekte am besten geeignete Unterordner
animation/particles/ findet, der auch die Schneeflocke enthält, d. h. der
korrekte Wert für „Image“ wäre animation/particles/snowflake_1.png.
Über „Rect“ gibt man in der Reihenfolge X-Koordinate, Y-Koordinate,
Breite, Höhe das Gebiet an, für das der Effekt gelten soll – diese
Koordinaten beziehen sich auf den Bildschirm, nicht auf das Level selbst, die
vorgegebenen Werte sind in der Regel in Ordnung. Zudem hat es sich im Test als
irrelevant erwiesen, welche Werte für die Y-Koordinate und die Höhe
eingestellt wurden, sie wurden ignoriert. Lediglich X-Position und Breite
konnten verändert werden.
Über „Interval“ gibt man das Erzeugungsintervall in Sekunden an, jedoch
sollte man sich darüber im Klaren sein, dass pro Intervall nicht nur ein
Partikel – eine Schneeflocke im Beispiel – erzeugt wird, sondern mehrere in
kurzen Abständen hintereinander.
Viele der von da an folgenden Einstellungen besitzen einen Grundwert und eine
Zufallskomponente. Gibt man etwa als Z-Position 0.12 (Standard) an und wählt
einen Zufallswert von 0.2, so werden bei der Erstellung der Partikel Z-Werte
von -0.08 bis 0.32 gewählt.
Der letzte anzuprechende Punkt ist „TTL“. Wenn man die Abkürzung nicht
kennt, kann es schwierig sein, sich etwas darunter vorzustellen, weshalb man
sie gut mit „Time To Live“, also „Lebenszeit“, auflösen kann. Der
Wert gibt an, wie lange ein Partikel existiert, wie üblich in Sekunden. Zu
lange Lebenszeiten können bei einem genügend kleinen Intervall allerdings das
Spiel verlangsamen, also hier besser nicht übertreiben.
Die restlichen Einstellungsmöglichkeiten sollen dem Pioniergeist des Lesers
überlassen werden – auch mit dem Hinweis darauf, dass man sich die bereits
im Spiel enthaltenen Level im Editor anschauen kann, um sich ein paar
Kleinigkeiten „abzuschauen“.
Zusammenfassung
Obwohl die Menüführung eher Englisch als Deutsch ist, kommt Secret Maryo Chronicles
eigentlich fast ohne Sprache aus. Wenn man einmal die
Grundsteuerelemente begriffen hat (was auch ohne die erklärenden englischen
Texte in Level 1 recht gut möglich ist), kommt es eigentlich nur noch darauf
an, die eigenen Fähigkeiten so weit auszubilden, dass man auch in den
schwierigeren Leveln bestehen kann. Ein anderer, negativer Punkt ist, dass man
dank des eingebauten Editors über die „F8“-Taste „cheaten“ kann, sich an
einer scheinbar unüberwindbaren Stelle also einfach ein paar Blöcke einsetzt,
speichert, und weitermacht. Dies sollte im Sinne des Spielspaßes aber nicht
wirklich getan werden. Jeder der vorgegebenen Level ist ohne auch nur ein Jota
zu ändern spiel- und schaffbar.
Einen besonderen Anreiz dabei bieten die vielen Geheimnisse. In zahlreichen
Leveln sind diese Areale versteckt, sodass man sie irgendwann nicht mehr wegen
der 1-Up-Pilze aufsucht,
sondern einfach nur aus purem Ehrgeiz heraus, alle Geheimnisse zu finden. So
bietet das Spiel auch dann, wenn man alle Level scheinbar gemeistert hat, immer
noch Herausforderungen.
Der eingebaute Level-Editor ist ebenfalls ein Schmankerl sondergleichen. Er
mag zwar etwas schwer zu bedienen sein, aber hat man sich einmal an ihn
gewöhnt, sind der eigenen Kreativität praktisch keine Grenzen gesetzt.
Zuletzt sei noch darauf hinzuweisen, dass es zu Secret Maryo Chronicles ein
offizielles Forum [6] gibt, in dem auch Deutsch
gesprochen wird, da einige der Entwickler aus der hiesigen Umgebung kommen.
Auf derselben Website
findet sich auch noch ein Wiki [7], das
Hilfestellung zum Spiel und zum Editor leistet und auch die Anforderungen für
Level enthält, die man gerne in Secret Maryo Chronicles aufgenommen sehen
möchte [8].
Langfristiger Spielspaß ist demnach mehr als garantiert. Und auch wenn es
nicht so scheint – die Weiterentwicklung des Spiels ist in vollem Gange. Für
die demnächst erscheinende Version 2.0 sind zahlreiche neue Features geplant,
etwa einige neue Gegner sowie massive Verbesserungen des Leveleditors. So soll
zum Beispiel eine Lua-ähnliche Skriptmöglichkeit geschaffen werden, um
endlich dem Wunsch der Community nach bedingten Anweisungen Rechnung zu tragen,
und auch das Erstellen von Pfad-Objekten für bewegliche Plattformen könnte
dann algorithmisch statt von Hand erfolgen. Außerdem bemüht man sich, nach
Möglichkeit mehr Abstand vom Nintendo-Vorbild zu gewinnen. Bereits in der
aktuellen Version sind Gegenstände enthalten, die man aus dem klassischen
Super Mario nicht kennt (etwa der Eis-Pilz) und es gibt Bemühungen,
sämtliche Mario-ähnlichen Graphiken und Musiken aus dem Spiel zu entfernen.
Auch wird an einem Handlungsfaden gearbeitet, der nicht dem typischen
Mario-rettet-die-Prinzessin entspricht.
Links
[1] http://www.secretmaryo.org/
[2] http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
[3] http://www.secretmaryo.org/index.php?page=game_download_linux
[4] http://www.secretmaryo.org/index.php?page=game_download_music
[5] http://www.secretmaryo.org/wiki/index.php?title=Compiling_from_Tarball
[6] http://www.secretmaryo.org/phpBB3/
[7] http://www.secretmaryo.org/wiki
[8] http://www.secretmaryo.org/wiki/index.php?title=Level_Design_Guidelines
| Autoreninformation |
| Marvin Gülker
ist Schüler der Stufe 12 und programmiert für sein Leben gern.
Seit er von Ubuntu auf Arch Linux umgestiegen ist, schaut er öfter mal, was
für neue Spiele in die Arch-Repos wandern und probiert sie aus.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Bodo Schmitz Der Browser Firefox sowie andere Produkte aus dem Hause Mozilla
verfügen über eine Erweiterungsschnittstelle, die man einsetzen kann,
um die benutzten Programme mit geeigneten Erweiterungen gegen
Einbruch und Datenschnüffelei abzudichten. Der Artikel soll einige
Erweiterungen vorstellen, die bei der Absicherung des Browsers dienen
können.
Einleitung
Die Electronic Frontier Foundation (EFF) warnt vor Benutzeridentifikation
durch Browser-Fingerprinting [1],
doch sollte man sich nicht von Meldungen wie dieser dazu verleiten
lassen, aus Gründen der „Unauffälligkeit“ seinen Browser nur noch in
der Standardeinstellung zu betreiben, um sich damit dann ein Riesenloch
in seine Sicherheitsinfrastruktur zu reißen.
Aus Gründen der Datensicherheit und des Schutzes vor allerlei Datenkraken
ist es sehr wohl sinnvoll, seinen „Netzausbreiter“ so gut wie möglich
abzudichten. Dabei ist es weitaus zielführender, statt dem
unendlichen Versions- und Updatewahn hinterher zu hecheln, lieber
grundlegende Risiken auszuschalten, indem man seinen Browser
vernünftig konfiguriertund auf in der
Mozilla-Welt verfügbare Erweiterungen zu setzen.
Neben Firefox (auf debian-basierten Distributionen heißt er aus
lizenzrechtlichen Gründen „Iceweasel“; bei Ubuntu und Derivaten
werden für Mozilla-Produkte allerdings wieder die
Originalbezeichnungen verwendet) beinhaltet übrigens Seamonkey
(Debian: „Iceape“, das Community-Projekt der inzwischen
eingestellten Mozilla-Suite) seit Version 2 ebenfalls eine
Erweiterungsschnittstelle, genauso wie der E-Mail-Client Thunderbird
(Debian: „Icedove“).
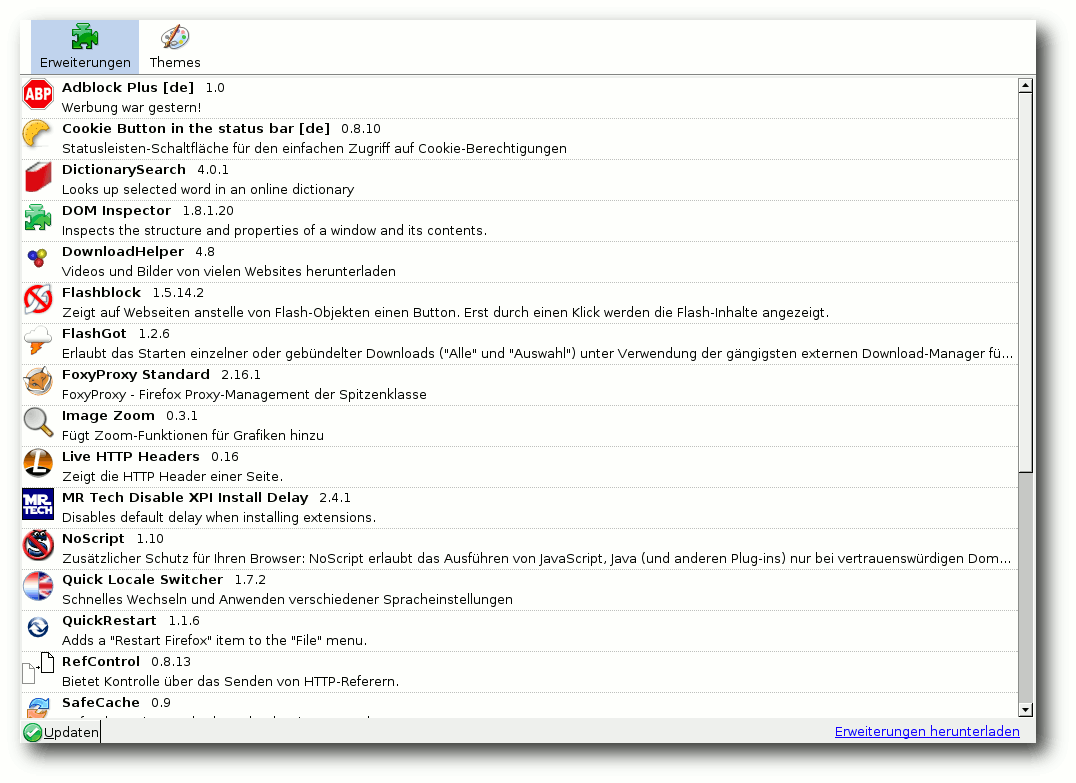
So weit muss man es mit der Absicherung nicht unbedingt treiben. Zu einem erhöhten Sicherheitsniveau führt eine solche Verhaltensweise aber dennoch.
Die hier vorgestellte Übersicht soll als Einblick in diese Thematik
dienen, sie kann keineswegs vollständig sein, dafür sollte sie aber
zu weiterer Recherche anregen. Auch überschneidet sich der
Einsatzzweck einiger Erweiterungen, was aufgrund der
Inkompatibilität mit einigen Browserversionen zu mehr Flexibilität
führen dürfte, da nicht jede Browserversion mit jeder der
aufgeführten Erweiterungen funktioniert.
Eine sehr gut sortierte Zusammenstellung zahlreicher Erweiterungen
für die verschiedenen
Mozilla-Produkte bietet die inzwischen
eingefrorene, aber nach wie vor verfügbare Webseite
erweiterungen.de [2], die rund die
Hälfte der hier vorgestellten Erweiterungen listet. Von dort kann
man die zahlreichen auf deutsch verfügbaren Erweiterungen
installieren und über den Erweiterungsmanager des Browsers
aktualisieren lassen, da es manchmal mühsam ist, auf den meist
englischsprachigen Webseiten die deutsche bzw. internationale
Version zu finden.
Einige Erweiterungen überprüfen beim Start des Browsers selbstständig, ob
neue Versionen verfügbar sind, es empfiehlt sich aber dennoch,
regelmäßig über den Erweiterungsmanager nach Aktualisierungen suchen
zu lassen. Die Kompatibilität zu den unterschiedlichen
Browserversionen verändert sich im Laufe der Zeit. Somit empfiehlt
es sich, auf der jeweiligen Homepage der Erweiterung in die
Änderungsdatei (Changelog) zu schauen und im Falle der Inkompatibilität
nach alternativen Erweiterungen zu suchen bzw. die letztmögliche
Version zu verwenden (die normalerweise auf der Mozilla-AddOns-Seite
ganz unten zu finden ist), denn es ist meist besser, eine Erweiterung
mit älterer Versionsnummer zu benutzen, als sie auszulassen. Sollte
es zu Problemen kommen, kann man im Firefox-Erweiterungsmanager per
Rechtsklick die Aktualisierung für jede Erweiterung einzeln
vornehmen.
Generell empfiehlt es sich, statt auf potentiell unsichere Plug-ins
zu setzen (vor allem, wenn diese proprietärer Herkunft sind), die
jeweiligen Medien (Audio, Video, PDFs etc.) manuell herunterzuladen
und anschließend mit möglichst quelloffener Software einzusehen. Das
erhöht zwar im Vergleich zu gestreamten und somit häufig nur
teilweise konsumierten Medien in einzelnen Fällen die Serverlast,
aber ebenso die Sicherheit des Anwenders. Eventuell lässt man vorher
noch einen Virenscanner über die Medien schauen.
Die Erweiterungen
NoScript
Der wohl größte Anteil an Sicherheitsschwankungen wird hervorgerufen
durch JavaScript in Kombination mit anderen Techniken. Da man
JavaScript beim normalen Surfen in der Regel nicht braucht, sollte
es standardmäßig deaktiviert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Dazu bietet sich in idealer Form die Erweiterung „NoScript“ an. Die
standardmäßig blockierten Skripte lassen sich temporär (bis zum Ende
der Sitzung) oder dauerhaft (bei regelmäßig besuchten Seiten) über
das in der Statusleiste des Browsers erscheinende Icon aktivieren.
Das Ganze hat dann noch einige begrüßenswerte „Randerscheinungen“:
Während JavaScript auf der Hauptseite aktiviert ist, bleiben die
Skripte in den potentiell Schadcode-belasteten Werbeeinblendungen
weiterhin deaktiviert. Viele dieser Einblendungen kann man ergänzend
mit der unten beschriebenen Erweiterung „Adblock Plus“ komplett
entfernen. Man kann somit die Webseite mit JavaScript bedienen, ohne
gleichzeitig schmutziges Beiwerk mitgeliefert zu bekommen. Darüber
hinaus kann „NoScript“ noch viel mehr: Neben JavaScript kann diese
Erweiterung diverse potentiell gefährliche oder instabile Plug-ins
blockieren (z. B. Flash, Silverlight etc.) sowie manche
Datensammelei verhindern und Randgefahren, wie z. B. Umleitungen auf
andere potentiell Schadcode-belastete Webseiten, verhindern.
Achtung: JavaScript muss in den Browser-Optionen aktiviert bleiben,
da es durch die Erweiterung selbst blockiert wird. Bei der weiter
unten beschriebenen Erweiterung „Cookie Button …“ verhält es sich dagegen genau umgekehrt.
Info/Download:
Cookie Button in the status bar („CBitsb“)
Die Erweiterung „CBitsb“ verhält sich in gewisser Weise ähnlich wie
„NoScript“. Mit ihr können Cookies generell gesperrt und bei Bedarf
für einzelne Webseiten temporär oder dauerhaft aktiviert werden. Die
Steuerung funktioniert ebenfalls über ein Symbol in der Statusleiste
des Browsers.
Im Gegensatz zur JavaScript-Steuerung mittels „NoScript“ müssen die
Cookies bei „CBitsb“ in den Browser-Optionen gesperrt werden. Die
Erweiterung entsperrt sie dann entsprechend der Konfiguration.
Info/Download:
View Cookies
Den Inhalt der ungeliebten „Datenkekse“ kann man mit „View Cookies“
in einem separaten Browser-Tab anschauen.
Info/Download:
Flashblock
Wer „NoScript“ nicht verwenden kann oder möchte, kann alternativ mit
der Erweiterung „Flashblock“ Flash und Silverlight blockieren.
Info/Download:
Adblock Plus
Mit „Adblock Plus“ können Filterlisten, die Quelltextmuster
beinhalten, abonniert werden, um Werbung und andere lästige
Einblendungen von diversen „Dienstleistern“ auszublenden. Zusätzlich
können diese Listen durch eigene Filterregeln erweitert werden. Zur
einfacheren Verwaltung empfiehlt sich zusätzlich die Installation der
Erweiterung „Adblock Plus: Element Hiding Helper“.
Info/Download:
Remove It Permanently
Ergänzend zu „Adblock Plus“ ermöglicht „RIP“ das permanente Blocken
von unerwünschten Webseiteninhalten.
Info/Download:
RefControl
Der sogenannte Referer teilt einer Webseite mit, von wo aus man
herkommt, sodass z. B. in Kombination mit Cookies ein Besucherprofil
erstellt werden kann. Das hat in der Regel wenig Mehrwert für den
Seitenbesucher, birgt aber hohes Missbrauchspotential und sollte
somit blockiert werden. Einzelne Domains können bei Bedarf in einer
Liste von der Sperrung ausgenommen werden. Der Browser Opera kann
diese Information übrigens von Haus aus nach entsprechender
Konfiguration blockieren.
Nach Installation von „RefControl“ muss die standardmäßige Blockierung
noch aktiviert und die Standardregel auf „Blockieren“ gesetzt
werden. Zur bequemen Umschaltung erscheint ein Button in der
Statuszeile des Browsers, falls die Zusammenarbeit mit einigen
Webseiten (wie beispielsweise bei
Download-Portalen) aufgrund der Referer-Blockierung
einmal scheitern sollte.
Info/Download:
No-Referer
Die Erweiterung „No-Referer“ stellt eine Alternative zu „RefControl“
dar. Beim Öffnen von Links in einen neuen Tab per Rechtsklick
erscheint im Kontextmenü ein weiterer Eintrag, der den Klick ohne
Übermittlung des Referers ermöglicht.
Info/Download:
BetterPrivacy
Mit „BetterPrivacy“ wird man die penetranten
„Flash-Cookies“ [3]
los, die von Webseiten wie YouTube und eBay zur Erstellung von
Besucherprofilen gesetzt werden. Diese Objekte lassen sich nämlich
nicht über den normalen Cookie-Manager des Browsers entfernen.
Info/Download:
IDN Info
Beim sogenannten Domain Spoofing wird der Besucher durch Austausch ähnlich
aussehender Zeichen (z. B. aus dem kyrillischen Zeichensatz) im
Domain-Namen unbemerkt auf eine zwar visuell gleich
aussehende, aber logisch andere Domain gelockt, um von dort seinen
Rechner anzugreifen. „IDN Info“ warnt den Besucher durch ein
entsprechendes Icon.
Info/Download:
SpoofStick
„SpoofStick“ gibt durch eine Texteinblendung in der Menüleiste
zu erkennen, ob man auf eine gefälschte Seite umgeleitet worden ist.
Die in der Regel kryptischen, gefälschten Internet-Adressen werden in
eine für Menschen leichter lesbare Form gebracht und sind laut
Hersteller ein brauchbarer Start, nicht auf die Fälschungen
hereinzufallen.
Info/Download:
LayerBlock
Über so genannte Layer (Ebenen) lassen sich Seitenelemente exakt
positionieren.
Aber auch Werbung einblenden, die nicht durch
Popup-Filter oder Deaktivierung von JavaScript ausgeblendet werden
kann. „LayerBlock“ sperrt diese Form der Werbeeinblendungen.
Zahlreiche bekannte Standard-Werbe-Layer können alternativ von der
oben beschriebenene Erweiterung „AdBlock Plus“ blockiert werden.
Info/Download:
FoxyProxy
Mit der Erweiterung „FoxyProxy“ lassen sich sehr komfortabel
Proxydienste, wie z. B. Jondos/JAP [4],
verwalten und nach Bedarf per Button ein- und ausschalten. Das
erspart das lästige und fehleranfällige manuelle Umstellen der
Netzwerkeinstellungen des Browsers.
Info/Download:
SwitchProxy Tool („SPT“)
„SPT“ geht in die gleiche Richtung wie die oben angesprochene
Erweiterung „FoxyProxy“, bietet allerdings weniger Optionen (so
fehlt z. B. der „Tor Wizard“), tut aber grundlegend seinen Dienst.
Info/Download:
Torbutton
„Torbutton“ ist eine sehr leistungsfähige Erweiterung mit
zahlreichen sicherheitsrelevanten Optionen zur Teilnahme am
Tor-Proxynetzwerk [5]. Ähnlich wie die
beiden oben genannten Proxy-Erweiterungen lässt sich das
Proxy-Netzwerk per Klick auf einen Statusleisteneintrag bequem ein-
und ausschalten.
KDE-Nutzern empfiehlt sich darüber hinaus die Installation des
Konfigurationswerkzeugs TorK [6].
Info/Download:
Tor-Proxy.NET-Toolbar
Über diese Erweiterung wird eine Toolbar installiert, in die man die
zu besuchende Webadresse eingeben kann, die man dann verschlüsselt
über den Anonymisierungsdienst von Tor-Proxy.NET aufrufen kann, der
die Anfragen zur weiteren Verschleierung an einen Proxy-Dienst wie
Tor oder JonDos/JAP weiterleitet.
Info/Download:
HTTPS Everywhere
„HTTPS Everywhere“ greift, soweit eine entsprechende Unterstützung
durch
die Webseite
angeboten wird, über HTTPS auf die jeweiligen
Seiteninhalte zu und versucht, HTTP-Verlinkungen in die sichere
HTTPS-Version umzuwandeln. Das klappt allerdings nicht immer zur
vollen Zufriedenheit, wie Oliver Herold detailliert
erläutert [7].
Eine permanente Kontrolle ist also nötig.
Info/Download:
Quick Locale Switcher
Mittels des „Quick Locale Switcher“ kann man einer Browserweiche
vortäuschen, aus einem anderen Land zu kommen, um somit anders
lokalisierte Webseiten betrachten zu können. Außerdem kann man
damit wunderbar „Datenkraken“ irritieren.
Aus einer sehr umfangreichen Liste verfügbarer „Herkunftsländer“
kann man sich eine Auswahl zusammenstellen. Nach Wechsel der
Lokalisierung wird man allerdings zum Neustart des Browsers
aufgefordert.
Info/Download:
User Agent Switcher
Vergleichbar mit der oben genannten Erweiterung „Quick Locale
Switcher“ kann man über den „User Agent Switcher“ eine falsche
Browserkennung senden, da es leider immer noch Webdesigner gibt, die
offensichtlich der Meinung sind, dass es nur einen Browser (und ein
Betriebssystem) auf der Welt gibt. Möglicherweise lassen sich so
sonst nicht zugreifbare Webseiten benutzen. Darüber hinaus kann man
damit YouTube überreden, wieder Flash mit Firefox 2 abzuspielen, da
man dort inzwischen ohne erkennbaren Grund „leicht penetrant“
gedrängt wird, seinen Browser zu aktualisieren.
Auch ist es möglich, sich als Suchmaschinen-Spider auszugeben. Es
lassen sich beliebige Kennungen erzeugen sowie die Liste der
Kennungen im- und exportieren.
Info/Download:
SafeCache/SafeHistory
Es gibt Angriffsmethoden, bei denen durch das Auslesen der
Link-Einfärbung besuchter Webseiten ein Profiling des
Seitenbesuchers möglich ist bzw. der Besuch einer (unliebsamen)
Webseite nachgewiesen werden kann. Die beiden Erweiterungen
„SafeCache“ und „SafeHistory“ unterbinden dieses Loch in der
Privatsphäre.
Info/Download:
ShowIP
Die Erweiterung „ShowIP“ zeigt die
IP-Adresse der gerade besuchten Webseite in der Statuszeile an. Das erhöht die Chancen, nicht auf verdeckte
Umleitungen hereinzufallen.
Info/Download:
My IP Tool („IPT“)
„IPT“ zeigt über ein Symbol in der Statusleiste die lokale bzw.
öffentliche IP-Adresse des Computers an. Dies kann z. B. zur
Funktionskontrolle eines Proxy-Dienstes eingesetzt werden.
Info/Download:
Fazit
Zusammengefasst erhöhen die oben genannten Erweiterungen Komfort und Sicherheit der gängigen
Mozilla-Produkte. Da es auch in Zukunft keine wirklich „sichere“
Applikationen geben wird, ist es sinnvoller, mit einer
entsprechenden Zusatzausstattung seine Anwendungen größtmöglich
abzudichten. Dann kann man sich auch fast ohne schlechtes Gewissen
mit der Lieblingsversion seines Lieblingsbrowsers im Netz bewegen.
Der Google-Browser Chrome enthält inzwischen auch eine ähnliche
Erweiterungsschnittstelle. Mit Firefox 4 soll allerdings eine neue
Erweiterungsschnittstelle eingeführt werden,
um z. B. den Neustart der Anwendung nach Installation und Aktualisierung der
Erweiterungen unnötig zu machen.
Darüber hinaus lohnt sich ebenfalls die Auseinandersetzung mit
sicherheitsrelevanten Erweiterungen für den E-Mail-Client
Thunderbird wie auch dem gerade erschienenen Opera 11, der nun
ebenfalls eine Erweiterungsschnittstelle beeinhaltet.
Links
[1] http://www.pro-linux.de/news/1/15331/1,eff-gegen-browser-fingerprinting.html
[2] http://www.erweiterungen.de/
[3] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Flash-Cookie
[4] http://anonymous-proxy-servers.net/de/
[5] http://www.torproject.org/
[6] http://www.anonymityanywhere.com/tork/
[7] http://www.fixmbr.de/fragwuerdige-sicherheit-mittels-effs-https-everywhere/
| Autoreninformation |
| Bodo Schmitz (Webseite)
wollte seinen Browser sehr weit absichern. Mit den im Artikel beschriebenen
Erweiterungen erreichte er dabei ein höheres Sicherheitsniveau, als
es die Standard-Einstellmöglichkeiten des Browsers je bieten können.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Hans Müller Nachdem im ersten Teil dieser losen Artikelserie beschrieben wurde, wie ein
kleines Projekt zur Ansteuerung einer externen Hardware aufgesetzt werden
kann (siehe freiesMagazin 01/2011 [1]), soll im Teil 2 etwas tiefer in die OpenAPC-Software eingestiegen
werden. Ziel ist es hier, eine Softwarestruktur aufzusetzen, welche auch für
größere und vor allem komplexere Steuerungsaufgaben geeignet ist.
Darüber hinaus soll auch gezeigt werden, wie sich so ein System mittels den
integrierten Skriptfähigkeiten des Softwarepaketes kontrollieren lässt.
Updates und ihre Folgen
Zuvor ist ein kleiner Rückblick auf den ersten Teil des Artikels
notwendig. Hier wurde mit Hilfe der Version 1.0 der
OpenAPC-Visualisierungssoftware ein Projekt zur Rollladensteuerung erstellt. Mit der
bis zum Erscheinen des Artikels aktuell gewordenen Version 1.2 hat dieses
Projekt leider nicht mehr funktioniert. Ursache hierfür war ein Fehler in
der Version 1.0, der in der neueren Version behoben wurde. Ungünstigerweise
hat das Beispiel diesen Softwarefehler benötigt, um korrekt zu
funktionieren. Die notwendige Änderung ist aber einfach zu
bewerkstelligen und bei genauerer Betrachtung auch logisch: So dürfen die
Ausgänge der beiden Toggle-Buttons nicht direkt auf den Eingang des Displays
gesetzt werden, sondern müssen über ein logisches Oder-Gatter miteinander
verbunden werden.
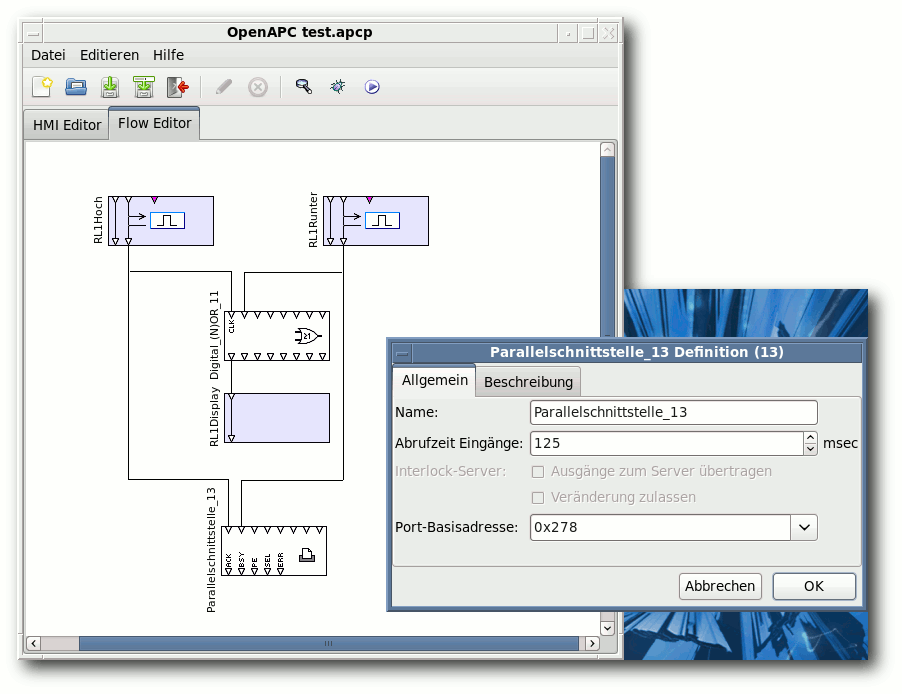
Die Button-Ausgänge werden über ein Oder-Gatter verknüpft.
Ist dieses Gatter nicht vorhanden, bestimmt immer der Button, der den
Zustand seines Ausganges als letztes ändert, über den Anzeigezustand des
Elementes „RL1Display“. Erst durch
Verwendung des logischen Oder-Gatters wird dann auch
tatsächlich überprüft, ob mindestens einer der beiden Toggle-Buttons auf HIGH
gegangen ist.
So ärgerlich solche Inkompatibilitäten sind, so üblich sind sie leider auch
im professionellen Umfeld: So ist es bei Softwareupdates in jedem Fall
erforderlich, Regressionstests mit den bereits vorhandenen Projekten
durchzuführen, um zu überprüfen,
ob die Software noch so arbeitet, wie man
es erwartet. Und nicht selten ist genau darin der Grund zu finden, warum die
Industrie Uralt-Versionen einer bestimmten Software auf ihren Maschinen
einsetzt. Nur mit dieser Version ist sicher gestellt, dass die
Anlagen noch wie gewünscht funktionieren.
So ist es gängige Praxis, dass Softwarehersteller echte Fehler und Bugs
beheben, auch wenn sich dabei das Verhalten ändern kann. Allerdings wird bei
neuen Funktionen peinlich genau darauf geachtet, dass sich das Verhalten
gegenüber den vorhergehenden Versionen nicht ändert. Und wer besonders große
Stückzahlen einer Software einsetzt, kann beim Hersteller natürlich auch
Sonderwünsche äußern. Das geht zum Teil sogar so weit, dass Bugs für
spezielle Kunden explizit nicht behoben werden, um das Verhalten nicht zu
ändern.
Hinweis: Alle vorgestellten Dateien test2.apcp, test2.lua
und test2.il können zusammen über das Archiv
heimautomatisierung.tar.gz heruntergeladen werden.
Steuerung per Skript
Doch nach diesem Ausflug in die problematischen Bereiche der professionellen
Automatisierung zurück zur Visualisierung der Rollladensteuerung: Im
Folgenden soll das bestehende Projekt ein wenig erweitert werden. So sollen
an Stelle der Toggle-Buttons zum Schalten der Rollladen jetzt einfache Buttons
für „hoch“, „runter“ und „Stopp“ zum Einsatz kommen, welche nicht mehr über
ein im Floweditor erstelltes Blockdiagramm gesteuert werden, sondern über
ein externes Skript.
Der Benutzer soll zukünftig nur noch einen der drei Buttons kurz drücken, um
eine Aktion auszulösen; das Skript überwacht dabei komplett den Zustand und
steuert auch die Ausgänge der Parallelschnittstelle entsprechend der letzten
Aktion des Benutzers an.
Die OpenAPC-Software bringt zwei Skriptinterpreter mit: einen für
LUA [2], einer leicht zu erlernenden und schön strukturierten
Sprache, und einen für Instruktionslisten (Instruction List/IL), einer
einfach gehaltenen, assemblerähnlichen Sprache, welche aus der Welt der
Automatisierung und speicherprogrammierbaren Steuerungen
(SPS/PLC) [3] bekannt ist
und dort auch häufig verwendet wird.
Allerdings ist es – was zuerst ein wenig überrascht – nicht möglich, diese
Skripte direkt in der Umgebung des OpenPlayer laufen zu lassen. Hierfür ist
ein Umweg über ein zusätzliches Element notwendig, den so genannten
„Interlock-Server“. Dieser dient als zentrale Kommunikationsinstanz und
Schnittstelle zwischen allen Komponenten, mit denen der OpenPlayer in einem
Projekt möglicherweise zusammenarbeitet. Hier ist man nicht
auf eine einzelne Instanz eines Skriptinterpreters angewiesen, es ist bei komplexeren Systemen tatsächlich auch möglich, Teilaspekte einer
Steuerung in getrennten Skripten zu behandeln. Das erhöht die
Übersichtlichkeit und Wartbarkeit eines Projektes enorm.
Doch nun zur praktischen Durchführung des Vorhabens. Da das bisherige
Rollladen-Projekt nicht allzu komplex ist und die vorzunehmenden Änderungen
etwas umfangreicher sind, lohnt es sich an dieser Stelle durchaus, ein komplett
neues Projekt aufzusetzen. Hier sind zuerst ein paar globale Einstellungen
notwendig, welche im Projektdialog vorgenommen werden, der sich mittels des
Menüs „Datei -> Projekteinstellungen …“ öffnen lässt. Dieser bietet einige
Möglichkeiten, das Projekt anzupassen. So kann hier die Größe des Fensters
gewählt werden, in dem sich später die Bedienelemente befinden, sowie dessen
Hintergrundfarbe. Weitere Parameter wie „Timeout für Kontrollfluss“ und
„Genauigkeit Timer“ sind nur für Projekte von Interesse, bei denen die
Logiksteuerung von einem Floweditor-Blockschaltbild übernommen wird (was in
diesem Beispiel hier ja erstmalig nicht mehr der Fall sein wird).
Interessant wird es allerdings wieder bei der Option
„Externe Applikationen / Interlock-Server benutzen“.
Hierbei handelt es sich um die oben bereits
erwähnte zentrale Kommunikationsinstanz, welche erforderlich ist, wenn
externe Skripte zum Einsatz kommen sollen. Diese Option ist also zu
aktivieren.
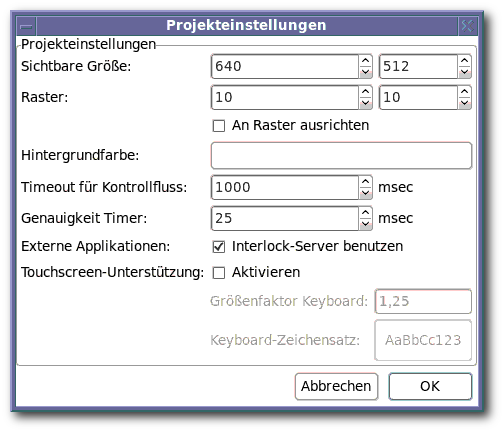
Die globalen Projekteinstellungen: Hier wird der Interlock-Server aktiviert.
Des Weiteren gibt es noch eine interessante Konfigurationsmöglichkeit
für Touchscreens. Wenn diese Option aktiviert wird, kümmert sich die
Software automatisch darum, dass der Benutzer Text- und Zahlenwerte eingeben
kann, auch wenn er keine Tastatur hat. Sobald im
OpenPlayer ein entsprechendes Eingabefeld selektiert wird, öffnet sich ein
On-Screen-Keyboard, mit dem Texte und Zahlen per Bildschirm eingegeben
werden können, die anschließend automatisch in das entsprechende Eingabefeld
übernommen werden.
HMI und Flow
Der nächste Schritt sollte jetzt ganz einfach zu bewerkstelligen sein: Im
HMI-Editor werden drei Buttons angelegt, welche den Text „Hoch“, „Stopp“ und
„Runter“ sowie die eindeutigen Namen „RLHoch“, „RLStopp“ und „RLRunter“
erhalten, daneben wird wieder ein Anzeigeelement „RLDisplay“ gesetzt,
welches den aktuellen Zustand des Rollladens mittels der Farben grün
(Stillstand) und rot (Rollladen läuft) anzeigt.
Auch im Flow-Editor passiert zunächst nichts Neues, hier werden die vier
Elemente wieder mittels des Kontextmenüs und des Menüpunktes
„Steuerungselement anlegen“ dem Editor hinzugefügt. Da die Steuerung jetzt
aber von einem Skript übernommen werden soll, werden zwischen diesen
Elementen keinerlei Verbindungslinien gezogen. Dafür muss aber definiert
werden, dass die Buttons ihre Ausgangsdaten zum
Interlock-Server übertragen
sollen und das Anzeigeelement „RLDisplay“ vom Interlock-Server Veränderungen
zulässt. Das passiert mit Doppelklick auf die Elementsymbole, hier öffnet
sich jeweils ein Konfigurationsdialog, welcher die entsprechenden Optionen
anbietet: „Ausgänge zum Server übertragen“ für die
Buttons und „Veränderung zulassen“
für das Anzeigeelement. Ganz wichtig und nicht zu vergessen:
Auch
das Plug-in für die Parallelschnittstelle, welches die Hardware ansteuern
soll, muss dem Flow-Editor hinzugefügt werden und ebenfalls dafür
konfiguriert werden, dass seine Eingänge vom Interlock-Server verändert
werden dürfen.
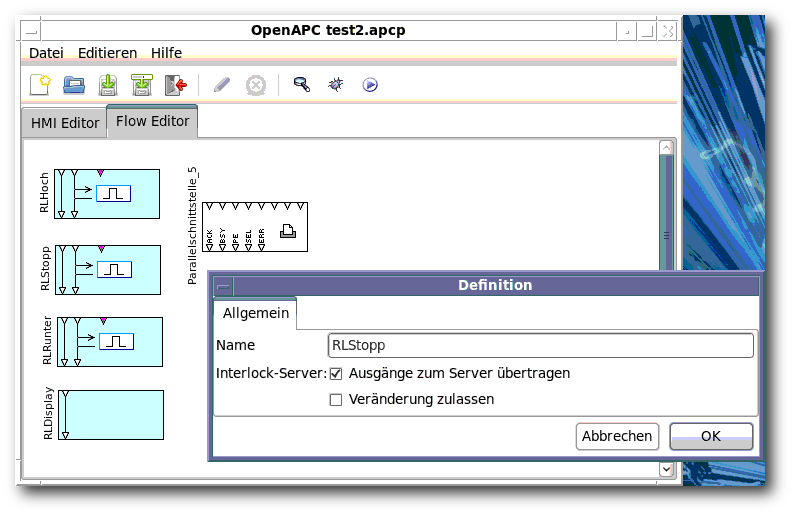
Parametrisierung der Elemente: Hier wird festgelegt, welche Daten der Interlock-Server bekommt und welche er verändern darf.
Dieser zusätzliche Konfigurationsschritt scheint umständlich, ist bei
genauerer Betrachtung aber durchaus sinnvoll: So sind komplexe
Benutzerinterfaces mit hunderten Bedienelementen vorstellbar, von denen aber
nur ein Teil nach außen hin sichtbar sein muss (z. B. weil die anderen
lediglich die Darstellung der Oberfläche beeinflussen und nichts mit der
Steuerung selbst zu tun haben). Für solche Fälle wird mit dieser
Vorgehensweise verhindert, dass der Interlock-Server mit Daten belastet
wird, die für ihn nicht von Interesse sind. Das spart Ressourcen und macht
das Projekt übersichtlicher.
Wird dieses Projekt nun gespeichert und im Debugger oder Player gestartet,
passiert logischerweise erst einmal gar nichts, da es keine Flow-Verbindungen
gibt und das Skript auch noch nicht existiert. Ein in der Konsole aufgerufenes
$ ps -A
verrät aber, dass jetzt ein neuer Prozess OpenIServer läuft – das ist der
Interlock-Server, welcher vom Player oder Debugger automatisch gestartet wird.
Im Inneren des Interlock-Servers
Um erfolgreich mit dem Interlock-Server kommunizieren zu können und über
diesen Steuerungsaufgaben übernehmen zu können, ist ein klein wenig Theorie
über dessen Funktionsweise nötig. Im Prinzip arbeitet der Interlock-Server
nach einigen einfachen Regeln:
- Clients (wie z. B. der OpenPlayer, Skripte, aber auch andere Programme)
können sich mit diesem verbinden.
- Clients können Daten zum Server schicken, diese werden dort gespeichert.
- Wenn ein Client neue Daten zum Server schickt oder bestehende Daten
ändert, so werden diese Daten automatisch auch zu allen anderen Clients
weitergeleitet, sodass diese von den Änderungen erfahren.
Die dritte Eigenschaft ist essentiell und ermöglicht es erst, die Logik in
eigene Skripte oder Programme auszulagern: Sobald jemand z. B. einen der
Rollladen-Buttons betätigt, wird diese Information zum Interlock-Server
gesendet. Dieser leitet sie an alle anderen Clients weiter – einer dieser
Clients wird in Kürze das Skript sein, welches auf diesem Weg erfährt, dass
ein Button betätigt wurde. Jetzt kann das Skript auf diese Aktion reagieren
und seinerseits Daten an den Server senden, um beispielsweise einen Ausgang
der Parallelschnittstelle zu schalten. Hier ist das Prinzip das Gleiche: Das
Skript sendet Daten, der Interlock-Server speichert diese und gibt sie allen
anderen Clients bekannt. Einer der Clients ist der Player, welcher diese
Daten entgegennimmt und sie beispielsweise dem Parallelschnittstellen-Plug-in
übergibt, sodass dieses einen Ausgang schalten kann.
Die Daten selbst können anhand ihres Namens unterschieden werden. Ein
Datenblock im Interlock-Server hat einen eindeutigen Namen, der sich
folgendermaßen zusammensetzt:
/[Name]/[Richtung]</#>
Der Name entspricht dem Namen, den das Objekt im Editor erhalten hat.
Richtung ist entweder „out“, wenn der Ausgang eines Elementes übertragen wird
(wie es bei den Buttons der Fall ist) oder „in“, wenn die Eingänge des
Elementes verändert werden (wie z. B. beim Displayelement oder dem
Schnittstellen-Plug-in). Der zusätzliche, optionale Parameter wird in
einigen speziellen Fällen benötigt, wenn nur ein Teil des Datenblockes
übertragen werden soll: Ein Datenblock ist komplett identisch aufgebaut wie
ein Flowelement und besitzt deswegen maximal acht Ein- oder Ausgänge, die
jeweils vom Typ digital, numerisch, Text oder binär sein können.
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Eigenschaft des Interlock-Servers
wichtig: Clients können Datenblöcke zwar anlegen, aber nicht löschen. Auch
können sie die Datentypen der acht IOs eines Datenblockes nachträglich nicht
mehr verändern. D. h. der erste Datenblock, der zum Interlock-Server gesendet
wird, legt dessen Struktur fest. Hier ist also peinlich
genau darauf zu
achten, dass diese Struktur auch wirklich zu den Flowelementen im Player
passt. Würden fälschlicherweise z. B. Binärdaten vom Interlock-Server auf
einen Digitaleingang gesendet werden, so würde der OpenPlayer (und natürlich
auch der OpenDebugger) die Annahme dieser Daten zu Recht
verweigern.
Die hier aufgestellten Behauptungen lassen sich im Debugger recht einfach
überprüfen: Dieser bietet eine Möglichkeit, den Interlock-Server zu
überwachen und alle Änderungen an den Datenblöcken anzuzeigen. Dazu ist das
Projekt – auf Grund des Zugriffs auf den Hardwareport des Parallelports –
aus einer Root-Konsole heraus mit einem
# OpenDebugger test2.apcp
zu starten. Das Datenbanksymbol im Debugger öffnet das Überwachungsfenster
für den Interlock-Server, welches vorerst noch leer ist.
Ein Klick auf das
Käfersymbol startet das Projekt, sodass die Buttons jetzt betätigt werden
können und damit den Interlock-Server beeinflussen. Jetzt wird im soeben
geöffneten Überwachungsfenster jede Änderung im Interlock-Server
protokolliert. Hierbei wird der Name des Datenblockes angezeigt sowie der
Ein- bzw. Ausgang, welcher sich verändert.
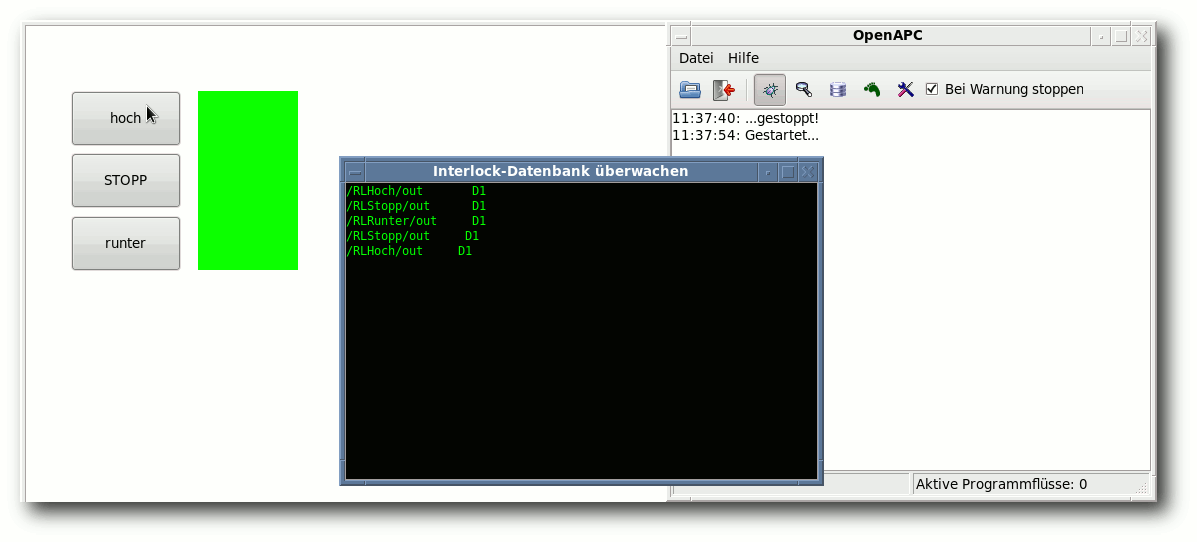
Änderungen im Interlock-Server: Das Fenster mit der grün-schwarzen Farbgebung eines Terminals überwacht diese und zeigt sie an.
Die Informationen dieses Überwachungsfensters sind recht leicht zu
interpretieren: Links steht der Name des Datenblockes, der verändert wurde,
rechts daneben dessen maximal acht Unterelemente, die den Ein- bzw. Ausgängen
des zugehörigen Flowelementes entsprechen und welche modifiziert wurden. „D“
steht hierbei für einen
digitalen Datentyp, „N“ für numerisch, „C“ für Text („Character“) und „B“ für binär. Die dahinter stehende Nummer „0..7“ zeigt
noch einmal die Nummer des veränderten Ein-/Ausganges an. So heißt die
letzte (ganz oben) angezeigte Zeile nichts anderes, als dass der
Digitalausgang 1 des Elements „RLHoch“ verändert wurde – das ist der
Ausgang, der mit jedem Klick auf den Button ein HIGH-Signal abgibt. Den Wert
des veränderten Datums kann man hier leider nicht sehen.
Das Skript in der Theorie
Mit diesen Informationen lässt sich jetzt schon recht genau festlegen, was
das Skript letzten Endes tun soll:
- Sobald der Datenblock „RLHoch“, Ausgang 1 (/RLHoch/out/1) auf HIGH gesetzt
wird, soll der Eingang 1 (/Parallelschnittstelle_5/in/1) auf LOW, der
Eingang 0 der Parallelschnittstelle „Parallelschnittstelle_5“
(/Parallelschnittstelle_5/in/0) auf HIGH und der Eingang 0 des
Anzeigeelementes „RLDisplay“ (/RLDisplay/in/0) auf HIGH gesetzt werden.
- Sobald /RLRunter/out/1 auf HIGH gesetzt wird, soll
/Parallelschnittstelle_5/in/0 auf LOW, /Parallelschnittstelle_5/in/1 auf
HIGH und der /RLDisplay/in/0 auf HIGH gesetzt werden.
- Wenn der Interlock-Server meldet, dass /RLStopp/out/1 auf HIGH geht
(Stopp betätigt), soll alles gestoppt werden, d. h. beide Eingänge 0
und 1 von /Parallelschnittstelle_5/in und Eingang 0 von /RLDisplay/in werden
auf LOW gesetzt.
Damit ist die gesamte Funktionalität abgedeckt: Einer der Buttons
hoch/runter schaltet sowohl die Anzeige in der Visualisierung als auch den
richtigen Steuerausgang an der Parallelschnittstelle; wenn der Benutzer den
Stopp-Button betätigt, werden alle Steuerausgänge sowie die Anzeige
deaktiviert.
Das Ganze nun noch in LUA oder IL (Instruction List) umzusetzen, ist mit dem
bis hier her erworbenen Wissen nur noch ein kleiner Schritt. Im Folgenden
soll dabei nur auf die Besonderheiten eingegangen werden, welche sich in den
jeweiligen Sprachen aus der Benutzung in der OpenAPC-Umgebung heraus
ergeben. LUA ist in der Tat wirklich sehr leicht zu erlernen, ist
erstklassig dokumentiert und hat auch eine große, immer hilfsbereite
Community [4], sodass detailliertere
Erklärungen den Rahmen dieses Artikels sprengen würden.
Ja, und wer sich Instruction List freiwillig antut, weiß was er macht und
worauf er sich einlässt – und kennt die IL dementsprechend auch in
ausreichender Tiefe.
Leicht und elegant – LUA
Allen OpenAPC-LUA-Skripten ist gemein, dass sie eine globale
Callback-Funktion oapc_ispace_recv_callback() definieren müssen. Diese wird
immer dann aufgerufen, wenn der Interlock-Server eine Änderung der Daten
meldet. Das heißt, hier kommen die Informationen über den Zustand der
Buttons an und müssen jeweils in einer eigenen Variablen zwischengespeichert
werden:
function oapc_ispace_recv_callback(nodeName, cmd, ios, val0, val1, val2, val3, val4, val5, val6, val7)
if (nodeName=="/RLHoch/out") then
RLHochPress=val1
elseif (nodeName=="/RLRunter/out") then
RLRunterPress=val1
elseif (nodeName=="/RLStopp/out") then
RLStoppPress=val1
end
end
Die Parameter dieser Funktion liefern dabei wichtige Zusatzinformationen:
nodeName ist der Name des Datenblocks, für den neue Werte übermittelt
werden. cmd liefert eine Information über den Grund, warum diese Funktion
aufgerufen wurde und kann für dieses Beispiel ignoriert werden, da dieser
hier immer der gleiche ist. Der Parameter ios wird in diesem Beispiel der
Einfachheit halber nicht ausgewertet, was man in realen Projekten eher nicht
tun sollte: Dieser enthält ein Bitmuster, welches angibt, welcher der
folgenden Parameter val0, …, val7 welche Art von Daten enthält (also ob dort
digitale, numerische, Text- oder Binärdaten ankommen). Das sollte
korrekterweise überprüft werden, um Skriptabbrüche zu vermeiden, weil die
Daten falsch behandelt wurden.
Die Variablen val0 bis val7 wiederum enthalten die aktualisierten Daten.
Da sich in diesem Beispiel immer nur der Ausgang 1 ändert, steht der
geänderte Wert auch immer in val1. Im Funktionsrumpf selbst wird jetzt nur
noch verglichen, ob sich ein bekannter Datenblock verändert hat.
Wenn ja
wird dessen Wert in einer globalen Variablen zwischengespeichert.
Im Hauptteil des Skriptes müssen zuerst diese Variablen initialisiert werden.
Im nächsten Schritt kann danach eine Verbindung zum Server hergestellt werden:
RLHochPress=false
RLRunterPress=false
RLStoppPress=false
if (oapc_ispace_connect("",0)==1) then
...
oapc_ispace_disconnect()
end
Eine Verbindung zum Server wird mittels
oapc_ispace_connect() hergestellt, hier mit leeren
Parametern. Optional könnten IP und Portnummer angegeben werden, welche auf
den Rechner verweisen, auf dem der Interlock-Server läuft. Da das System in
diesem Beispiel nicht in einem Netzwerk verteilt ist, sondern alles auf dem
Localhost läuft, ist das nicht erforderlich. Wird das Skript planmäßig
beendet, sollte die Verbindung zum Interlock-Server mittels
oapc_ispace_disconnect() ebenso planmäßig wieder geschlossen werden.
oapc_ispace_connect() liefert im Erfolgsfall überraschenderweise eine 1
zurück, im Fall eines Fehlers ist der Rückgabewert ein Fehlercode größer 1.
Die verbleibende Implementierung der eigentlichen Logik ist jetzt
vergleichsweise simpel:
while (true) do
if (RLHochPress==true) then
oapc_ispace_set_value("/Parallelport_5/in/1",false)
oapc_ispace_set_value("/Parallelport_5/in/0",true)
oapc_ispace_set_value("/RLDisplay/in/0",true)
RLHochPress=false
elseif (RLRunterPress==true) then
oapc_ispace_set_value("/Parallelport_5/in/0",false)
oapc_ispace_set_value("/Parallelport_5/in/1",true)
oapc_ispace_set_value("/RLDisplay/in/0",true)
RLRunterPress=false
elseif (RLStoppPress==true) then
oapc_ispace_set_value("/Parallelport_5/in/0",false)
oapc_ispace_set_value("/Parallelport_5/in/1",false)
oapc_ispace_set_value("/RLDisplay/in/0",false)
RLStoppPress=false
else
oapc_util_thread_sleep(10)
end
end
In einer Endlosschleife werden die Zustände der drei
globalen Statusvariablen RLHochPress, RLRunterPress, RLStoppPress abgefragt, die entsprechenden Daten zum Interlock Server gesendet und die
jeweilige Variable zurückgesetzt.
Die Funktion oapc_ispace_set_value() kann für alle Datentypen verwendet
werden, hier entscheidet der tatsächlich verwendete Typ des zweiten
Parameters, ob digitale, numerische Text- oder Binärdaten gesendet werden.
Der erste Parameter gibt hier den Datenblock und die Nummer des
Eingangs an, der verändert werden soll, deswegen wird hier die erweiterte Bezeichnung
des Blockes mit der zusätzlich
angehängten Nummer zur Identifizierung
verwendet.
Das war dann auch schon die gesamte Implementierung: Sobald der OpenPlayer
läuft, kann dieses Skript aus der Konsole heraus mit einem
$ luaPLC test2.lua
gestartet werden und steuert ab sofort den Ablauf.
Nun noch ein Wort zur Funktion oapc_util_thread_sleep(). Diese
bietet eigentlich nichts OpenAPC-spezifisches, erweitert LUA jedoch um etwas
Wichtiges, was dieser Sprache leider fehlt: eine Pause. An dieser Stelle
werden immer dann 10 Millisekunden Pause eingelegt, wenn keine
Benutzereingaben vorhanden sind und das Skript deswegen eigentlich nichts
tun muss. Diese Pause verhindert, dass das Skript in dieser Endlosschleife
die gesamte Rechenleistung aufbraucht.
Das SDK der OpenAPC-Software [5] enthält
übrigens auch ein funktionierendes LUA-Beispielskript, welches ebenfalls die
OpenAPC-spezifischen Spracherweiterungen vorführt.
Feels like Assembler – IL
Die Instruction-List (oder auf Deutsch auch
Anweisungsliste [6] nutzt eine
assemblerähnliche Syntax, bei der ein Akkumulator existiert, in den Werte
geladen werden können, mit dem anschließend (Rechen-)Operationen
durchgeführt werden können, dessen Inhalt für Vergleiche und bedingte
Sprünge herangezogen werden kann und anderes mehr. Die IL des
OpenAPC-Interpreters erweitert die Sprache dabei zum einen um einige
Befehle, die nicht dem Standard entsprechen, sowie um Möglichkeiten der
Variablendeklaration, wie sie eigentlich nur vom Structured-Text
(strukturierter Text [7]) her
bekannt sind.
Diese Erweiterungen erleichtern die Arbeit mit IL enorm und werden auch
herangezogen, um die Verbindung zum Interlock-Server herzustellen.
Normale globale Variablendeklarationen werden in dieser Form der IL-Sprache
in einem Block
VAR_GLOBAL
Variablenname : Typ
END_VAR
vorgenommen. Für die Verbindungen zum Interlock-Server wurden bei dieser
Syntax Anleihen genommen. So kann in einem eigenen Block definiert werden,
welche Variablen direkt vom Interlock-Server beeinflusst werden:
MAP_IS0
Variablenname : Typ : Datenblockname
END_MAP
Achtung: Das letzte Zeichen in MAP_IS0 ist die Zahl „Null“ und nicht der
Buchstabe „O“! Hier ist der Interpreter offenbar für Verbindungen zu
mehreren Interlock-Servern vorbereitet worden, allerdings lässt sich das
bisher noch nicht nutzen.
Für die Rollladensteuerung werden jetzt unter Verwendung dieses Blockes
mehrere Variablen auf die Ein- und Ausgänge
des Interlock-Server gemappt:
MAP_IS0
RLHochPress : BOOL : /RLHoch/out/1
RLRunterPress : BOOL : /RLRunter/out/1
RLStoppPress : BOOL : /RLStopp/out/1
RLDisplay : BOOL : /RLDisplay/in/0
RLPort0 : BOOL : /Parallelport_5/in/0
RLPort1 : BOOL : /Parallelport_5/in/1
END_MAP
Hier sind links die Variablennamen zu finden, die später im Skript verwendet
werden sollen. Als Datentyp ist für alle BOOL festgelegt, da es sich um
digitale Ein- bzw. Ausgänge handelt, die jeweils nur einen der beiden
Zustände HIGH (=TRUE) oder LOW (=FALSE) einnehmen können. Dahinter sind die Namen der Datenblöcke und deren Ein-/Ausgänge zu finden, denen
diese Variablen zugeordnet werden. Mit dieser Deklaration ist die logische
Verknüpfung mit den Datenblöcken des Interlock-Servers vollständig:
Ändert sich einer der hier festgelegten Datenblöcke während des Ablaufes im
Interlock-Server, ändert sich automatisch auch gleich der Inhalt der
zugehörigen Variablen. In der Hauptschleife muss also lediglich die
jeweilige Variable zyklisch abgefragt werden.
Folgende Aufrufe sind im Skript erforderlich:
IS0C
JMPCN L_exit
...
L_close:
IS0D
L_exit:
EXIT
Damit wird die Verbindung zum Interlock-Server hergestellt und am Programmende
auch wieder geschlossen.
Das Kommando IS0C (auch hier ist das dritte Zeichen wieder eine Null) stellt
die Verbindung zum Server her. Schlägt die Operation fehl, ist der
Akkumulator anschließend FALSE, was mit dem bedingten Sprung zum
Programmende behandelt wird. IS0C stellt hier immer eine Verbindung zum
Localhost her, netzwerkübergreifende Steuerungen mittels IL sind zumindest
in der aktuellen Version 1.2 noch nicht möglich.
Das Gegenstück zum Öffnen der Verbindung findet sich weiter unten: IS0D
(auch hier wieder mit einer Zahl im Namen) trennt eine bestehende Verbindung
zum Interlock-Server.
Der Rest der Implementierung ist eigentlich reine IL-Programmierung unter
Verwendung der oben gemappten Variablen. Der Einfachheit halber soll hier
nur die Behandlung eines einzelnen Zustandes gezeigt werden, die Codeblöcke
für die Behandlung der Buttons für „Runter“ und „Stopp“ funktionieren ähnlich:
L_start:
LD RLHochPress
JMPCN L_rlrunter
LD FALSE
ST RLPort1
LD TRUE
ST RLPort0
ST RLDisplay
LD FALSE
ST RLHochPress
L_rlrunter:
...
JMP L_start
Der Wert der Variablen „RLHochPress“ – der über den Umweg
MAP_IS0 Pfeil rechts Interlock Server Pfeil rechts OpenPlayer
den Zustand des Buttons für „Hoch“ reflektiert
– wird in den Akku geladen. Wurde der Button nicht gedrückt (d. h. der Wert
ist FALSE), wird zu L_rlrunter und damit zur Abfrage des nächsten Buttons
gesprungen. Wurde er betätigt, so werden die Ausgänge der
Parallelschnittstelle über den Umweg der Variablen RLPort0 und RLPort1 sowie
das Displayelement über die Variable RLDisplay entsprechend gesetzt.
Anschließend wird der Zustand der Button-Variablen RLHochPress auf FALSE
gesetzt, sodass beim nächsten Durchlauf erkannt werden kann, ob der Button
erneut betätigt wurde.
Diese letzte Operation ist allerdings ein wenig kritisch: In dem Moment, in
dem RLHochPress auf FALSE gesetzt wird, wird nicht nur die Skript-lokale
Variable, sondern auch der entsprechende Datenblock im Interlock-Server
verändert. In diesem Beispiel hat das keine Auswirkungen, da
das Skript nur den Button-Zustand überwacht und da sich der
Button im Player nicht rückwärts über seinen Ausgang beschreiben und damit
ändern lässt. Problematisch wäre das allerdings dann, wenn mehrere Skripte
zum Einsatz kämen, die alle den Button-Zustand und damit das gleiche
Datenblockelement überwachen. Hier könnte es passieren, dass abhängig vom
Timing einige Skripte die Betätigung des Buttons nicht mehr sehen, da ein
anderes Skript dessen Zustand zu schnell wieder auf LOW gesetzt hat.
Ausgeführt wird das fertige Skript, nachdem der Player gestartet wurde, mit
einem Aufruf
$ ilPLC -f test.il
aus der Konsole heraus. Hier ist der Pfad zum IL-Skript mit der Option -f zu übergeben.
Ist das alles?
Auch wenn der Artikel sich an dieser Stelle seinem Ende nähert: Nein, das
ist noch lange nicht alles. Die beiden hier beleuchteten Möglichkeiten zur
Kommunikation mit dem Interlock-Server und damit zur Steuerung eines mit der
OpenAPC-Software aufgesetzten Systems sind für all diejenigen, die lieber
mit Hochsprachen programmieren, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
So existiert auch noch eine Beispielimplementierung in Java, welche
ebenfalls die Kommunikation mit dem Interlock-Server ermöglicht und
demonstriert. Auch bietet die mitgelieferte Bibliothek liboapc
umfangreiche Schnittstellen zur Kommunikation mit dem Server und damit zur
Steuerung eines OpenAPC-Projektes. Somit können alle Sprachen (wie z. B. C
und C++) verwendet werden, welche in irgendeiner Form die Möglichkeit
bieten, auf die Funktionen einer solchen Bibliothek zuzugreifen.
Sämtliche Varianten sind im englischsprachigen Handbuch des SDK ausführlich
beschrieben, auch liefert das SDK fertige Beispiele
mit [5].
Abschließend noch ein paar Worte an diejenigen, die bei dem Wort und bei der
Beschreibung des „Interlock-Server“ auch immer an
„OPC-Server“ [8] denken
mussten: Nein, diesen Standard beherrscht der Interlock-Server nicht.
Einerseits ist vorstellbar, dass dies in einer der kommenden Versionen noch
implementiert wird, andererseits ergibt sich ein logisches Problem. Der
OPC-Standard nutzt mit (D)COM reine Microsoft-Technologien, welche unter
Linux nicht existieren. Mit einer der letzten Aktualisierungen der
OPC-Spezifikation wurde dieser Misstand zwar endlich beseitigt, sodass nach
dem neuesten Stand auch eine rein TCP/IP-basierende Implementierung möglich
ist, allerdings ist dessen Bedeutung und Verbreitung noch immer sehr gering.
Hier bleibt also nach wie vor die Frage, welcher Standard sich für
plattformübergreifende Systeme wie die OpenAPC-Software durchsetzen wird. So wie sich die Weiterentwicklung der OpenAPC-Software
bisher zeigt, wird sie diesen Standard dann sicher auch umsetzen.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-01
[2] http://www.lua.org/
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherprogrammierbare_Steuerung
[4] http://www.lua.org/community.html
[5] http://www.openapc.com/download.php
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Anweisungsliste
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturierter_Text
[8] http://de.wikipedia.org/wiki/OLE_for_Process_Control
| Autoreninformation |
| Hans Müller
ist als Elektroniker beim Thema Automatisierung mehr
der Hardwareimplementierung zugeneigt als dem Softwarepart und hat
demzufolge auch schon das ein oder andere Gerät in der privaten
Wohnung verkabelt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle Jeder Computernutzer, der in seiner Freizeit schon einmal
programmiert oder erste Programmierversuche unternommen hat, hat
sich wahrscheinlich schon selbst einmal die Frage gestellt: „Wie
würde ein Programmierprofi wohl dieses Programm schreiben?“ Bei der
Antwort auf diese Frage kann das Buch „Coders at work – Reflections
on the craft of programming“ helfen.
Wie der Titel schon andeutet, handelt das Buch von Programmierern
bei der Arbeit, sprich der Softwareentwicklung. Dabei wird aber
nicht der Alltag eines Berufsprogrammierers beschrieben. Vielmehr
hat der Autor des Buches, Peter Seibel, selbst erfahrener
Programmierer und Buchautor, 15 verschiedene Programmierer zum Thema
Programmierung und Softwareentwicklung interviewt. Nach welchem
Schema die Interviewpartner ausgewählt wurden, ist nicht weiter
erläutert, allerdings deckt die Auswahl ein breites Spektrum an
Anwendungen (z. B. Programmiersprachenentwicklung, Compiler und
Optimierung, Anwendungssoftware und Webanwendungen) ab,
ebenso
schreiben die Interviewpartner ihre Software in diversen Sprachen
(z. B. C, C++. Java, JavaScript, Haskell, Erlang und Lisp). Die
Interviewpartner sind allesamt durchaus „bekannte“ Programmierer,
auch wenn sie natürlich nicht unbedingt den Bekanntheitsgrad eines
Mark Shuttleworth, Bill Gates oder auch Larry Walls haben. Zu den
bekannteren im Buch vorkommenden Personen dürften in erster Linie
Ken Thompson (Miterfinder von C) und Donald Knuth (Autor von „The
Art of Computer Programming“, ein Grundlagenwerk der IT-Literatur,
und Erfinder des Satzsystems TeX) gehören. Nicht minder interessant
sind aber auch die Interviews mit z. B. Peter Norvig („Director of
Research“ bei Google), Brendan Eich (CTO Mozilla Coperation und
„Erfinder“ von JavaScript) oder Joe Armstrong („Vater“ von Erlang).
Da einige der interviewten Personen schon sehr lange programmieren,
teilweise seit den späten 1950er bzw. früher 1960er Jahren, führt das
Buch den Leser ganz nebenbei auf einen Streifzug durch die Geschichte der
Programmierung und der frühen Computerhardware. Weiterhin sind drei der
Programmierer zum Zeitpunkt des Interviews bei Google angestellt
gewesen, sodass man ebenfalls einen kleinen Einblick in die
Arbeitsweise von Google in Sachen Programmierung und
Programmentwicklung erhält. So erfährt man auf diesem Wege z. B.
auch, dass Ken Thompson, einer der wahrscheinlich erfahrensten
C-Programmierer, keinen Code bei Google einchecken darf – eben weil
er in C und nicht C++ programmiert. Apropos C++: Auch wenn das Thema
„Vorlieben und Abneigungen bei Programmiersprachen“ in keinem der
Interviews explizit angesprochen wird, so kommt in mehreren
Interviews klar heraus, dass C++ nicht unbedingt als beliebte
Programmiersprache bei den Interviewpartnern gilt.
Wie bereits erwähnt, enthält das Buch ausschließlich Interviews.
Diese sind alle individuell auf den Gesprächspartner zugeschnitten
und folgen keinen festgelegtem Schema; der Autor geht an vielen
Stellen auf die zuvor gemachten Aussagen des Interviewten ein. Dabei
gelingt es immer, dass einer kurzen Frage eine ausführliche und
informative Antwort folgt. Einige Fragen tauchen natürlich in den
meisten Interviews auf, wie z. B. „Wann hast du angefangen zu
programmieren?“, „Wie gehst du beim Debugging vor?“ oder „Woran
erkennst du einen guten Programmierer?“. Diese Fragen werden aber
immer geschickt in den Verlauf und den Kontext des Interviews
eingebunden, sodass die Frage an der entsprechenden Stelle immer
passend erscheint. Alle Interviews sind im lockeren „Plauderton“
geführt, sodass die entspannte Atmosphäre während der Befragung
beim Lesen quasi greifbar ist.
Das Buch ist komplett auf Englisch, der überwiegende Teil der
Interviewpartner – ebenso wie der Autor – sind dabei Amerikaner bzw.
englischsprachig. Entsprechend sind viele Fragen und Antworten
in umgangssprachlichen Englisch gehalten. „Schulenglisch“ reicht zum Lesen
und Verständnis des Buches wohl eher nicht aus. Wer jedoch beruflich
oder in seiner Freizeit Englisch spricht, sollte auch bei der Lektüre
des Buches keine Probleme haben.
Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Das Buch ist kein Lehrbuch,
es ist sogar recht weit von einem Lehrbuch entfernt. So kommt im
ganzen Buch keine einzige Zeile Programmcode vor noch werden
irgendwelche Algorithmen zur Lösung spezifischer Probleme diskutiert
oder vorgestellt. Es geht wirklich alleine um die persönliche
Arbeitsweise, Erfahrung und Einschätzung der interviewten Personen.
Insofern wird man durch das Lesen des Buches mit Sicherheit kein
besserer Programmierer. Aber man kann sich durchaus inspirieren
lassen und von der Erfahrung dieser „Programmierprofis“ profitieren.
Kurz gesagt: Wer sich für Programmierung an sich interessiert und
Literatur zu diesem Thema jenseits des Fach-/Lehrbuchs sucht, dem
kann „Coders at work“ durchaus empfohlen werden.
| Buchinformationen |
| Titel | Coders at work – Reflection on the craft of programming |
| Autor | Peter Seibel |
| Verlag | Apress, 2009 |
| Umfang | 632 Seiten |
| ISBN | 978-1-4302-1948-4 |
| Preis | ca. 20,- Euro |
| |
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle
programmiert in seiner Freizeit zwar
primär in Python, interessiert sich aber trotzdem allgemein für
Programmierung und Programmiersprachen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
Für Leserbriefe steht unsere E-Mailadresse
 zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
Leserbriefe und Anmerkungen
Bottle – Ein WSGI-Microframework für Python
->
Vielen Dank für den Artikel über Bottle. Das Framework war mir
bereits bekannt, jedoch habe ich mir nie Zeit dafür genommen, die
englische Dokumentation durchzuarbeiten. Aus diesem Grunde kam mir
ihr Artikel sehr gelegen, da er alle wichtigen Funktionen kurz
anschneidet und exemplarisch dazu jeweils ein Code-Ausschnitt
vorgestellt wird. Auch das Interview mit Marcel Hellkamp fand ich
sehr interessant.
Es wäre schön, wenn freiesMagazin auch einmal über andere Python-Frameworks
wie das im Artikel angesprochene Flask oder Werkzeug schreiben
würde. Hierzu wäre auch ein Interview mit dem jeweiligen Entwickler
(bei Flask und Werkzeug wäre der Entwickler der ebenfalls
deutschsprachige Armin Ronacher) eine gute Abrundung eines solchen
Artikels.
Michael Eder
<-
Der Autor des Artikels, Jochen Schnelle, hat mit denen von Ihnen
vorgeschlagenen Programmen leider wenig bis gar nicht gearbeitet,
weshalb er dazu auch keinen Artikel schreiben kann. Vielleicht
findet sich aber unter unseren anderen Lesern jemand, der zu den
Anwendungen etwas schreiben kann.
Und dann ergibt sich vielleicht auch ein Interview mit Armin
Ronacher, der in der deutschen Ubuntu-Community ja kein Unbekannter
ist, und so vielleicht zu einem kurzen Gespräch überredet werden kann.
Dominik Wagenführ
VirtualBox und KVM
->
Unter Ubuntu 10.10 Desktop amd64 existiert die Gruppe vboxusers nicht. Installiertes Paket: virtualbox-ose in
Version 3.2.8-dfsg-2ubuntu1. Wenn ich
# adduser BENUTZER vboxusers
ausführe (natürlich mit meinem Benutzernamen), kommt die Ausgabe
adduser: Die Gruppe vboxusers existiert nicht.
Mit der neuen Version von VirtualBox (4.0.2 der proprietären
Variante) unter dem selben System (Ubuntu 10.10 […])
funktioniert der adduser-Befehl. Allerdings zerstört er bei jedem
Log-in meine GNOME-Einstellungen für das Erscheinungsbild …
Gast (Kommentar)
<-
Wenn das virtualbox-ose-Paket die Gruppe nicht anlegt, wird
es wohl ein Bug im Paket sein. Die „offiziellen“ Pakete legen die
Gruppe aber korrekt an.
Und von dem Schreiben eines Artikels bis zur Veröffentlichung in freiesMagazin
vergeht immer etwas Zeit, sodass es – wie bei VirtualBox – schon eine
neue Version gibt.
Wenn diese nicht wie gewünscht funktioniert, empfehle ich einen
Bugreport an die Teams von Ubuntu und VirtualBox. Denn nur wenn
diese etwas davon mitbekommen, wird es auch eine Fehlerkorrektur
geben. ;-)
Hauke Goos-Habermann
Bildformat SVG verstehen
->
Der Artikel ist als Grundlage gut, was m. E. aber definitiv fehlt, ist
zumindest ein minimalistisches Beispiel, wie man eine SVG-Grafik in
einen Webseite einbindet. Ganz am Ende kommt zwar der Hinweis auf
w3schools, aber deren Seite ist nicht wirklich übersichtlich (und
auf Englisch).
Jochen Schnelle (Kommentar)
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gegebenenfalls zu
kürzen. Redaktionelle Ergänzungen finden sich in eckigen Klammern.
Die Leserbriefe kommentieren
Zum Index
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Sie kennen eine Linux-Messe, welche noch nicht auf der Liste zu
finden ist? Dann schreiben Sie eine E-Mail mit den Informationen zu
Datum und Ort an .
Zum Index
.
Zum Index
freiesMagazin erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats. Die April-Ausgabe wird voraussichtlich am 3. April unter anderem mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Eine Einführung in die Programmiersprache Pike
- Das Textverarbeitungssystem LyX
- OpenDocument-Format für den Datenaustausch
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
|
| Erscheinungsdatum: 6. März 2011 |
|
|
| Redaktion |
| Frank Brungräber | Thorsten Schmidt |
| Dominik Wagenführ (Verantwortlicher Redakteur) |
| |
| Satz und Layout |
| Ralf Damaschke | Yannic Haupenthal |
| Nico Maikowski | Matthias Sitte |
| |
| Korrektur |
| Daniel Braun | Stefan Fangmeier |
| Mathias Menzer | Karsten Schuldt |
| Stephan Walter | |
| |
| Veranstaltungen |
| Ronny Fischer |
| |
| Logo-Design |
| Arne Weinberg (GNU FDL) |
| |
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie
freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor.
freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren. Das
freiesMagazin-Logo
wurde von Arne Weinberg erstellt und unterliegt der
GFDL.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei
Randall Munroe.
Zum Index
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 9 Mar 2011, 17:39.