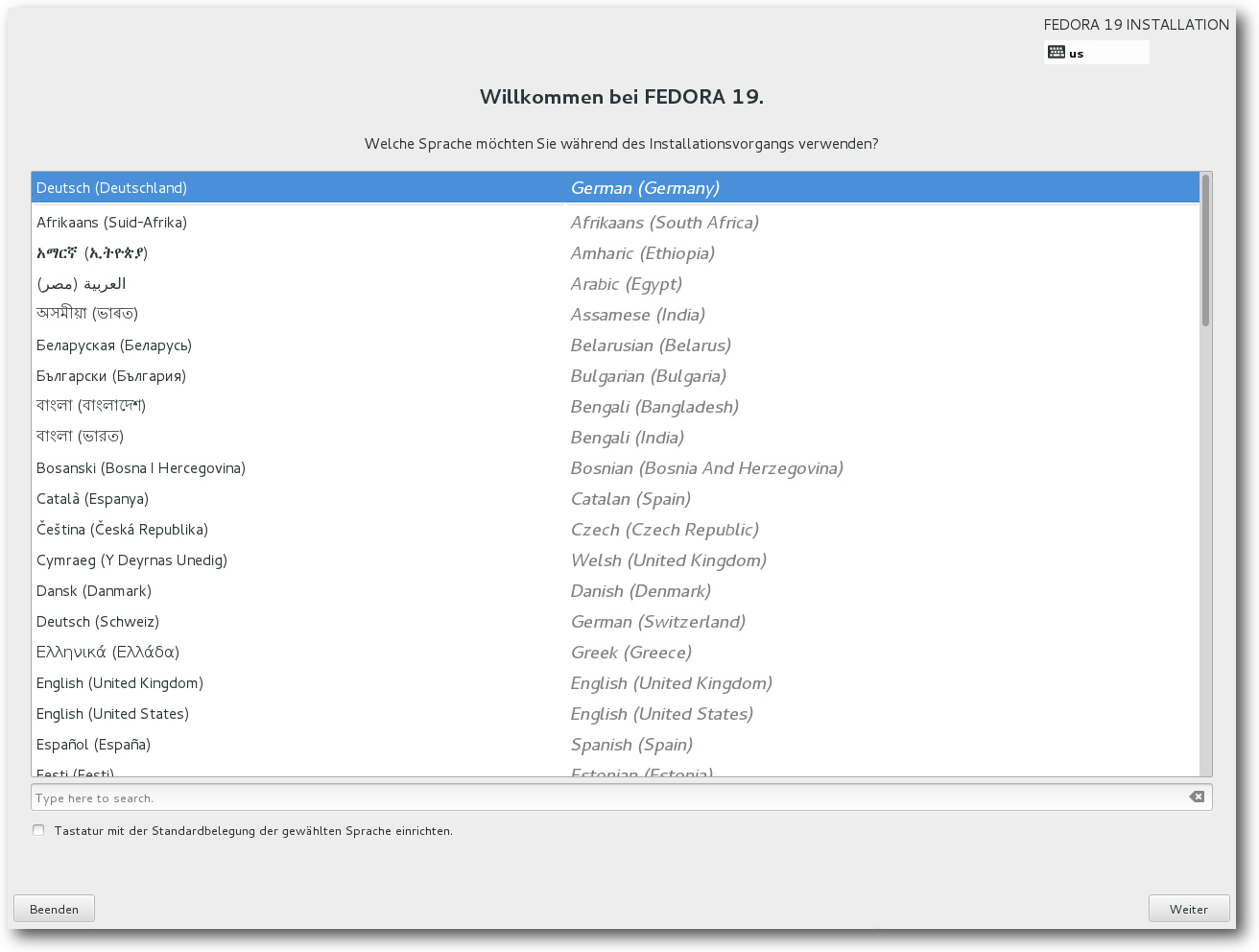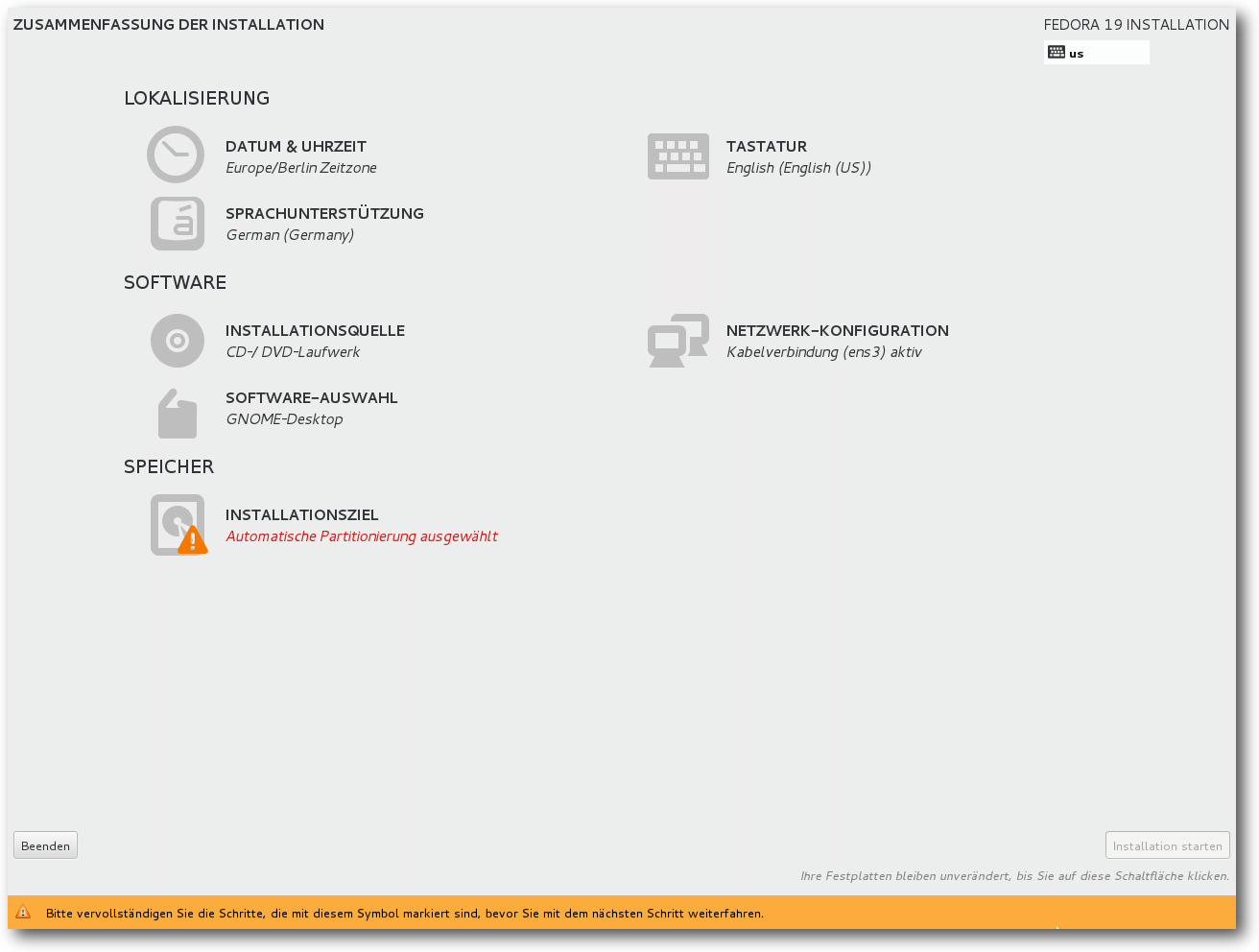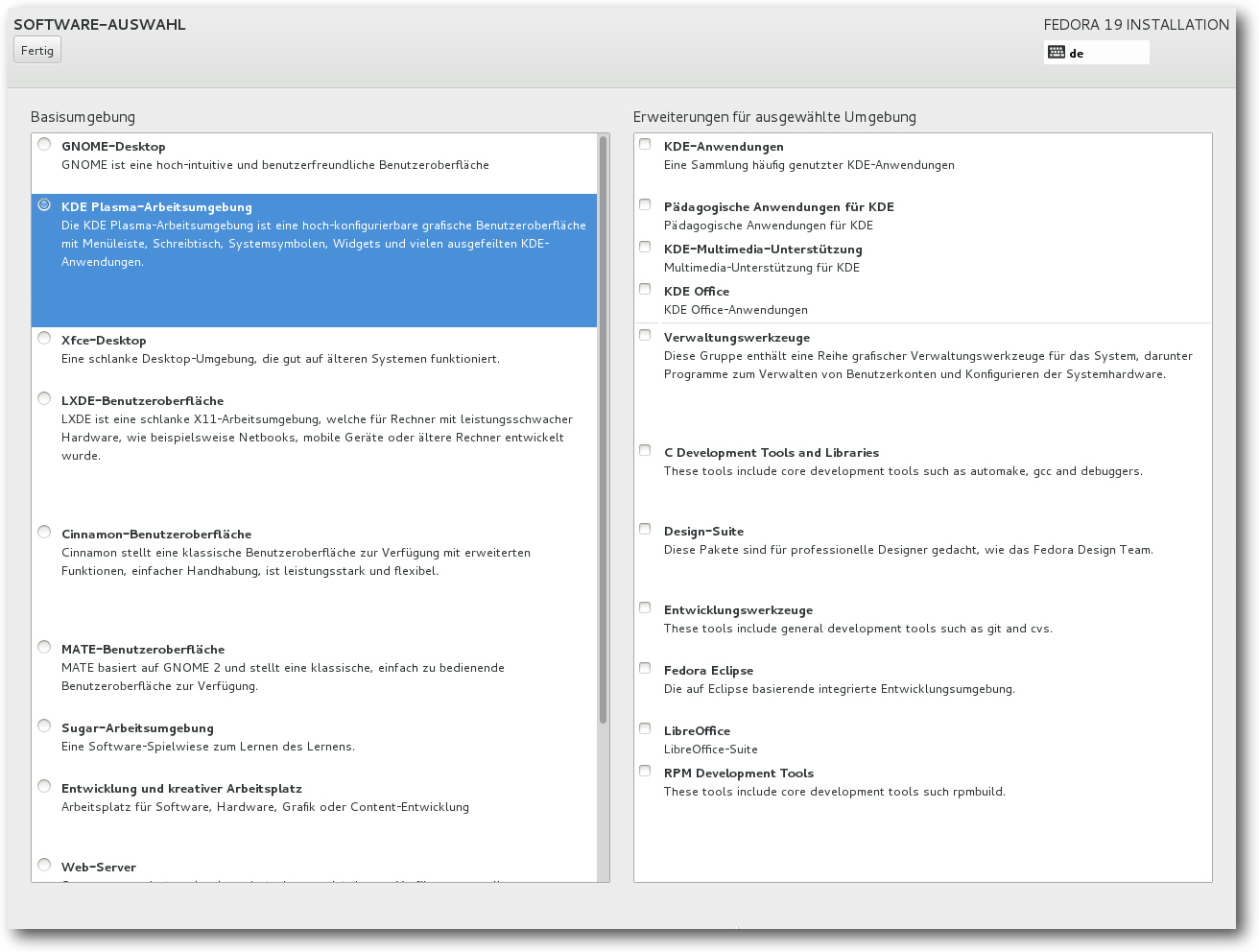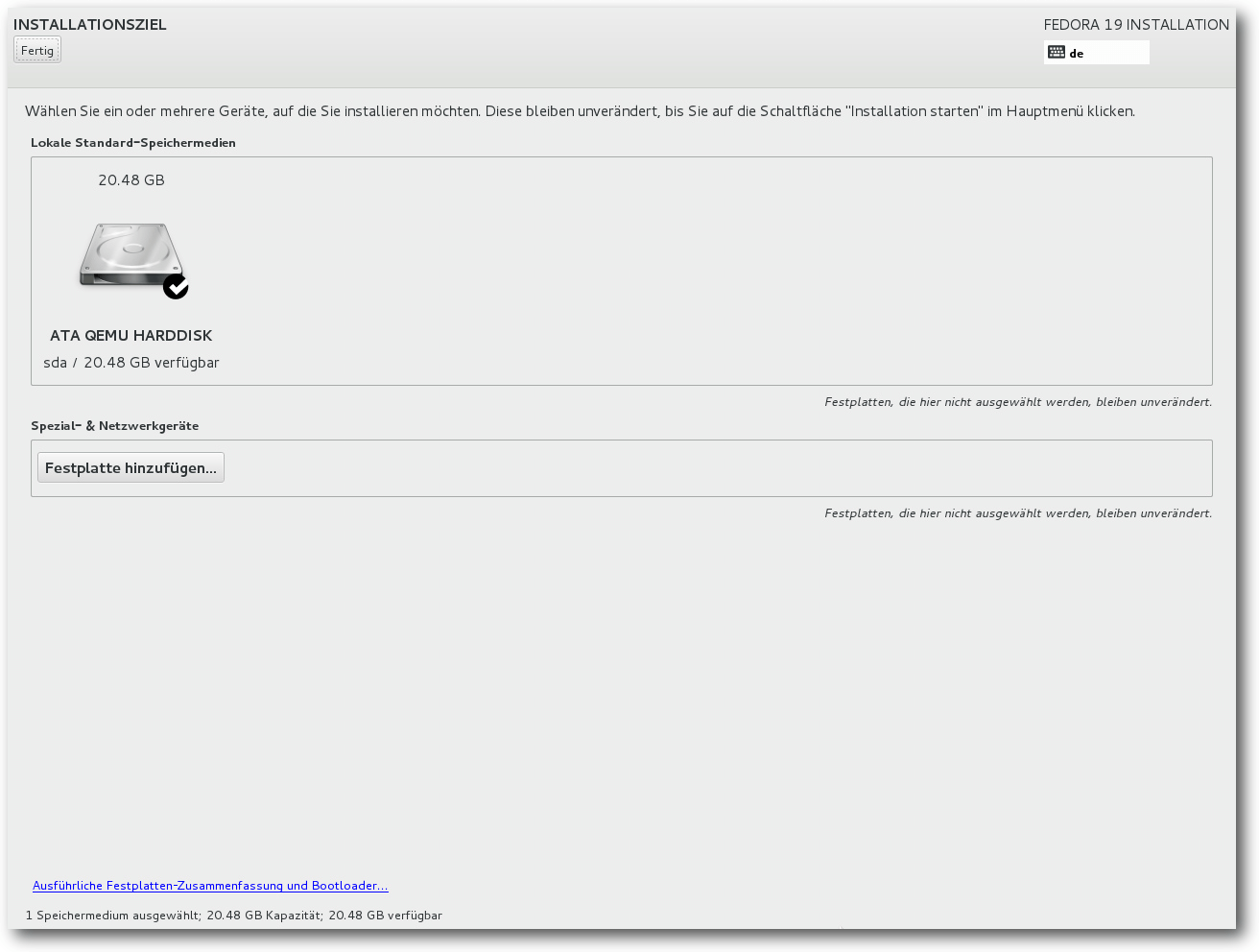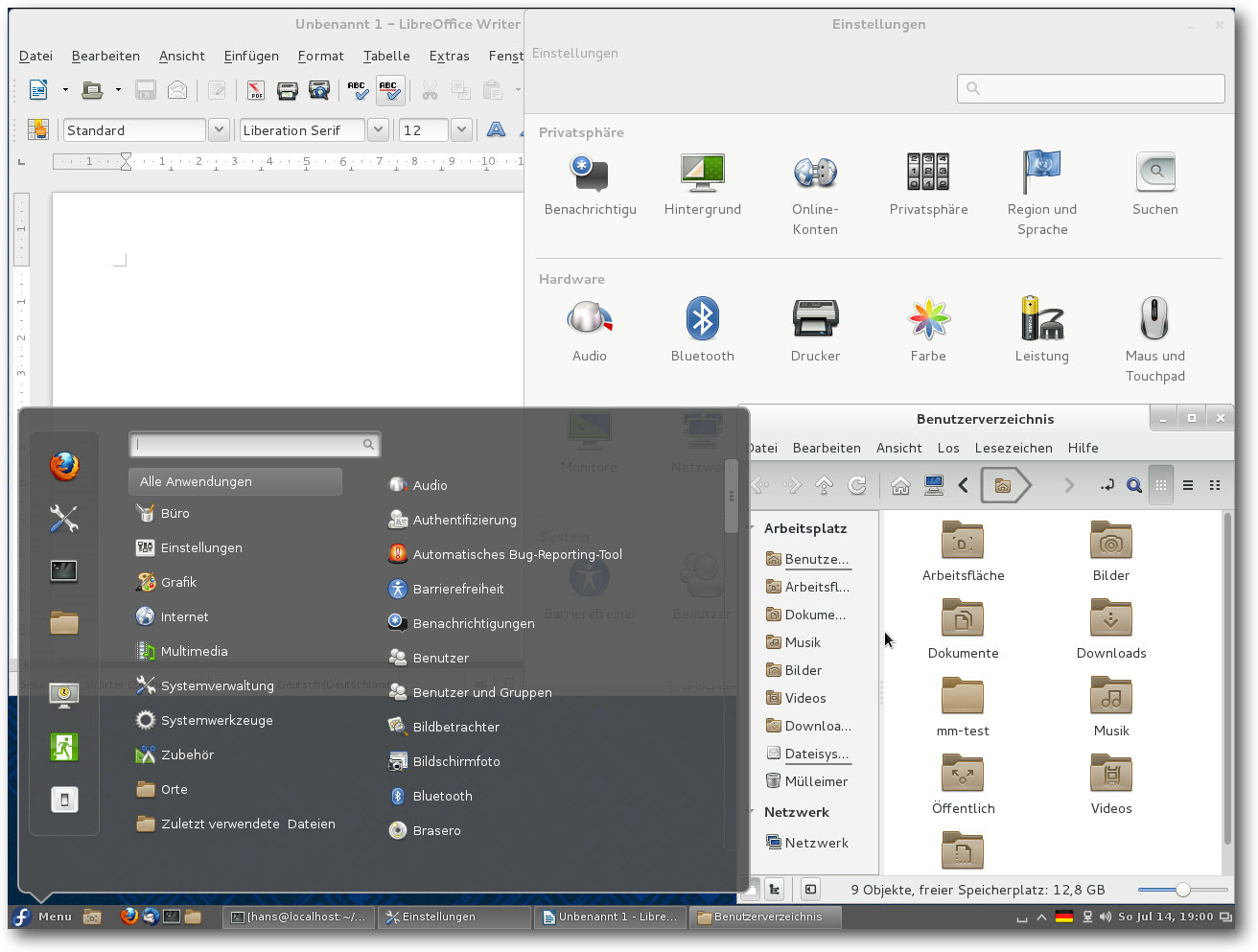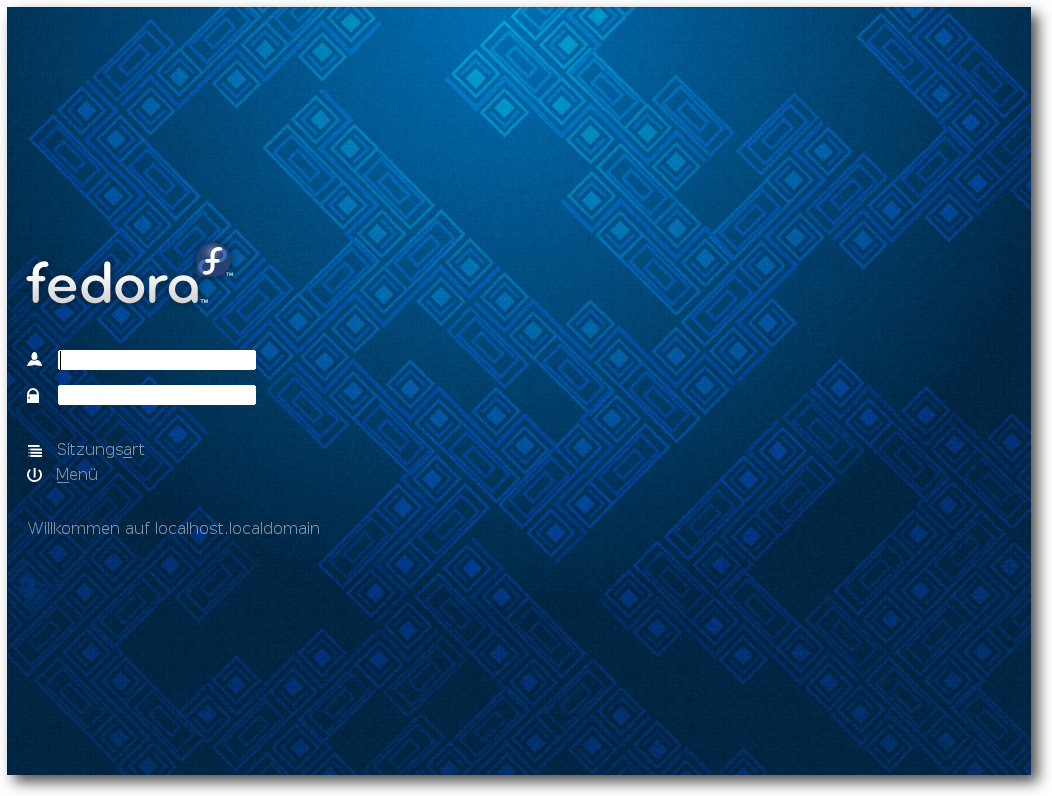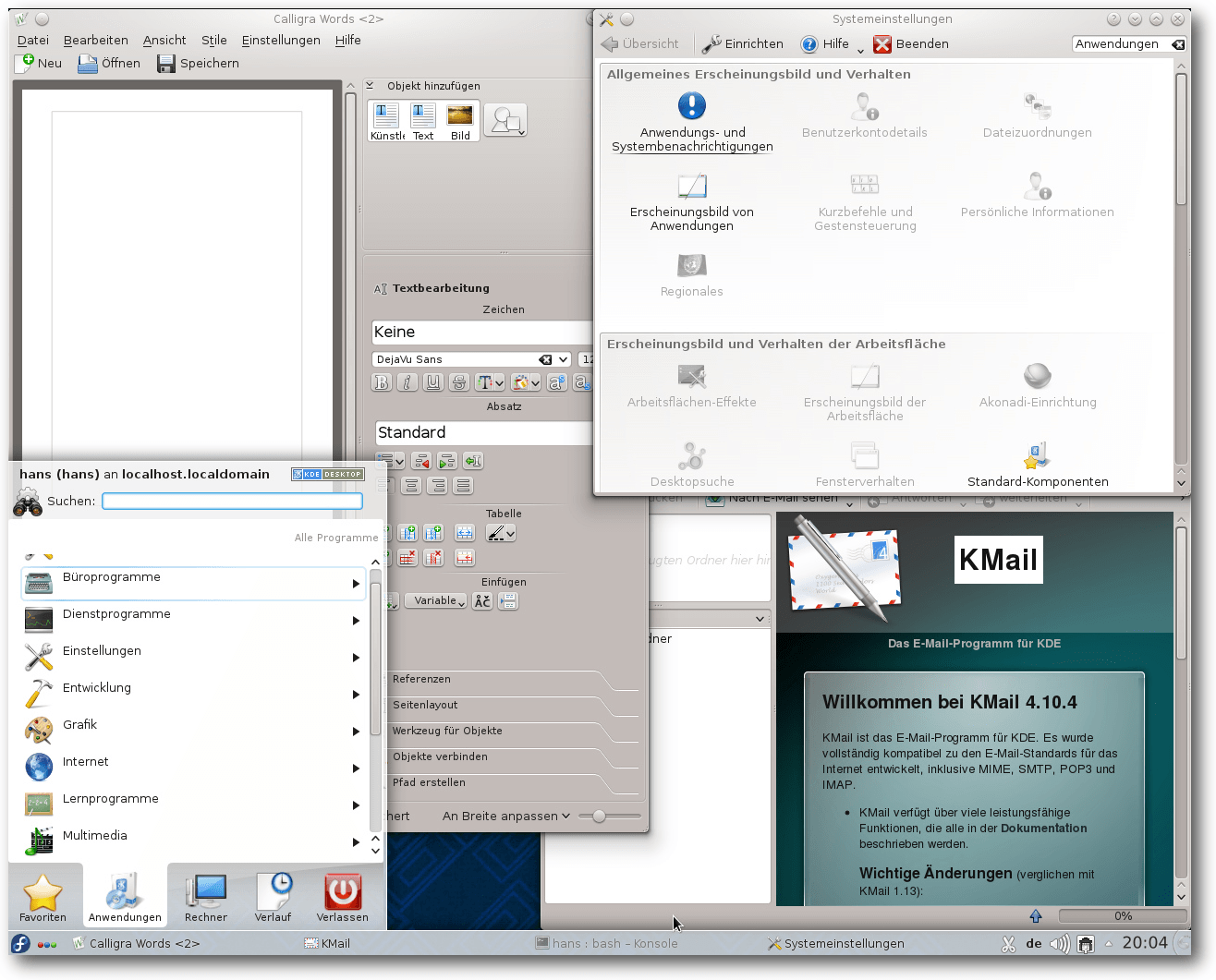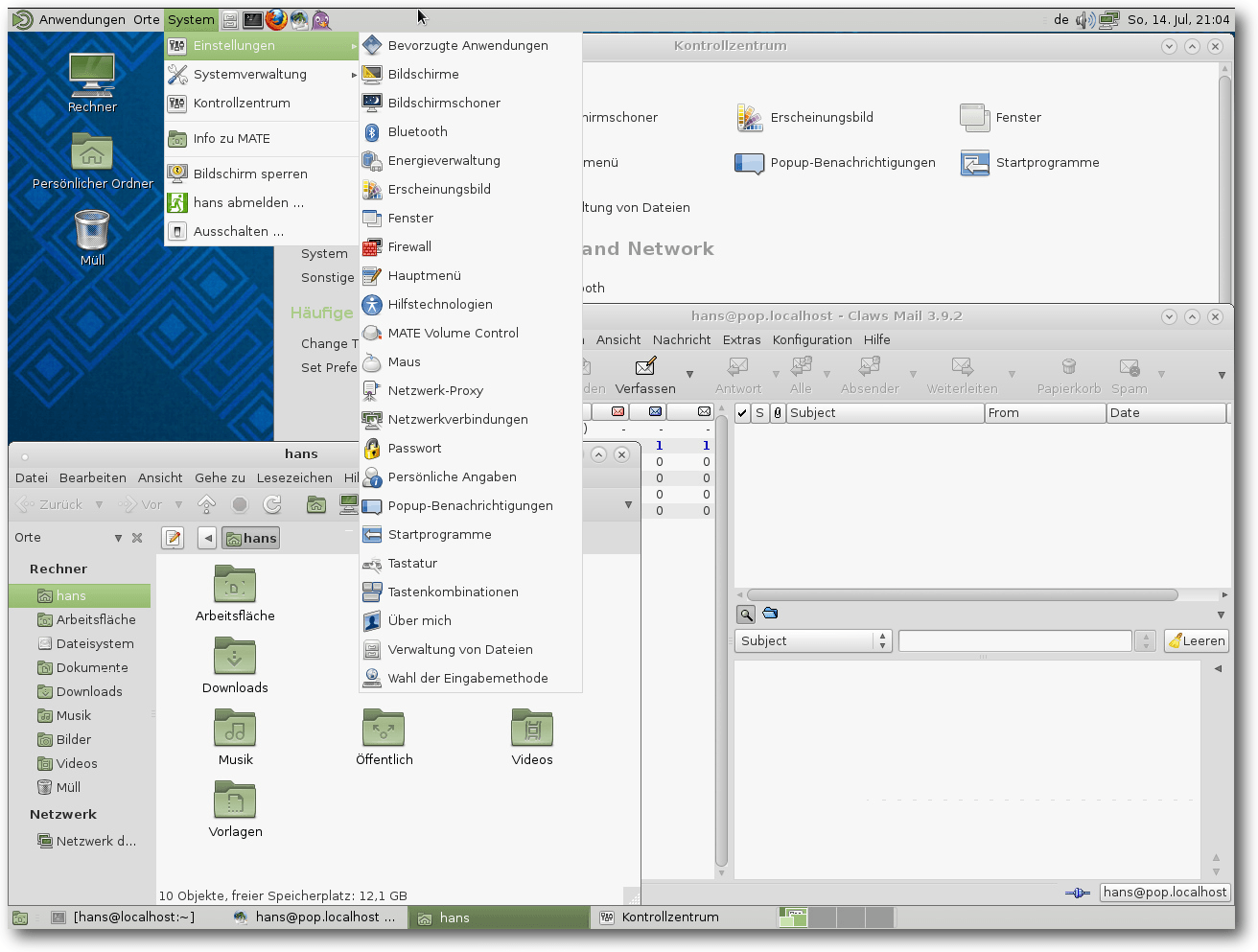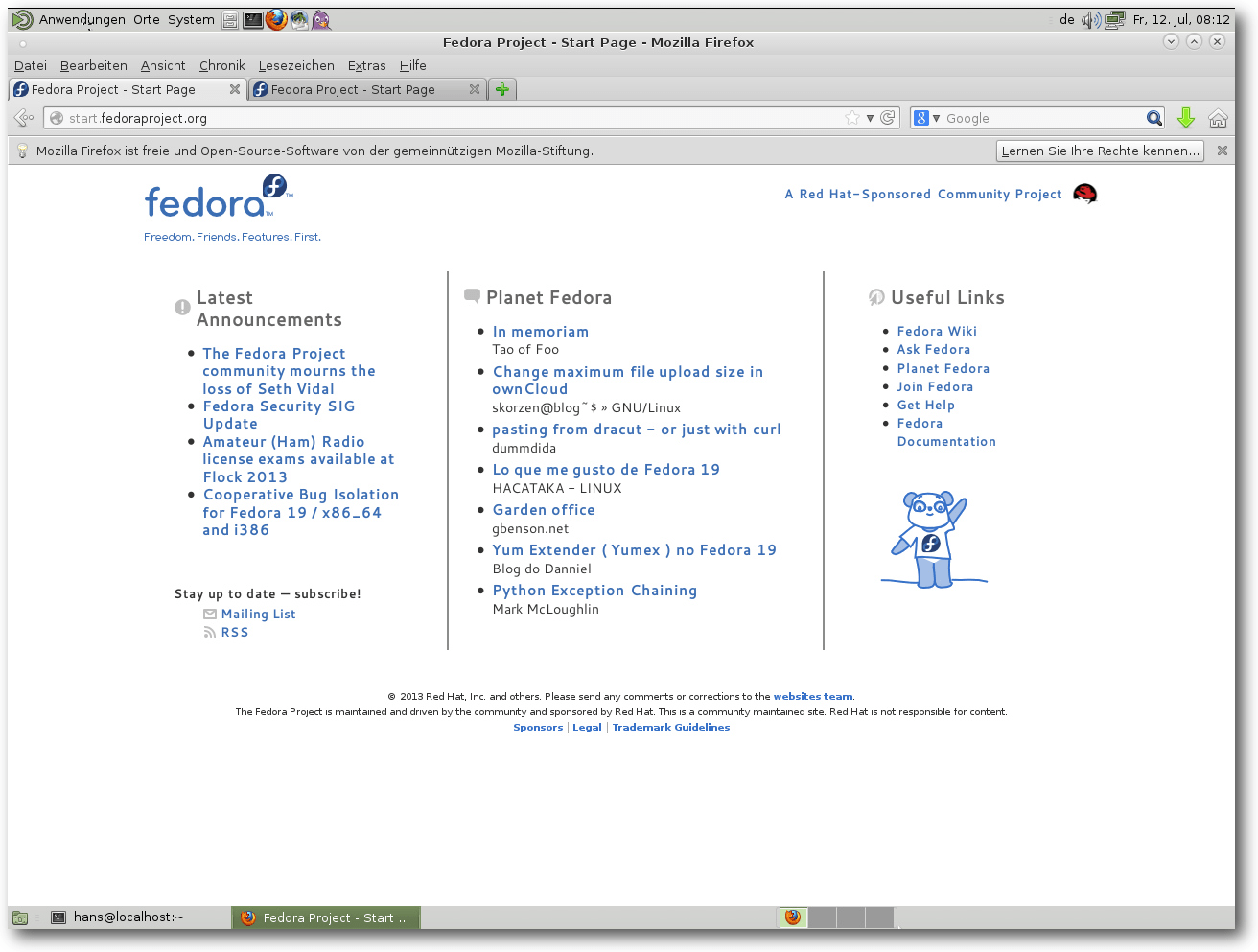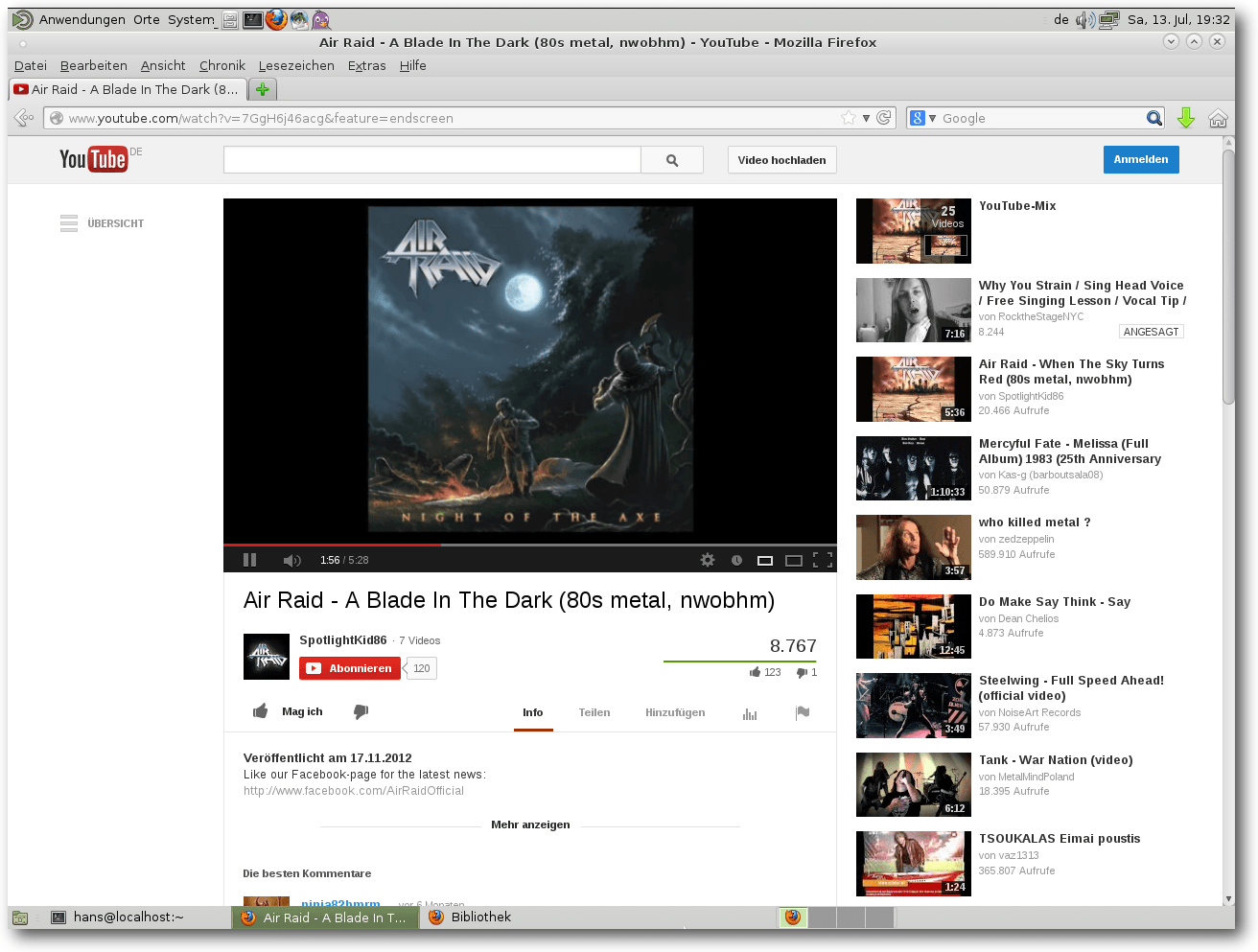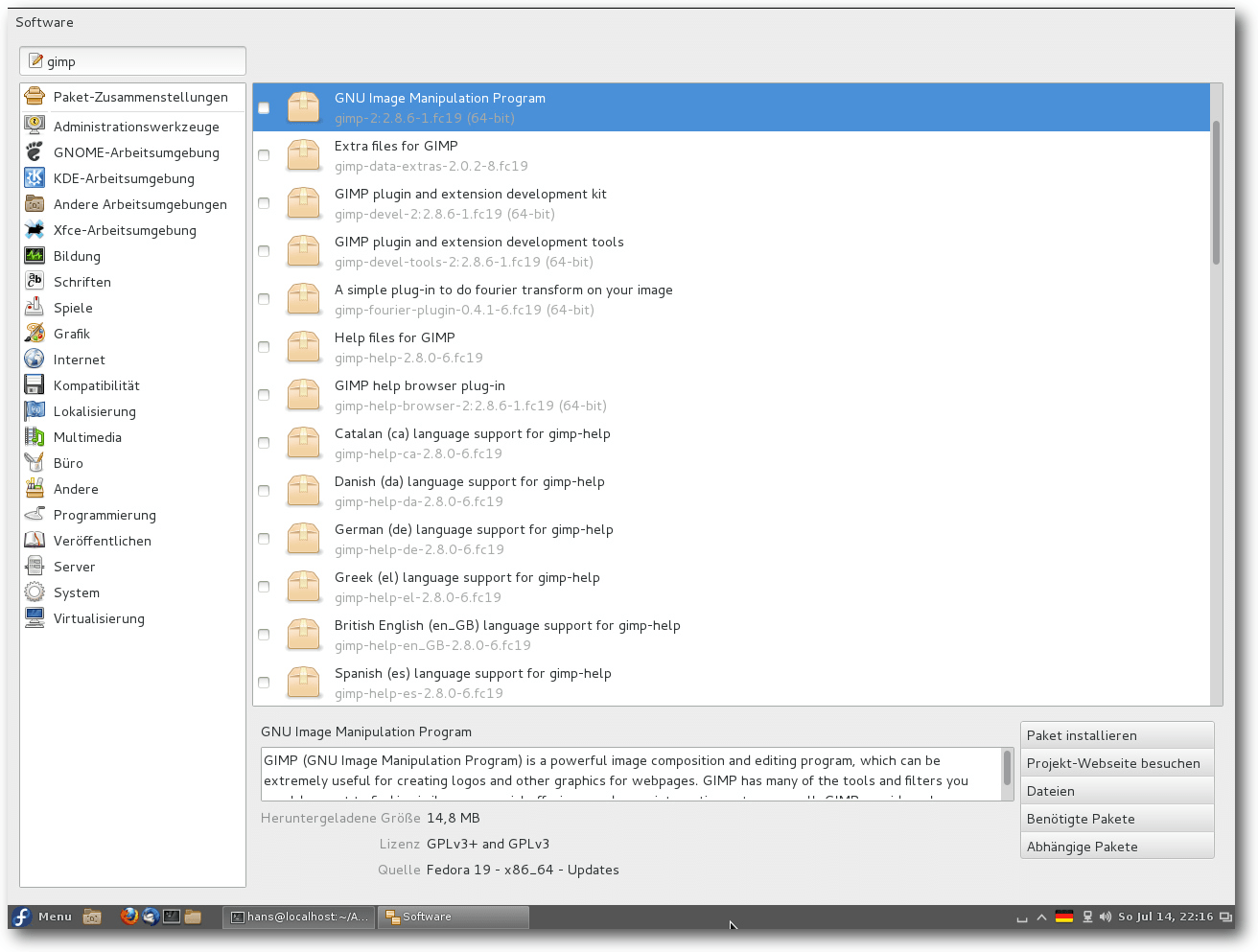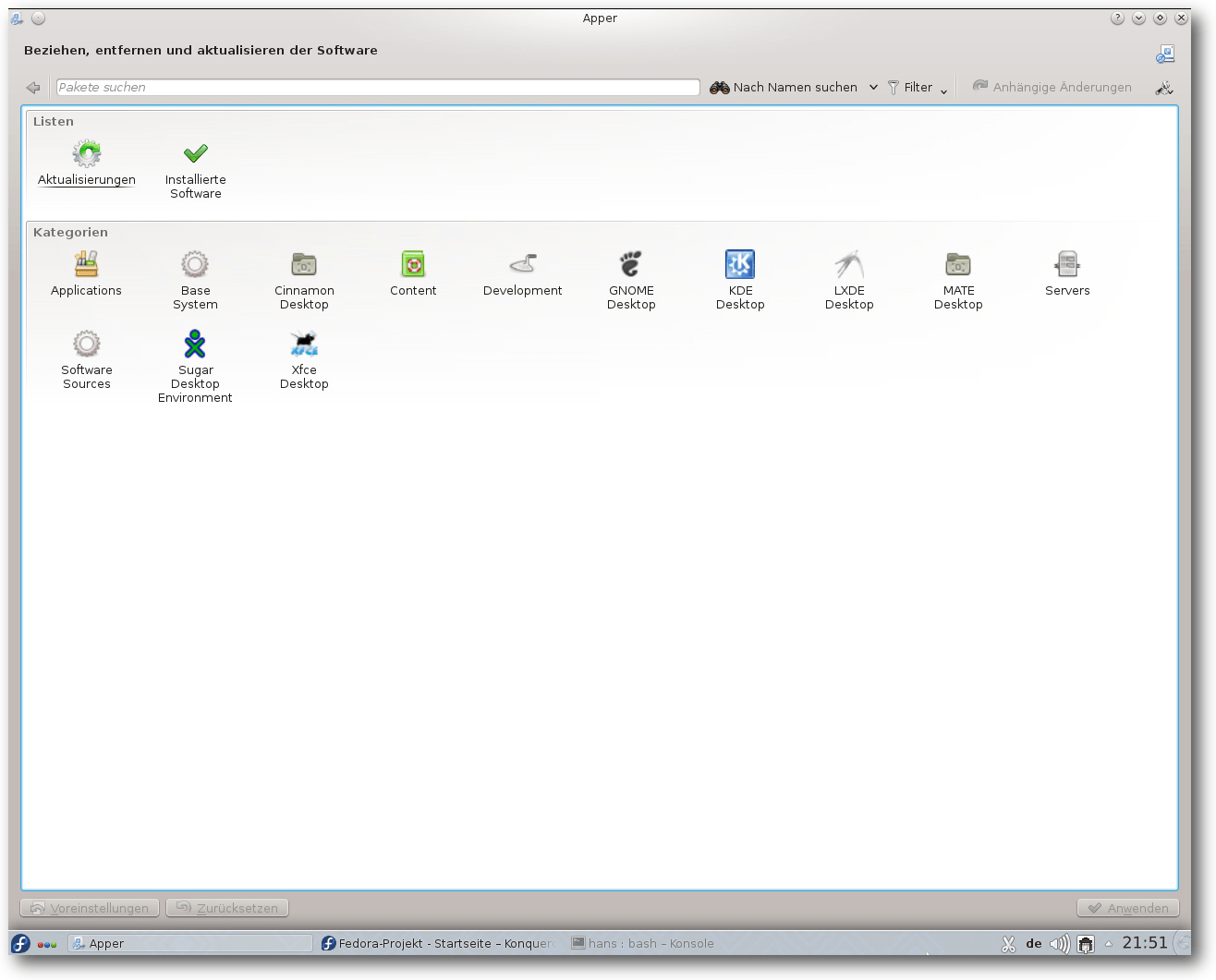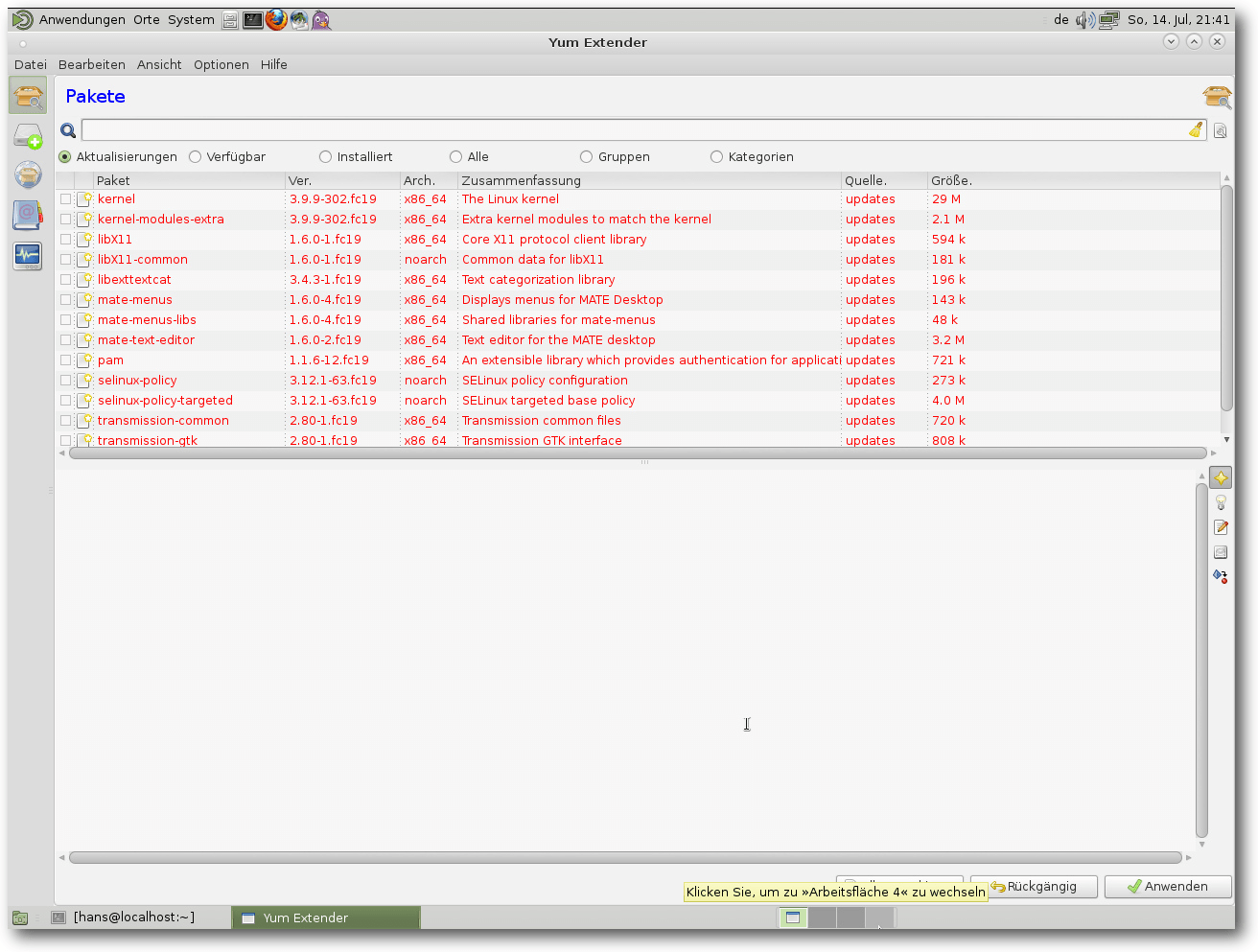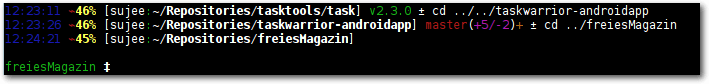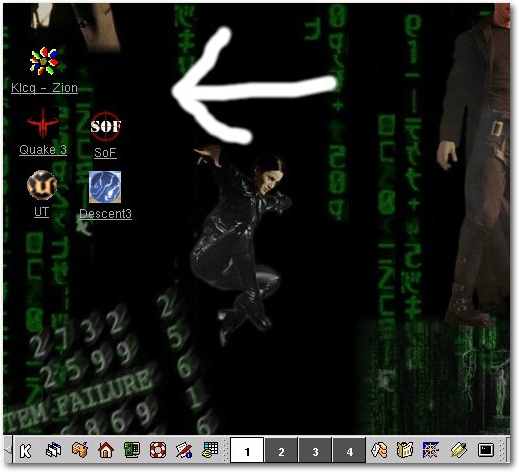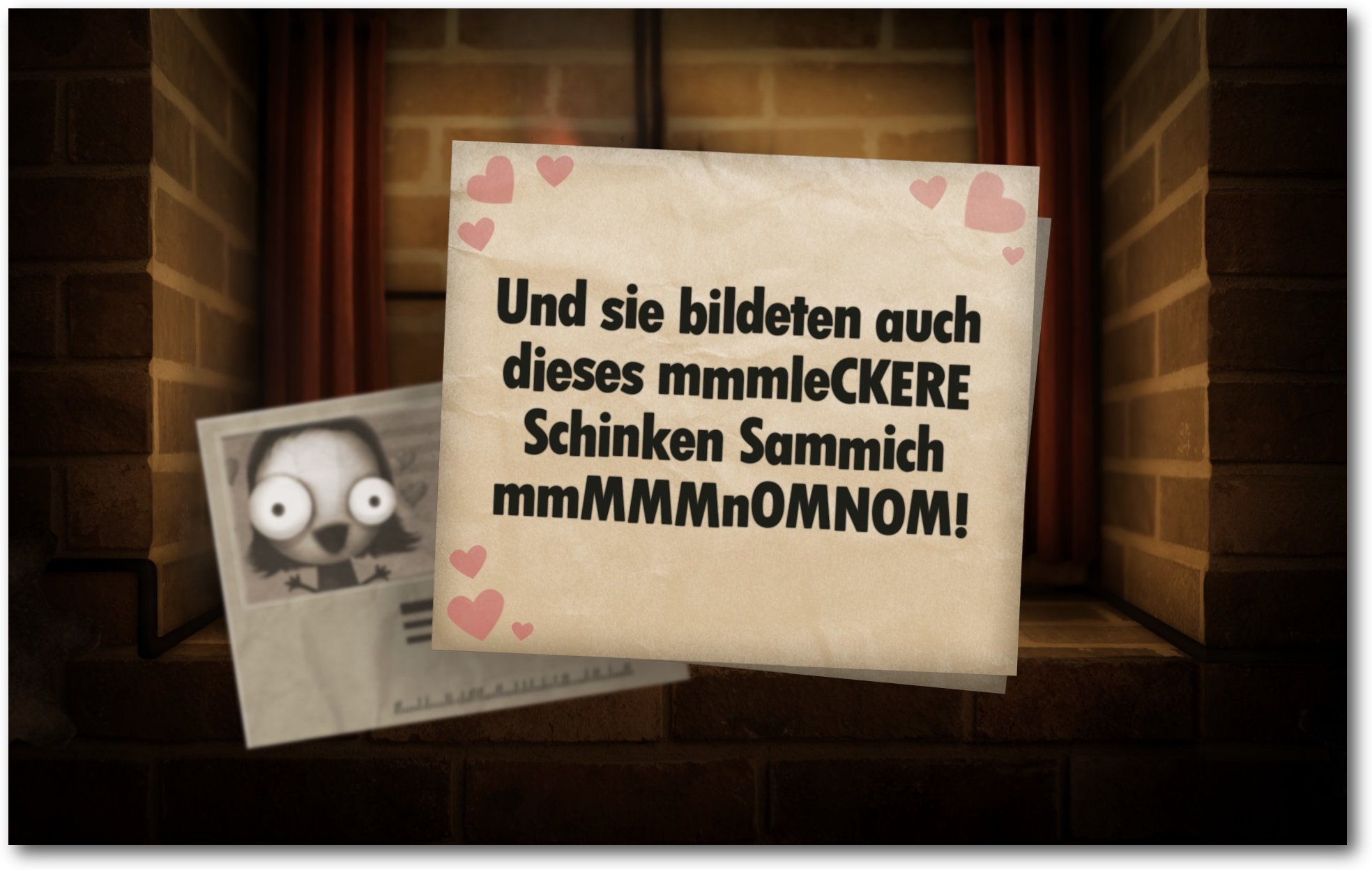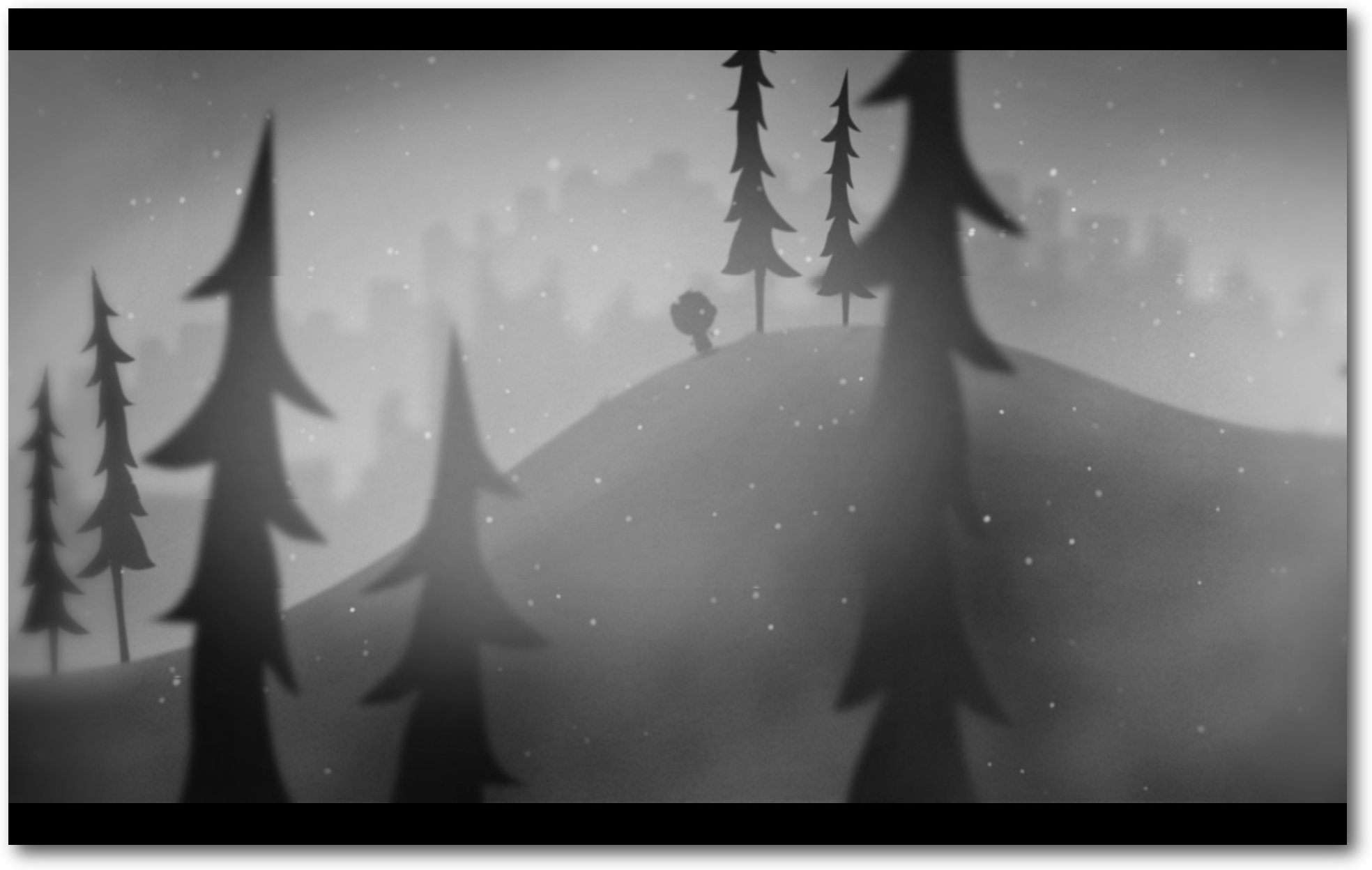Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin September 2013
(ISSN 1867-7991)
Fedora 19
Fedora 19 enthält eine Vielzahl von Neuerungen, von denen die wichtigsten im Laufe des Artikels erwähnt und, soweit möglich, auch ausprobiert werden. Hauptsächlich wird auf die Desktopumgebungen Mate und KDE eingegangen. Auf GNOME, das ohne Hardware-3D-Beschleunigung nur auf sehr schnellen Rechnern noch akzeptabel läuft, wird verzichtet, stattdessen wird ein Blick auf Cinnamon riskiert, das jedoch leider das gleiche Problem hat. (weiterlesen)
Steam
Passt ein Artikel über Steam überhaupt in dieses Magazin? Gerade weil Valve mit Steam für Linux nicht nur positives Feedback erhalten hat, sollen die Vor- und zu einem Teil auch die Nachteile zum anstehenden zehnten Geburtstag als Diskussionsgrundlage dargestellt werden. Vor allem an der Frage, ob Steam der Linux-Community eher hilft oder schadet, scheiden sich die Geister. (weiterlesen)
Little Inferno
Es ist kalt im Land, sehr kalt. Seit Jahren schon schneit es vom Himmel herab und will gar nicht mehr aufhören. Dicke Wocken hängen über der Stadt und lassen die Sonne nicht mehr erscheinen. Aber glücklicherweise gibt es ja „Little Inferno Entertainment Fireplace”, den tollen, neuen Kamin fürs Wohnzimmer. Einfach den Katalog durchstöbern, Dinge bestellen und im Kamin verbrennen – und schon wird einem warm ums Herz. Das ist Little Inferno, das Spiel! (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Fedora 19
Der August im Kernelrückblick
Anleitungen
960-Grid-System – Eine CSS-Bibliothek
Software
Liquid prompt – Eine erweiterte Prompt
Steam – Fluch oder Segen?
Little Inferno
Community
Rezension: Einführung in Python 3
Rezension: Rapid Android Development
Rezension: Android 4 - Praxisbuch
Magazin
Editorial
Leserbriefe
Veranstaltungen
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Neuer Programmierwettbewerb
Zum Ende des Jahres gibt es bei freiesMagazin immer einen Programmierwettbewerb –
jetzt schon im fünften Jahr. Da Organisator Dominik Wagenführ sich nicht
einig werden kann, welche Aufgabe es dieses Jahr werden soll, gibt es
diesmal vorab eine Abstimmung.
Aufgabe 1: Las Vegas
Vorlage für die Aufgabe ist das Spiel „Las Vegas” von Alea. Es spielen zwei
Spieler gegeneinander. Auf dem Tisch liegen 6 Kasinos mit
unterschiedlichen Geldbeträgen. Jeder Spieler erhält 8 Würfel plus 4
neutrale (weiße) Würfel. Die Spieler würfeln abwechselnd alle Würfel. Sie
gruppieren diese nach Augenzahl und lege alle Würfel einer Augenzahl
(egal, ob Spielerfarbe oder neutral weiß) auf das Kasino mit
entsprechender Nummer. Wenn alle Würfel ausgelegt sind, wird gewertet. Der
Spieler mit den meisten Würfeln erhält den Geldschein mit dem höchsten
Wert, der zweite mit dem zweithöchsten etc. Bei Gleichstand bekommt keine
Partei etwas. Hat weiß die Mehrheit, geht der Schein an die Bank.
Aufgabe ist es, einen Bot für diese Aufgabe zu schreiben. Die
Taktik-Anforderungen sind sehr gering, der Programmieraufwand ggf. etwas
höher.
Aufgabe 2: Tron Lightcycle Race
In dem Sci-Fi-Film Tron gibt es auch sogenannte „Light Cycle Races“
(Lichtrennen).
Die Aufgabe wäre es, ein Lichtrennen zu programmieren, in dem zwei Bots
gegeneinander antreten. An Befehlen gibt es nur Rechts, Links oder
Geradeaus. Jede Runde bewegt sich der Bot automatisch ein Feld vorwärts.
und hinterlässt einen Lichtschweif. Fährt man in den eigenen oder den
eines Gegners, hat man verloren. Ziel des Spiels ist es also, den Gegner
einzukreisen und ihm den möglichen Spielraum zu nehmen. Wenn Zeit besteht,
würde der Wettbewerb noch um eine Boost-Option und eine Rakete erweitert
werden.
Die Taktik- und Programmier-Anforderungen sind bei Tron recht hoch.
Abstimmung
Jeder kann bei der Umfrage mitmachen, wobei wir nach (potentiellen)
Wettbewerbsteilnehmern und normalen Lesern, die Interesse am Wettbewerb
haben, unterscheiden wollen. Zusätzlich können natürlich auch eigene Ideen
für eine Programmieraufgabe angebracht werden. Die Abstimmung [1]
läuft bis zum 8. September 2013.
Der Wettbewerb selbst wird vermutlich erst wieder im Dezember starten, da
der Organisator zuvor bis Oktober ausgelastet ist.
Und nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/20130825-welche-aufgabe-soll-beim-naechsten-programmierwettbewerb-gestellt-werden
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Hans-Joachim Baader
Fedora 19 [1] enthält
eine Vielzahl von Neuerungen, von denen die wichtigsten im
Laufe des Artikels erwähnt und, soweit möglich, auch ausprobiert werden.
Hauptsächlich wird auf die Desktopumgebungen Mate und KDE eingegangen. Auf
GNOME, das ohne Hardware-3D-Beschleunigung nur auf sehr schnellen Rechnern noch
akzeptabel läuft, wird verzichtet, stattdessen wird ein Blick auf Cinnamon
riskiert, das jedoch leider das gleiche Problem hat.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Fedora 19“ erschien erstmals bei
Pro-Linux [2].
Überblick
Wie immer sei angemerkt, dass es sich hier nicht um einen Test der
Hardwarekompatibilität handelt. Es ist bekannt, dass Linux mehr Hardware
unterstützt als jedes andere Betriebssystem, und das überwiegend bereits im
Standard-Lieferumfang. Ein Test spezifischer Hardware wäre zu viel Aufwand für
wenig Nutzen. Falls man auf Probleme mit der Hardware stößt, stehen die
Webseiten von Fedora zur Lösung bereit.
Da eine Erprobung auf realer Hardware nicht das Ziel des Artikels ist, werden
für den Artikel drei identische virtuelle Maschinen, 64 Bit, unter KVM
mit
jeweils 1 GB RAM verwendet.
Installation
Fedora kann von DVD, Live-CDs oder minimalen Bootmedien installiert werden.
Natürlich kann man aus einem ISO-Image auch ein USB-Medium für die Installation
erstellen. Die Live-CDs, die es in den Varianten GNOME, KDE, LXDE und Xfce sowie
einigen weiteren Spins gibt, sind aufgrund ihres geringen Umfangs eher eine
Notlösung für die Installation, denn es fehlen dann unter anderem LibreOffice
und Übersetzungen. Zwar erfolgt die Installation binnen Minuten, da hierbei
offenbar mehr oder weniger nur ein
Abbild der CD auf die
Platte geschrieben
wird, aber für normale, vollständige Installationen sind die DVD oder das
minimale Image vorzuziehen, bei dem die eigentliche Distribution über das Netz
installiert wird.
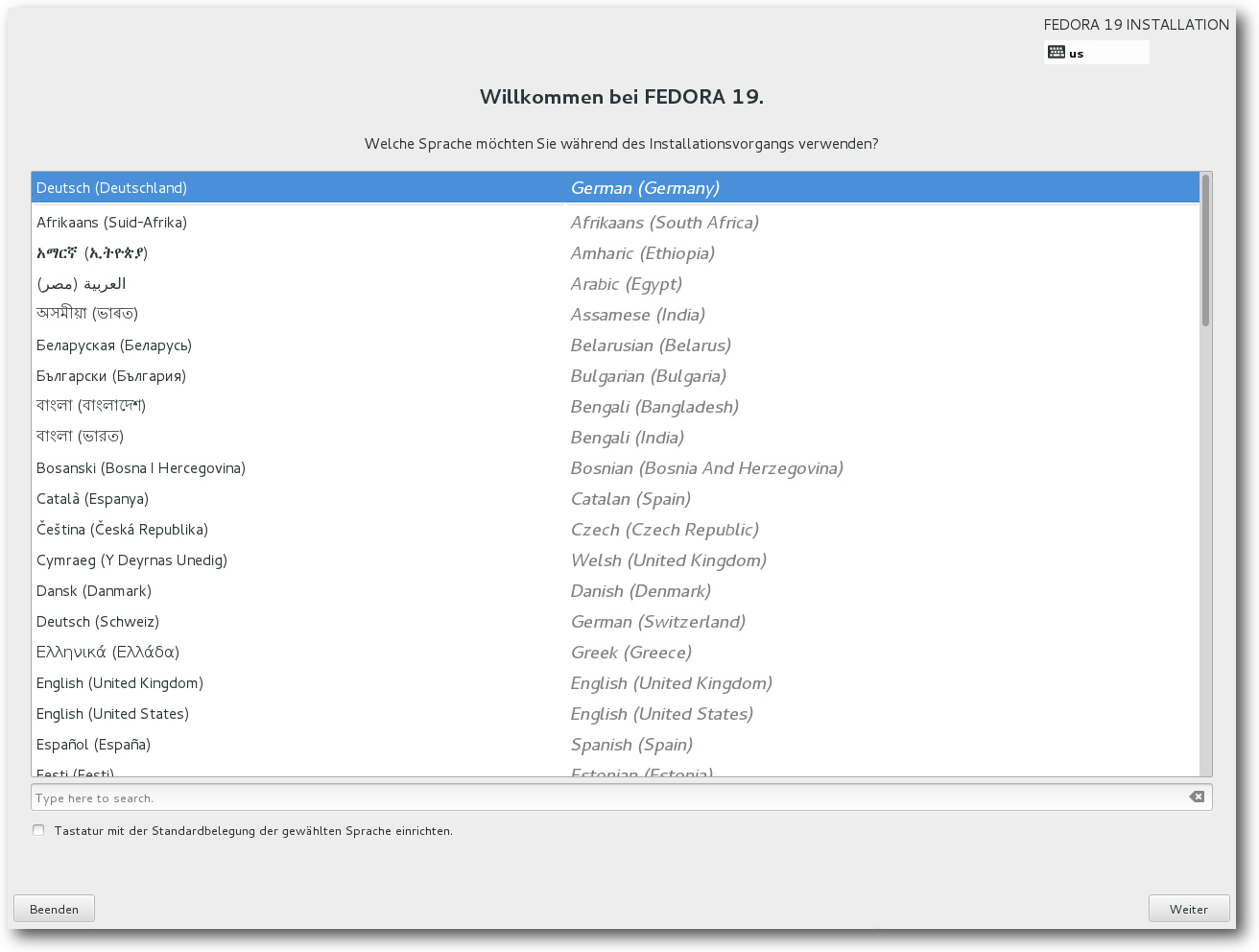
Sprachauswahl auf der Boot-DVD.
Die Installation von Fedora erfordert mindestens 786 MB RAM, wie schon in
Version 18. Mit weniger als 768 MB ist die Installation noch mit Einschränkungen
möglich. Für den Betrieb wird mehr als ein GB empfohlen, was aber allenfalls für
ziemlich alte Rechner zu einem Problem wird.
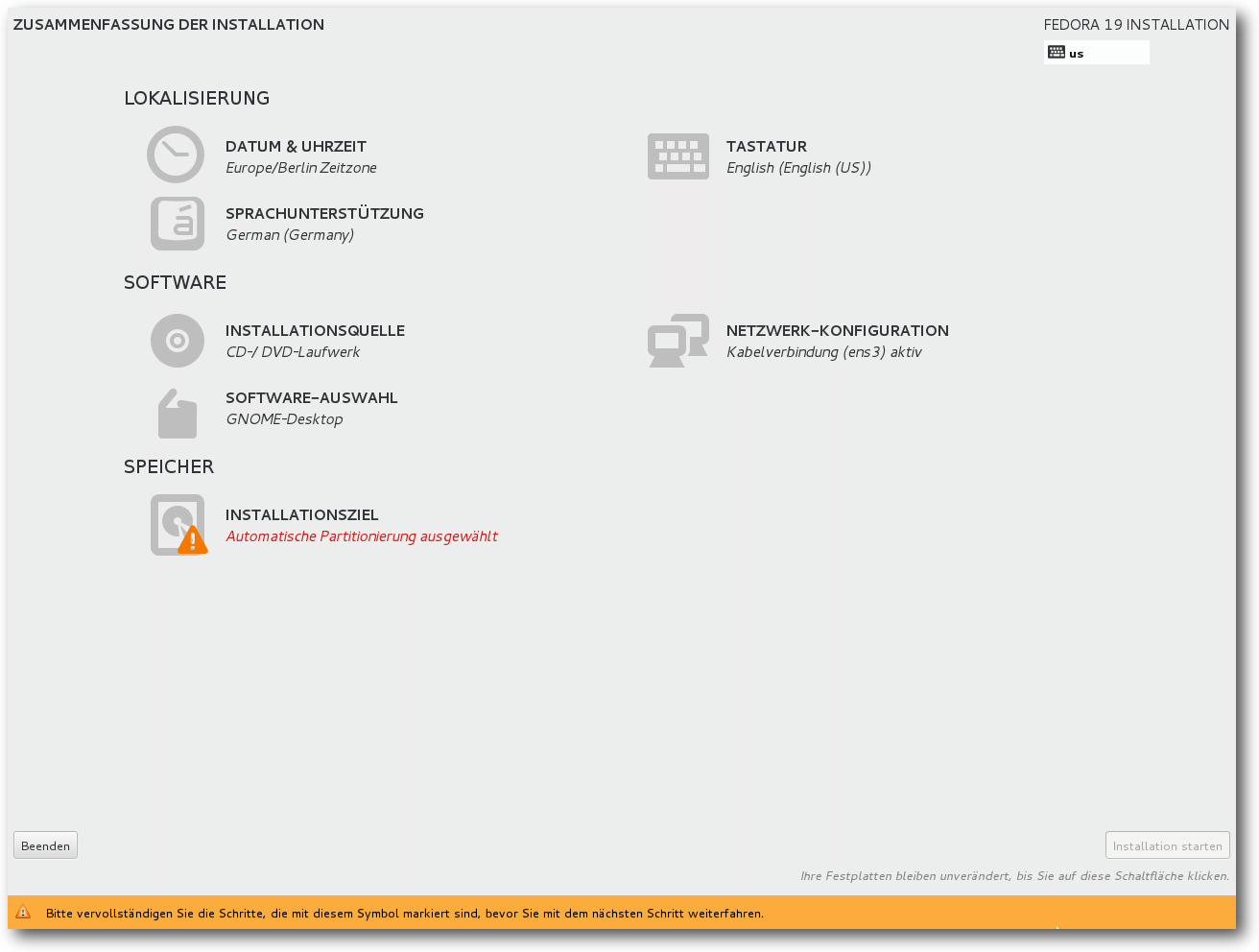
Übersichtsseite der Installation.
Nachdem in Fedora 18 das Installationsprogramm Anaconda gründlich überarbeitet
und seine Oberfläche völlig neu geschrieben [3]
wurde, stehen dieses Mal lediglich
kleinere Verbesserungen zu Buche. Die Installation beginnt mit der
Sprachauswahl,
bei der interessanterweise Deutsch als Voreinstellung angeboten
wird. Woher der Installer diese Vorauswahl bezieht, bleibt unklar.
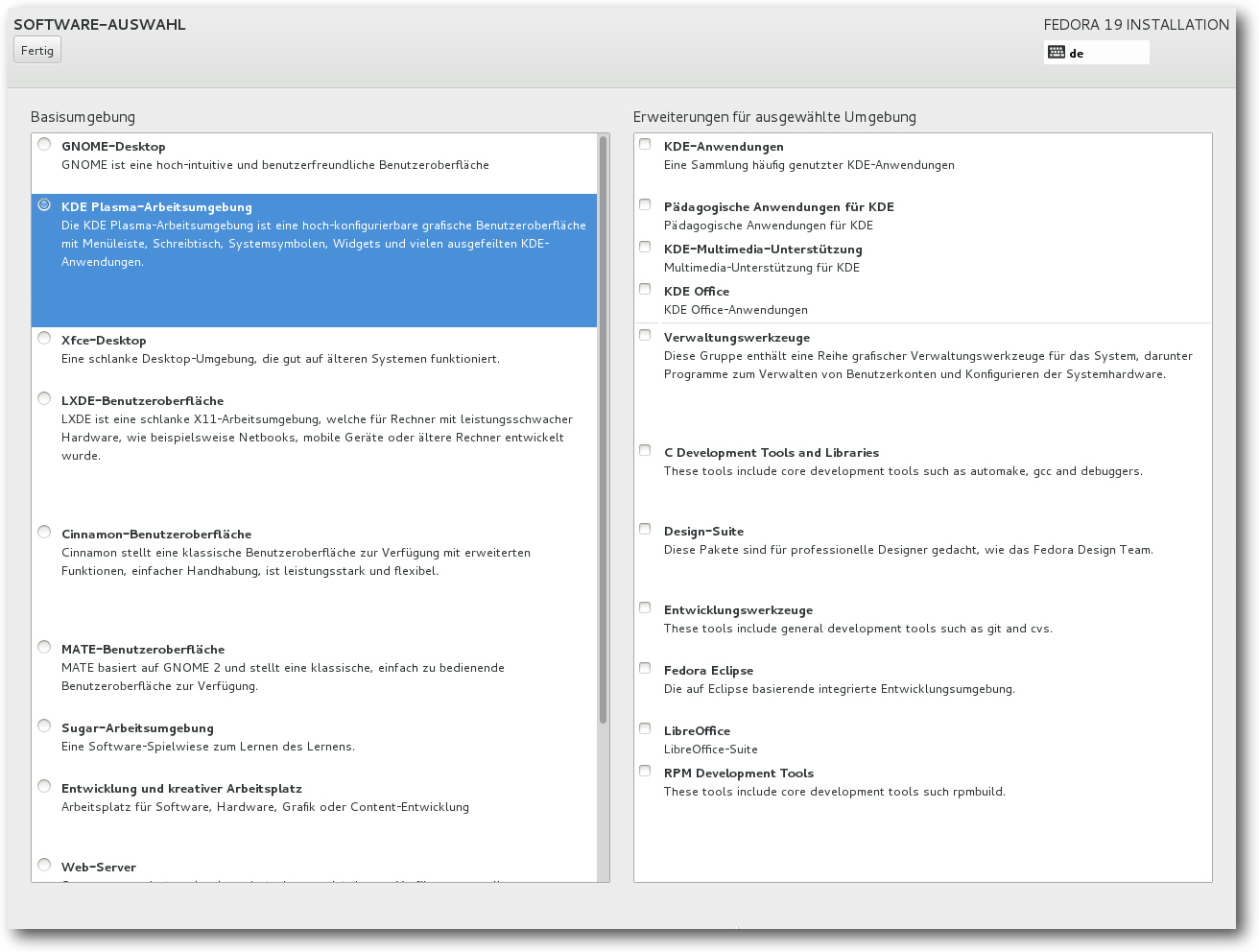
Software-Auswahl.
Danach gelangt man zur Übersichtsseite, die sich gegenüber Fedora 18 ein wenig
verändert hat. Hier ermittelt das Installationsprogramm im Hintergrund bereits
einige Dinge, es steht einem aber frei, diese abzuändern, und zwar weitgehend in
beliebiger Reihenfolge. Alle Punkte, die vom Benutzer zwingend noch bearbeitet
werden müssen, sind mit einem gelben „Warndreieck“ markiert. Die einzige
zwingende Aktion ist meist die Auswahl des Installationsziels. Die erkannten
Festplatten
werden durch ein Icon angezeigt. Dieses enthält
nun im Gegensatz zu
Fedora 18 auch den Gerätenamen (/dev/sda usw.), so dass sich auch Geräte
unterscheiden lassen (zumindest für Experten), die identische
Modellbezeichnungen haben.
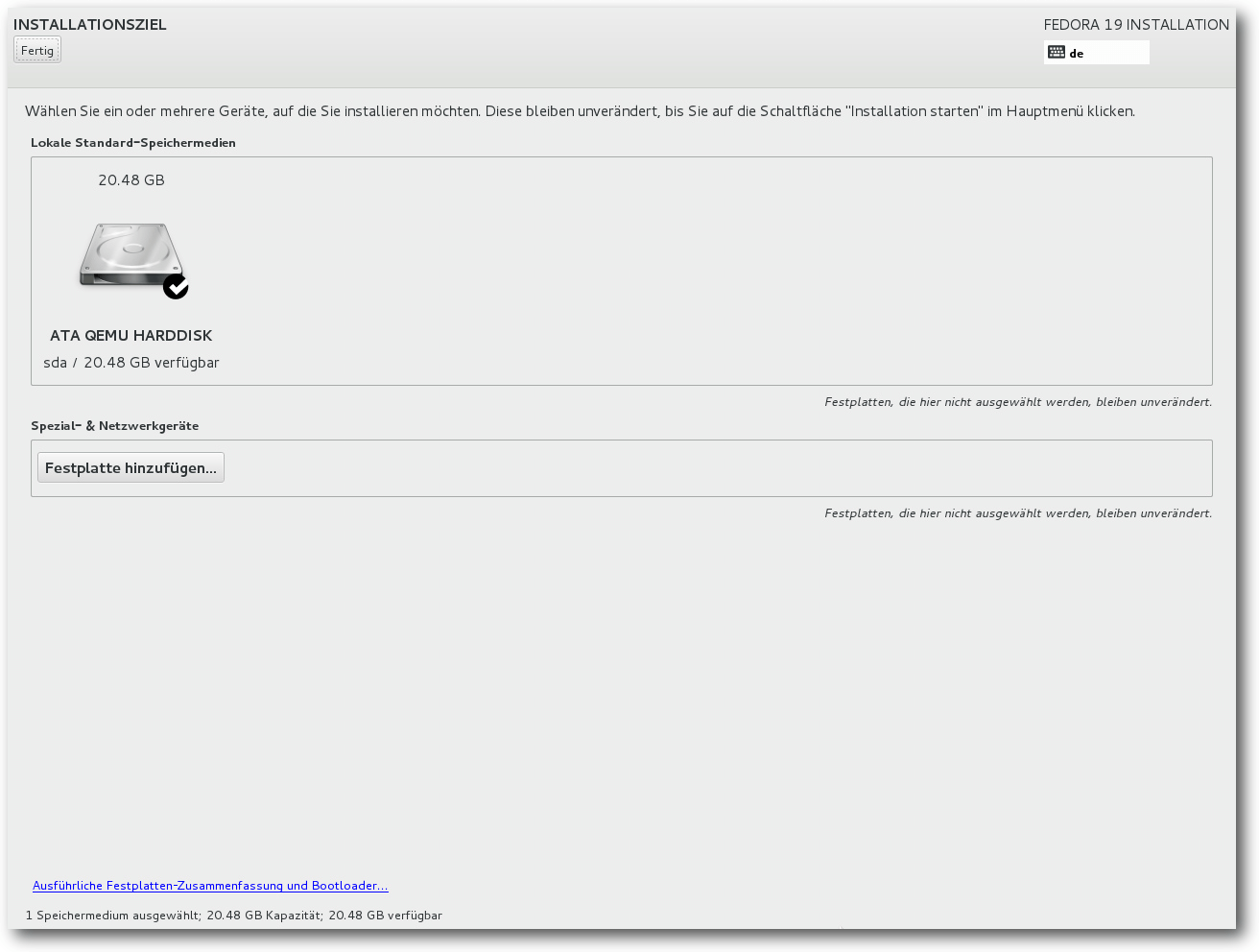
Auswahl der Partitionierungsmethode.
Man muss nun nicht mehr zwingend die Installationsquelle auswählen, da das
Installationsprogramm nun korrekt annimmt, dass man von der DVD installieren
will, wenn man von dieser gebootet hat. Zu empfehlen ist noch die Auswahl der
Tastaturbelegung. Hinter diesem Icon stehen alle Optionen zur Verfügung,
einschließlich ungewöhnlicher Belegungen und Feineinstellungen.
Auch die Software-Auswahl sollte man sich noch ansehen, zumindest wenn man nicht
GNOME, sondern eine andere Oberfläche installieren will. Es ist aber auch
nötig, häufig benötigte Anwendungen wie LibreOffice explizit auszuwählen, sonst
werden sie nicht mit installiert.
Bei der Partitionierung sind die gewohnten Optionen wie die Verschlüsselung der
gesamten Festplatte oder einzelner Partitionen, RAID und LVM vorhanden. Auch das
Dateisystem Btrfs wird wieder unterstützt, sogar mit seinen spezifischen
Funktionen wie Subvolumes. Wer die automatische Partitionierung wählt, erhält ab
dieser Version eine Auswahl zwischen „normalen“ Partitionen, einer
LVM-Installation und einer Btrfs-Installation. Die beiden letzteren legen eine
500 MB große,
mit dem Dateisystem ext4 formatierte
/boot-Partition an. Bei LVM wird der restliche Speicher
als Root-Partition verwendet, mit btrfs wird eine separate /home-Partition
angelegt, die sich aber aufgrund der besonderen Eigenschaften von Btrfs den
Plattenplatz mit der Root-Partition teilt. Im Endeffekt ist diese Lösung noch
flexibler als LVM.
Neu ist in Fedora 19 die Möglichkeit, Speichermedien zu nutzen, die über Fiber
Channel over Ethernet (FCoE), iSCSI oder Multipath eingebunden werden. Für
Verwirrung sorgte bei mir der Versuch, eine bereits formatierte Festplatte
nochmals komplett für eine Neuinstallation zu verwenden. Es war letztlich
machbar, aber nicht ganz intuitiv.
Während die Installation dann im Hintergrund läuft, muss man das Root-Passwort
setzen und kann optional auch Benutzer anlegen.
Wer bereits Fedora 18 installiert hat, kann mit dem Programm fedup auf Version
19 aktualisieren. Üblicherweise bezieht man dabei die ca. 1400 zu
aktualisierenden Pakete über das Netz, aber auch andere Quellen sind möglich.
Das Update auf Fedora 19 wurde für diesen Artikel nicht getestet. Man muss aber
darauf achten, dass das Update das mehr als 300 MB große Bootimage an einem Ort
ablegt, an dem genug Platz vorhanden ist.
Ausstattung
Nach der Installation ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Es startet
direkt der Login-Manager, der die ausgewählte Desktopumgebung startet. Der Login
Manager von GNOME hat, so wie er von der DVD installiert wird, einen Fehler, der
dazu führt, dass keine Passworteingabe angezeigt wird. Durch Auswahl eines
Benutzers aus der Combobox lässt sich das Problem umgehen. Mit einem der ersten
Online-Updates wurde es behoben.

Login im Display-Manager von Mate.
Unter den zahlreichen Neuerungen in Fedora 19 [1]
findet man neue und aktualisierte
Programme für die Modellierung und den 3D-Druck, darunter OpenSCAD, Skeinforge,
SFACT, Printrun und RepetierHost. Für Entwickler gibt es den Developer's
Assistant, OpenShift Origin für die Verwaltung von Clouds, die populäre
Javascript-
Plattform node.js zum Erstellen von skalierbaren Netzwerkanwendungen,
Ruby 2.0.0 und Ruby 1.9.3 und die visuelle Entwicklungsumgebung Scratch.
Wer viele Rechner automatisiert installieren will, kann jetzt auch Syslinux
anstelle von GRUB als Bootloader einsetzen. Systemd wurde in vielen Punkten
verbessert. Unter anderem lassen sich die Einstellungen von Diensten ohne
Neustart ändern. Fedora 19 bietet Checkpoint & Restore, womit sich ein Prozess,
beispielsweise zur Lastverteilung, auf einen anderen Rechner migrieren lässt.
Auch eine virtuelle Maschine kann mitsamt ihrer virtuellen Festplatte verschoben
werden, ohne dass ein gemeinsamer Speicher für Ausgangs-
und Zielrechner
existieren muss. OpenStack, eine freie Verwaltungssoftware für private und
hybride Clouds, wurde in der neuen Version „Grizzly“ aufgenommen. In Fedora 19
sind zusätzlich zu den Standardkomponenten von OpenStack auch die Projekte Heat
und Ceilometer verfügbar. Erstmals findet man auch die open-vm-tools, eine freie
Implementierung der VMware-Tools, im Archiv.
OpenLMI, eine gemeinsame Infrastruktur zur Verwaltung von Linux-Systemen, ist
nun enthalten. Die neuen „High Availability Container Resources“ erweitern die
Hochverfügbarkeitslösung Corosync/Pacemaker um Container in virtuellen
Maschinen. Für Kerberos-Administratoren vereinfacht sich die Einrichtung von
Client-Systemen.
Der Kernel in Fedora 19 ist derzeit Version 3.9. Als Desktop-Umgebungen stehen
unter anderem KDE SC 4.10, GNOME 3.8, Xfce 4.10, Mate 1.6, LXDE und Sugar zur
Verfügung.
Fedora 19 startet subjektiv etwa genauso schnell wie sein Vorgänger. Würde man
es genau messen, könnte man möglicherweise eine kleine Beschleunigung
feststellen, da Fedora jetzt den Inhalt der Initial Ramdisk optimiert. Das führt
dazu, dass nur noch Treiber eingebunden werden, die für diesen Rechner benötigt
werden. Dass dieses Verfahren fragil und sein Nutzen fragwürdig ist, muss wohl
nicht extra betont werden. Ändert sich die Hardware-Ausstattung des Rechners in
einer Weise, die auf den Bootvorgang Einfluss hat, muss man die Initial Ramdisk
mit dracut --regenerate-all --force neu erstellen, möglicherweise von der
Rettungs-Ramdisk aus. Man kann dieses Verhalten abstellen, indem man das Paket
dracut-nohostonly installiert.
Wie immer ist SELinux eingebunden und aktiviert. Als normaler Benutzer merkt man
überhaupt
nichts davon, solange die Konfiguration korrekt ist. In Fedora 19 wie
auch in der Vorversion trat kein sichtbares Problem im Zusammenhang mit SELinux
auf. Für den Fall, dass ein Problem auftritt – sei es nach der Installation von
zusätzlicher Software oder anderen Änderungen – steht ein Diagnosewerkzeug zur
Verfügung.
KDE benötigt in Fedora 19 direkt nach dem Start mit einem geöffneten
Terminal-Fenster etwa 500 MB RAM, Cinnamon 550 MB und Mate 270 MB. Bei der
Geschwindigkeit sollte sich
kein nennenswerter
Unterschied zwischen den Desktops
feststellen lassen, sofern genug RAM vorhanden ist und die sonstigen
Voraussetzungen erfüllt sind. Beim Test unter Qemu musste für GNOME und Cinnamon
leider auf das Software-3D-Rendering zurückgegriffen werden, was einige
Einschränkungen zur Folge hatte. Es gibt aber immer noch Hoffnung, dass eine
künftige Version von Qemu auch Hardware-3D unterstützt. Die Angaben zum
Speicherverbrauch sind nur als Anhaltswerte zu sehen, die sich je nach Hardware
und Messzeitpunkt erheblich unterscheiden können.
Cinnamon
GNOME 3.8 ist der Standard-Desktop von Fedora 18, wenn man nicht ausdrücklich
KDE, Xfce, LXDE oder etwas anderes auswählt. Die vielleicht am sehnlichsten
erwartete Änderung in GNOME 3.8 ist der Classic-Modus, der sich wieder eng an
die Bedienung von GNOME 2 anlehnen soll. Technisch baut der Classic-Modus aber
vollständig auf die modernen Features von GNOME 3 auf. Im Grunde handelt es sich
nur um die GNOME-Shell, die mittels einiger Erweiterungen angepasst wurde.
Anstelle von GNOME betrachtet dieser Artikel jedoch einmal Cinnamon, den von
Linux Mint initiierten Fork der GNOME-Shell. Cinnamon besitzt keinen
Classic-Modus, sondern ist in jeder Einzelheit darauf bedacht, möglichst eng am
Verhalten von GNOME 2 zu bleiben. Das ist den Entwicklern in frappierender Weise
gelungen. Allerdings wurde das in GNOME 2 übliche obere und untere Panel zu
einem einzigen zusammengefasst und am unteren Bildschirmrand eingeblendet, was
vom Aussehen mehr an KDE erinnert. Auch das Menü wurde erneuert, enthält aber
immer noch die klassischen Kategorien von Anwendungen.
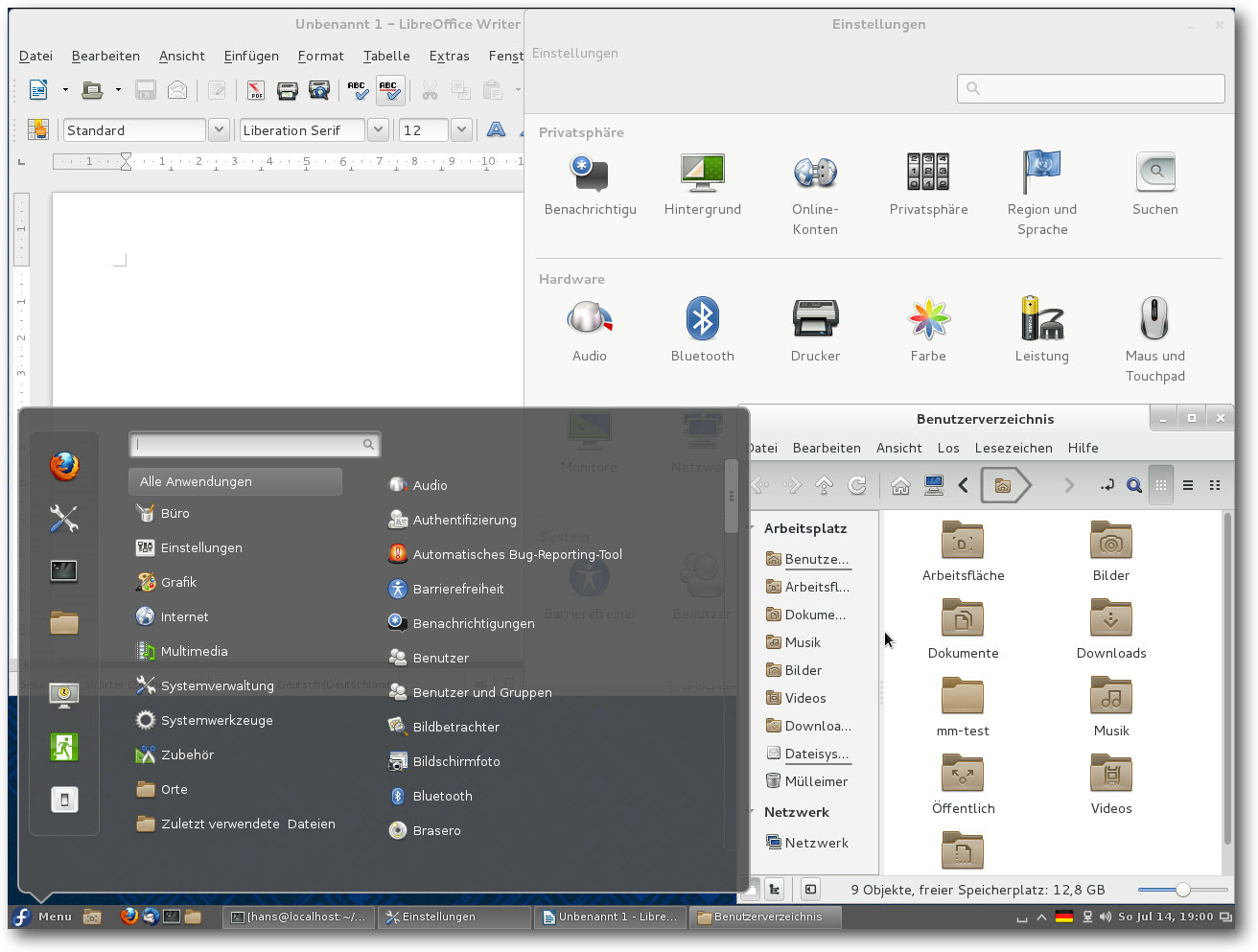
Cinnamon 1.9-Desktop mit einigen Applikationen.
Der Standard-Webbrowser unter Cinnamon ist Firefox 22.0. Der Dateimanager Nemo,
eine Cinnamon-Abspaltung des GNOME"=Dateimanagers Files (ehemals Nautilus),
bewahrt die Funktionen, die in GNOME entfernt wurden, darunter
die Möglichkeit,
mehr als eine Ansicht zu öffnen, die Baumansicht auf einer Seite und das Suchen,
während man Zeichen eingibt.
Die GNOME-Shell und somit auch Cinnamon können dank Software-Rendering auf jeder
Hardware laufen, auch wenn keine Hardware-Beschleunigung zur Verfügung steht.
Das Software-Rendering ist einigermaßen schnell und durchaus noch benutzbar,
doch wird man es wohl kaum ertragen, wenn man keinen sehr schnellen
Prozessor
hat. Die Situation bessert sich mit einem Mehrkern-Prozessor, doch Videos wird
man damit wohl nicht in brauchbarer Geschwindigkeit abspielen können. Jedenfalls
war es in diesem Test nicht möglich.
KDE
KDE ist in Version 4.10 enthalten, aber seit Fedora 18 nur noch als „Spin“ mit
einer KDE-Live-CD. Zur Installation muss man die Fedora-Installations-DVD
verwenden und bei der Software-Auswahl KDE und die benötigten Anwendungen
auswählen. Den Umfang der installierten KDE-Anwendungen bestimmt man damit
selbst.
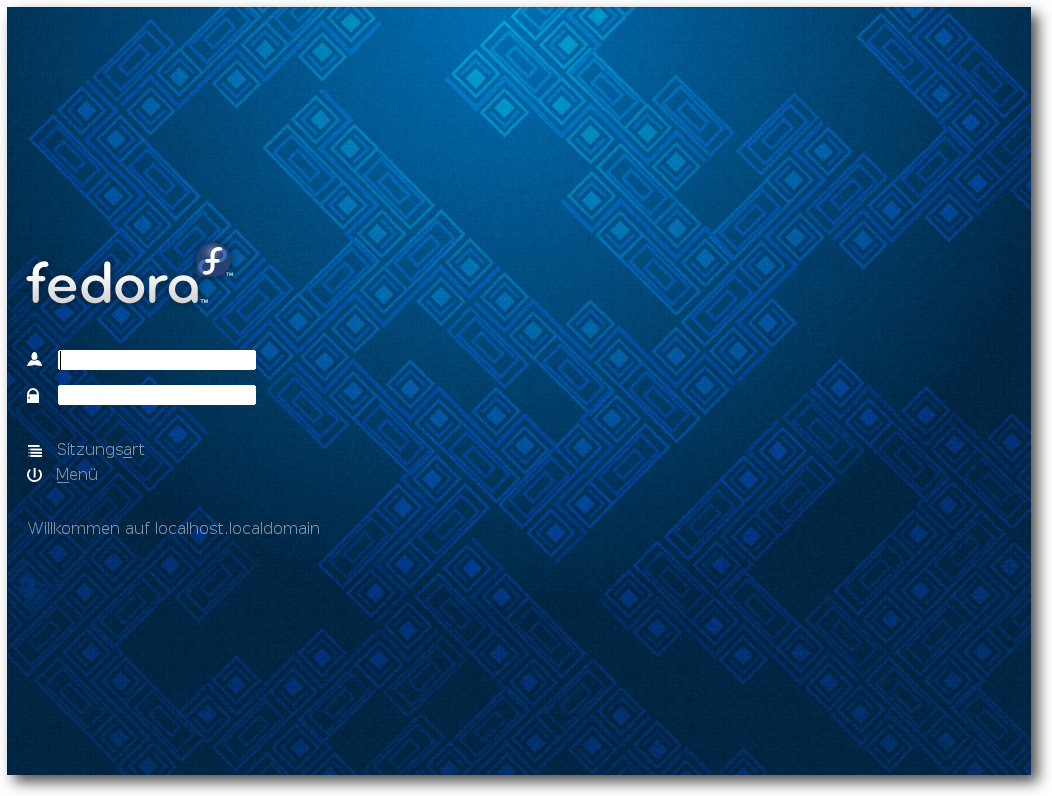
Login im Display-Manager von KDE.
Qt Quick wird in den Plasma-Workspaces 4.10 noch intensiver als zuvor genutzt.
Die bereits in KDE SC 4.8 eingeführten Qt-Quick-Plasma-Komponenten, die eine
standardisierte API-Implementation von Widgets mit dem nativen Plasma-Aussehen
bereitstellen, wurden um neue Module ergänzt. Viele weitere Plasma-Komponenten
wurden neu in Qt Quick konzipiert. Unter anderem setzen die Systemleiste, der
Pager, Systembenachrichtigungen und die Wetterstation auf die neue Technologie
auf. Zudem haben die Entwickler die Bildschirmsperre überarbeitet, die nun
ebenfalls auf Qt Quick beruht. Dank der ebenfalls auf Qt Quick aufsetzenden
Wallpapers-Engine ist es nun einfacher, animierte Desktophintergründe zu
erstellen.
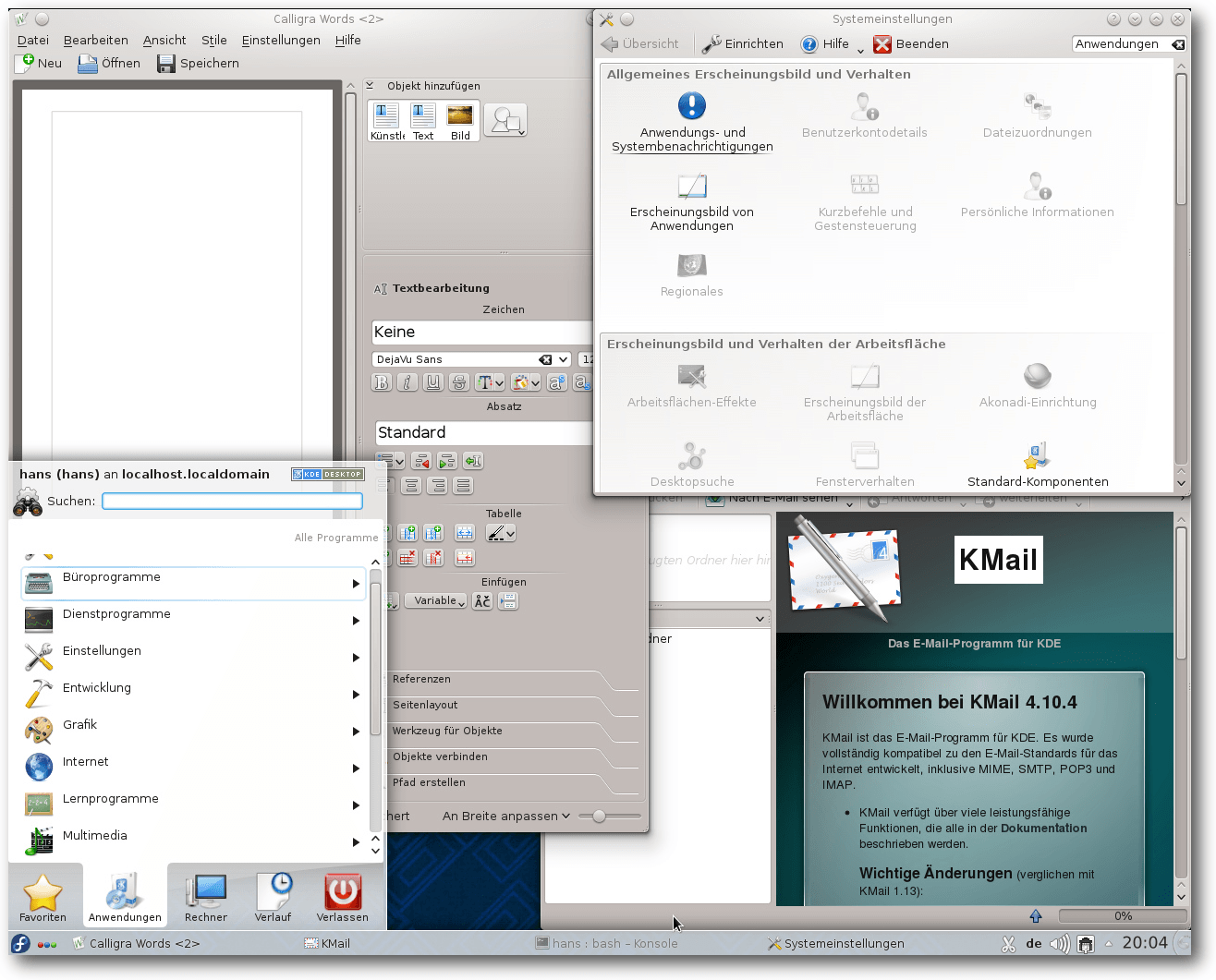
KDE 4.10-Desktop mit einigen Applikationen.
Die Umgebung wurde um das neue Air-Theme erweitert, das in Fedora aber nicht der
Standard ist. Der Window-Manager KWin enthält nun eine Integration von „Get Hot
New Stuff“ (GHNS), mit der zusätzliche Effekte und Skripte heruntergeladen und
aktiviert werden können. Mit diesen lässt sich auch das Verhalten von KWin
ändern. Der Window-Manager erkennt zudem auch unter Umständen, dass er in einer
virtuellen Maschine läuft, und schaltet dann
OpenGL-Compositing ein, wenn
möglich. Mit dem proprietären AMD-Grafiktreiber ist jetzt auch OpenGL 2 möglich.
Mehrere Anwendungen unterstützen jetzt die Farbkorrektur unter Verwendung von
Farbprofilen. Das KDED-Modul KolorServer kann die Farbkorrektur für jedes
Ausgabemedium separat festlegen, in einer kommenden Version soll dies für jedes
einzelne Fenster möglich sein. Die Farbkorrektur in KWin befreit den Kompositor
von dieser Aufgabe und ermöglicht es, die Farbverwaltung abzuschalten.
KDE erhielt ein Anwendungsmenü ähnlich dem in Unity, bei dem mehrere Anwendungen
ein gemeinsames globales Menü nutzen und immer nur das Menü der aktiven
Anwendung sichtbar ist. Dies kann optional in einer Menüleiste am oberen
Bildschirmrand dargestellt werden, die nur dann eingeblendet wird, wenn man mit
der Maus an den Oberrand fährt. Das Menü soll auch bei Verwendung mehrerer
Bildschirme korrekt funktionieren und kann beliebig platziert werden. Es kann
auch in die Titelleiste der Anwendung verlegt werden. Wo es bereits genutzt
wird, konnte jedoch nicht ermittelt werden.
In Fedora 19 ändert sich an KDE nichts Grundlegendes gegenüber der Vorversion.
Die neuen Funktionen werden von den Benutzern sicherlich begrüßt, und die
Farbkorrektur dürfte eine wichtige Neuerung sein. Als Office-Suite ist anstatt LibreOffice die Anwendung Calligra
Office installiert, doch hindert einen nichts daran, das zu ändern. Der
Standard-Webbrowser ist Konqueror, augenscheinlich ohne Änderungen an den
Standardeinstellungen.
KDE präsentiert sich weiterhin als angenehm zu benutzen und problemlos. Hier
sind die traditionellen Bedienelemente unbeschädigt erhalten und es gibt
Einstellungsmöglichkeiten bis zum kleinsten Detail. Die Plasma-Oberfläche für
Mobilgeräte ist vollständig separat von der Desktop-Variante und kann diese
daher auch nicht beeinträchtigen. Die Anwendungen bieten einen großen
Funktionsumfang und sind
konfigurier- und erweiterbar. Natürlich gibt es
bisweilen andere freie Anwendungen, die den KDE-Anwendungen überlegen sind oder
von einigen Benutzern bevorzugt werden, aber viele KDE-Anwendungen sind gut und
nützlich.
Mate
Mate versucht den eigentlich toten GNOME 2.32-Zweig am Leben zu erhalten oder
wiederzuerwecken. Wie bei Cinnamon beruht seine Entwicklung darauf, dass viele Benutzer (wie
viele, ist zwar fraglich, aber letztlich nicht entscheidend) mit GNOME 3 nichts
anfangen konnten. Tatsächlich sieht Mate bis auf einige geänderte Icons genau
wie GNOME 2.32 aus. Viele Programme wurden umbenannt oder ersetzt, doch einige
haben noch „gnome“ im Namen. Mate präsentiert sich schlank und schnell, wie man
das von den letzten GNOME-2-Versionen gewohnt war. Die Anzahl der
Einstellmöglichkeiten wurde noch erweitert. Für viele Anwender dürfte Mate damit
auf dem
richtigen Weg sein – einem Weg, den GNOME nach ihrer Ansicht nie hätte
verlassen dürfen.
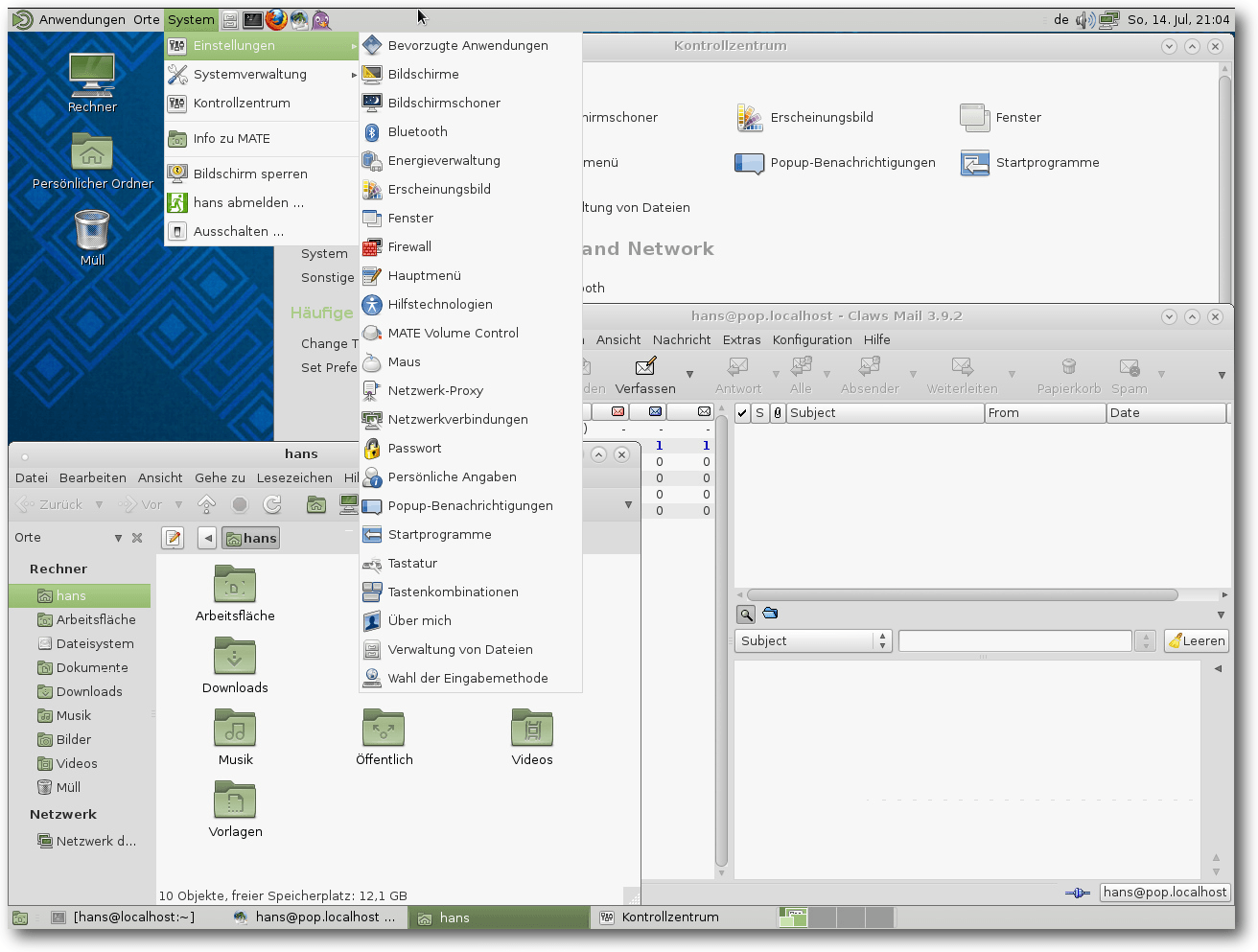
Mate 1.6-Desktop mit einigen Applikationen.
Als Webbrowser wird unter Fedora 19 Firefox 22.0 ohne Erweiterungen installiert.
Statt Evolution setzt man auf Claws als Mailprogramm. Mate ist schlichtweg
perfekt für alle, die bei GNOME 2 bleiben wollen.
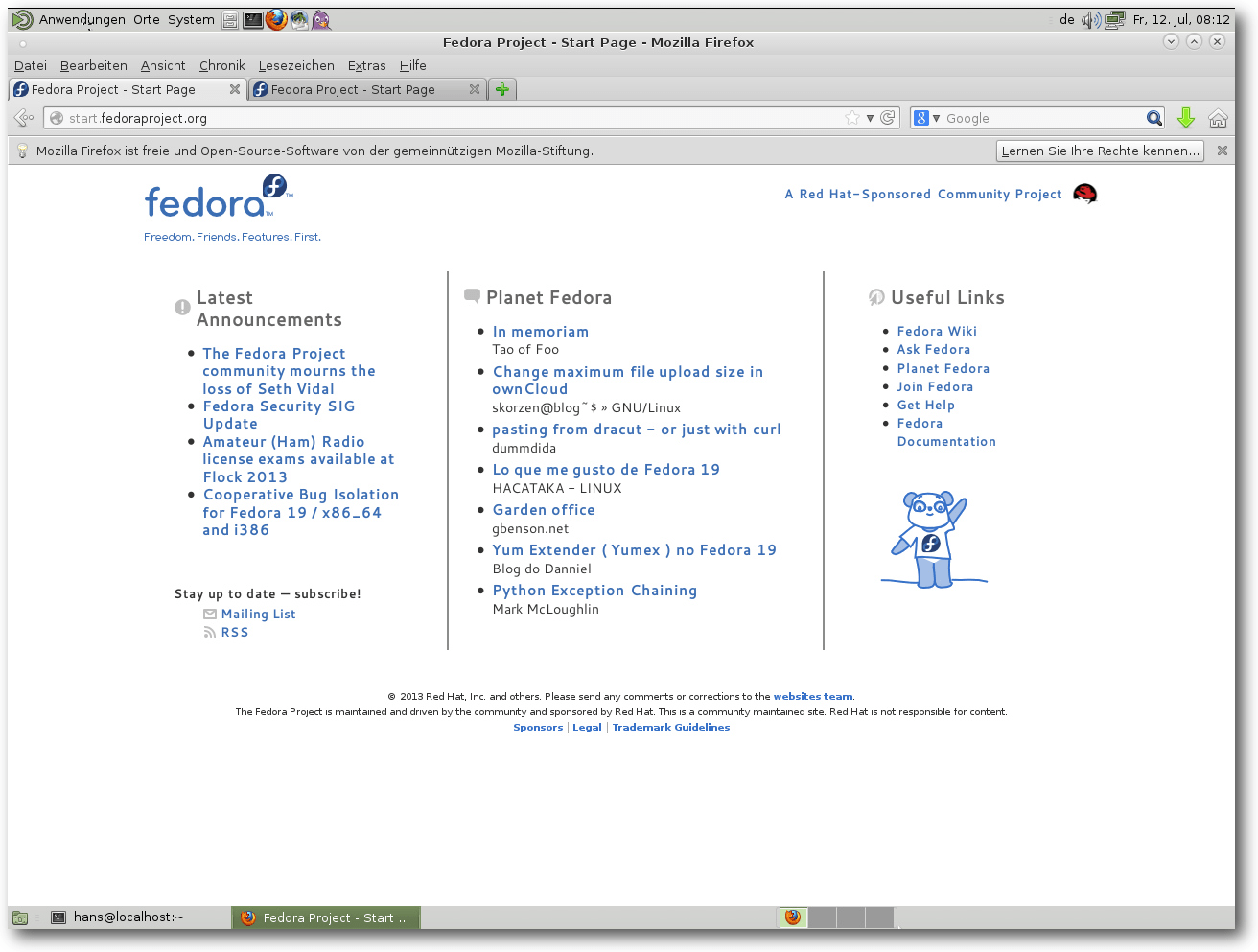
Firefox in Mate.
Technisch wird die Mate zugrundeliegende Bibliothek GTK+ 2 im Laufe der Zeit
veralten. So sollte man jedenfalls denken, zumal es momentan wohl keinen
offiziellen Betreuer dieser Version gibt. Doch GTK+ ist freie Software, und
keine Version davon wird sterben, wenn sich jemand der Sache annnimmt. Und im
Mate-Lager herrscht offenbar die Ansicht [4],
dass es bald wieder so weit sein wird.
Etliche Entwickler haben mittlerweile schlechte Erfahrungen bei der Portierung
von GTK+ 2 nach GTK+ 3 gemacht. GTK+ 3 werde demnach immer mehr zu einer
ausschließlich GNOME dienenden Bibliothek, so die Meinung einiger Entwickler.
Ständig werden Änderungen ohne Rücksicht auf die Kompatibilität zu den
Vorgängerversionen gemacht. Dabei wurde seit Version 3.0 nicht einmal etwas
Wesentliches zu der Bibliothek hinzugefügt.
Multimedia im Browser und auf dem Desktop
Wegen der Softwarepatente in den USA kann
Fedora, ebenso wie die meisten anderen
Distributionen, nur wenige Medienformate abspielen, da es viele benötigte Codecs
nicht mitliefern kann. Wenn man versucht, eine MP3- oder Videodatei abzuspielen,
dann bieten die gängigen Player aber die Option an, über die Paketverwaltung
nach passenden Plugins zu suchen.
Damit die Suche in der Paketverwaltung Aussicht auf Erfolg hat, muss man vorher
die zusätzlichen Repositorys von RPM Fusion [5]
eintragen. Das muss man wissen oder
durch Suchen im Web herausfinden. Die Repositorys kann man eintragen, indem man
die Webseite von RPM Fusion besucht. Von dieser kann man Pakete installieren,
die die Repositorys hinzufügen. Dies gilt für alle Desktops gleichermaßen. Die
Installation funktioniert prinzipiell mit Konqueror und Firefox. Bei ersterem
fiel auf, dass viel zu oft das Root-Passwort verlangt wurde und am Ende eine
Fehlermeldung scheinbar den Fehlschlag der Aktion verkündete. Doch trotz dieser
Meldung
war alles installiert. Nicht viel besser war es unter Cinnamon mit
Firefox. Dort wurde nach der Eingabe des Passwortes trotz korrekter Eingabe in
der Dialogbox die Zeile „Entschuldigung, das hat nicht geklappt“ angezeigt, nur
um dann fortzusetzen und die Pakete korrekt zu installieren. Ob es vielleicht
nach Jahren einmal irgendjemanden interessiert, dass diese Fehler, die eigentlich ein
absolutes Unding sind, endlich korrigiert werden?
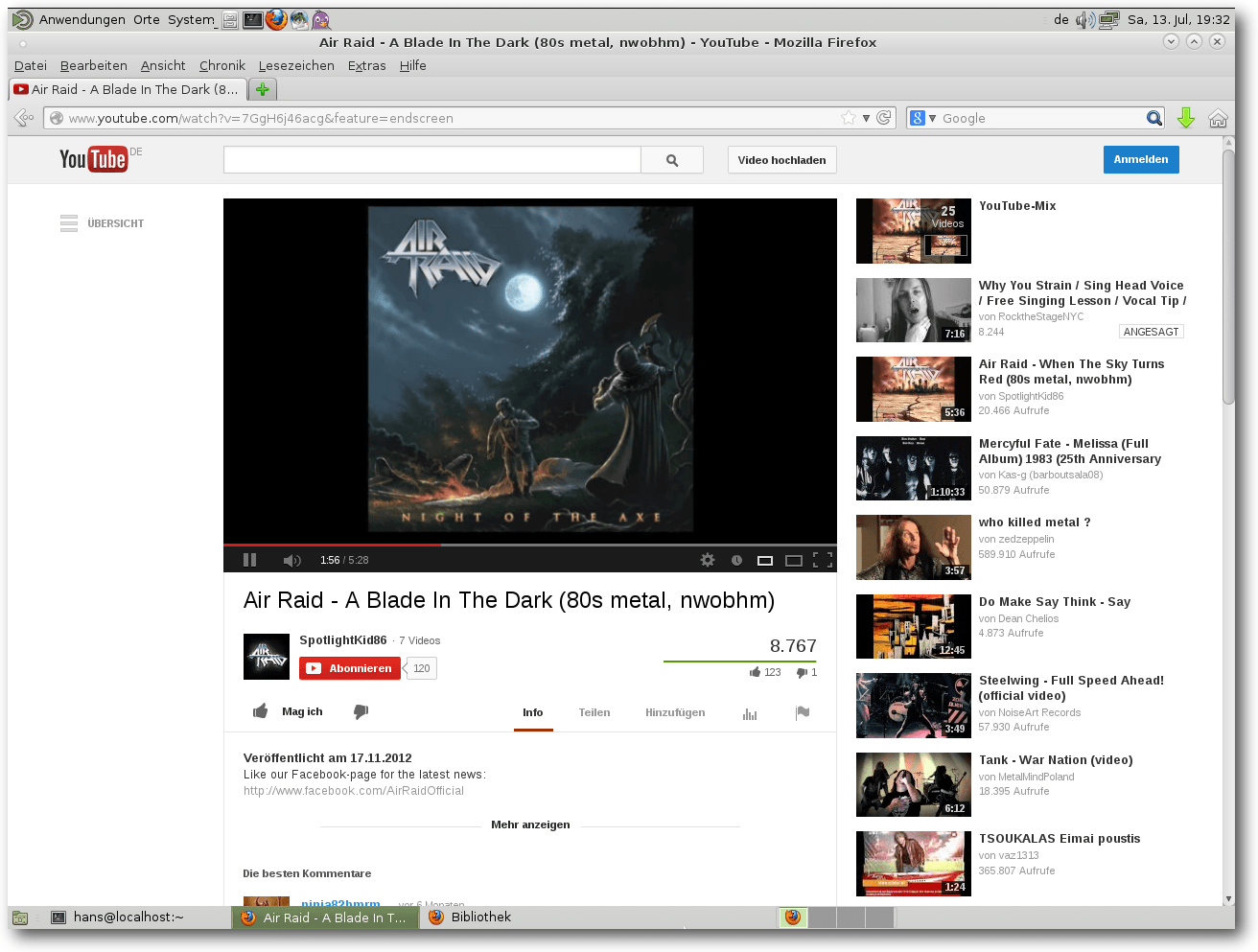
Abspielen von WebM-Videos mit Firefox in Mate.
Keinerlei Probleme machte die Installation dagegen unter Mate. Nur eine
Passworteingabe, einmal bestätigen und das Paket war installiert, ohne dass
reale oder tatsächlich gar nicht existierende Fehler gemeldet wurden.
Danach ist es ratsam, gleich die benötigten Softwarepakete zu installieren. Das
erspart mögliche Probleme, bei denen die Anwendungen die nötigen Plugins doch
nicht finden, falsch installieren oder Ähnliches, wie es zumindest bis Fedora 18
durchaus vorkam. Zudem muss man die Anwendungen meist neu starten, nachdem ein
Plugin installiert wurde. Am schnellsten und einfachsten ist somit eine manuelle
Installation der GStreamer-Plugins, insbesondere gstreamer1-plugins-ugly und
gstreamer1-libav (gstreamer-plugins-ugly und gstreamer-ffmpeg für die ältere
Version 0.10 von GStreamer).
Standard-Player für Audio und Video ist unter Cinnamon der GNOME-Player
„Videos“, früher „Totem“ genannt. Unter KDE sind es Amarok und
Dragonplayer.
Während Amarok funktionierte, stoppte Dragonplayer das Abspielen jedes Videos
nach
wenigen Sekunden und funktionierte danach nicht mehr richtig oder stürzte
ab. Dragonplayer war, wie alle anderen von KDE mitgelieferten Player vor
ihm, noch nie ernsthaft zu gebrauchen. Man installiert besser ein bewährtes
Programm wie (S)MPlayer, VLC oder Xine. Oder besser alle drei.
Unter Mate trübten zwei kleine Probleme den bis dahin guten Eindruck. Es stellte
sich heraus, dass kein Audio- und kein Videoplayer installiert war, jedenfalls
war auch bei gründlicher Suche keiner zu finden. Man muss also einen Player in
der Paketverwaltung, die in dieser Hinsicht alles andere als komfortabel ist,
suchen und installieren. Auswahl gibt es dabei genug – seltsam ist allerdings,
dass keine Version von Totem für GNOME 2.32 bzw.
Mate vorhanden ist. Beim
Abspielen selbst gab es dann keine Problem mehr. Lediglich der Dateimanager Caja
stürzte bei einer Aktion ab. Solange so etwas nur beim Abspielen von
Mediendateien passiert, ist es lediglich ein kleines Ärgernis, und vielleicht
steht schon bald ein Update zur Verfügung.
Nachdem das Flash-Plugin für Firefox eingestellt wurde, gestaltet sich die
Situation beim Abspielen von Flash-Videos aus dem Web etwas schwieriger. Eine
Alternative ist natürlich Google Chrome, der den Flash-Code von Adobe eingebaut
hat.
Wer den unfreien Browser nicht nutzen will, hat
immer noch einige
Möglichkeiten. So ist das Videoformat WebM inzwischen recht verbreitet und
funktioniert einwandfrei, beispielsweise bei der Tagesschau. Auf Youtube und
anderen Videoseiten wird man dagegen nicht jedes Video im WebM-Format finden. In
manchen Fällen hilft die freie Flash-Implementation Lightspark, die in Version
0.7.2, also nur geringfügig verbessert gegenüber Fedora 18, vorliegt, und leider
nach wie vor unzuverlässig ist. Teilweise war sie nicht in der Lage, die
Audiospur eines Videos wiederzugeben, obwohl das Video selbst sichtbar war.
Funktioniert das alles nicht, kann man immer noch das Video herunterladen und in
einem externen Player öffnen.
Paketverwaltung und Updates
Wenig hat sich bei der Paketverwaltung getan.
Für die
Installation bzw. Deinstallation
und das Aktualisieren von Paketen
existieren
weiterhin separate Anwendungen, die aber
auch von der Paketverwaltung
aus aufgerufen werden können. Sie funktionieren
normalerweise reibungslos und die Updates sind
dank Delta-RPMs oft erstaunlich klein und schnell installiert.
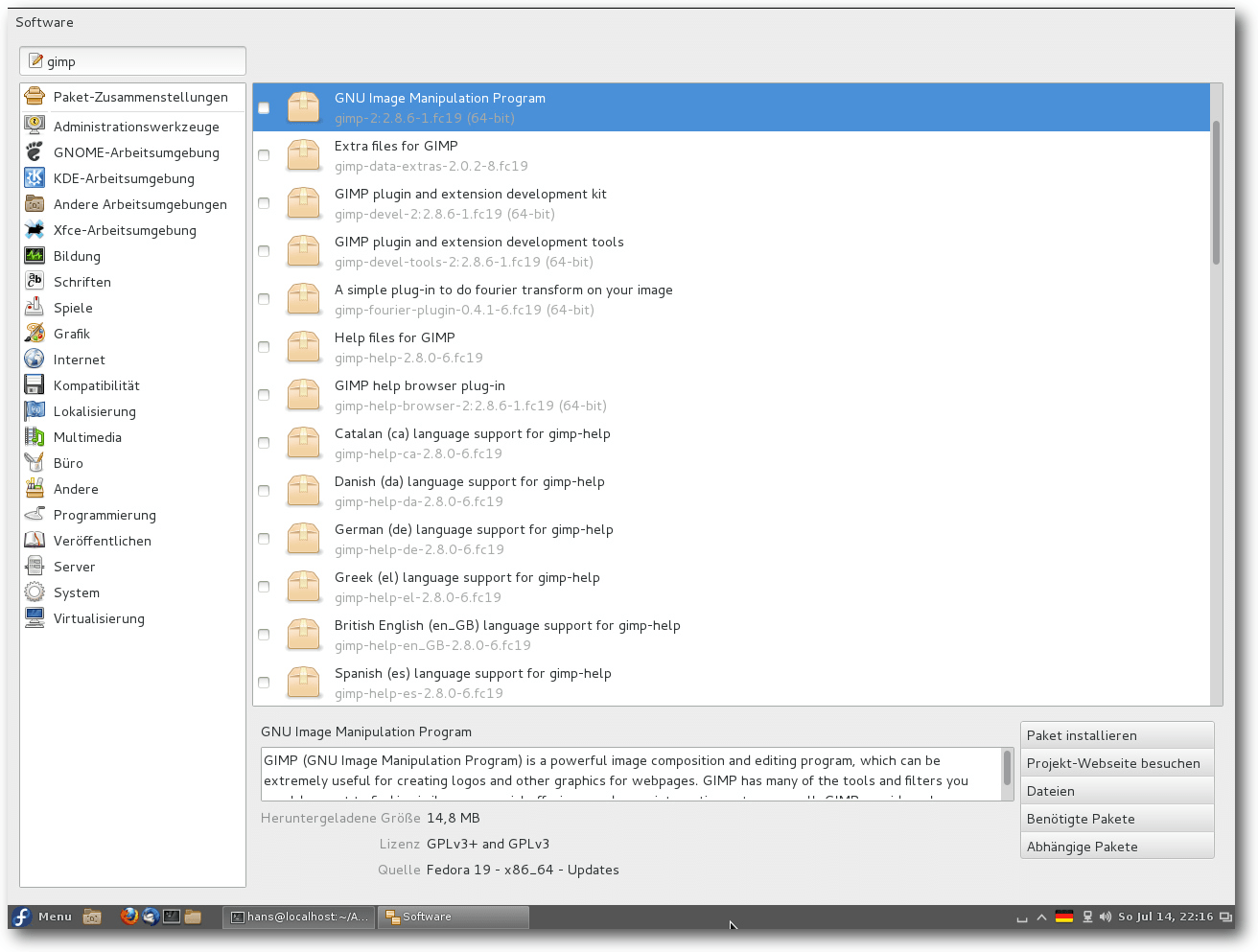
Paketverwaltung gpk-application in Cinnamon.
Die Paketverwaltung baut unter GNOME und KDE grundsätzlich auf PackageKit auf.
Die
Programme – gpk-application 3.8.2 bzw. apper 0.8.1 – sind komfortabel genug.
Etwas Vergleichbares wie das
Software Center von Ubuntu bietet Fedora jedoch
nicht.
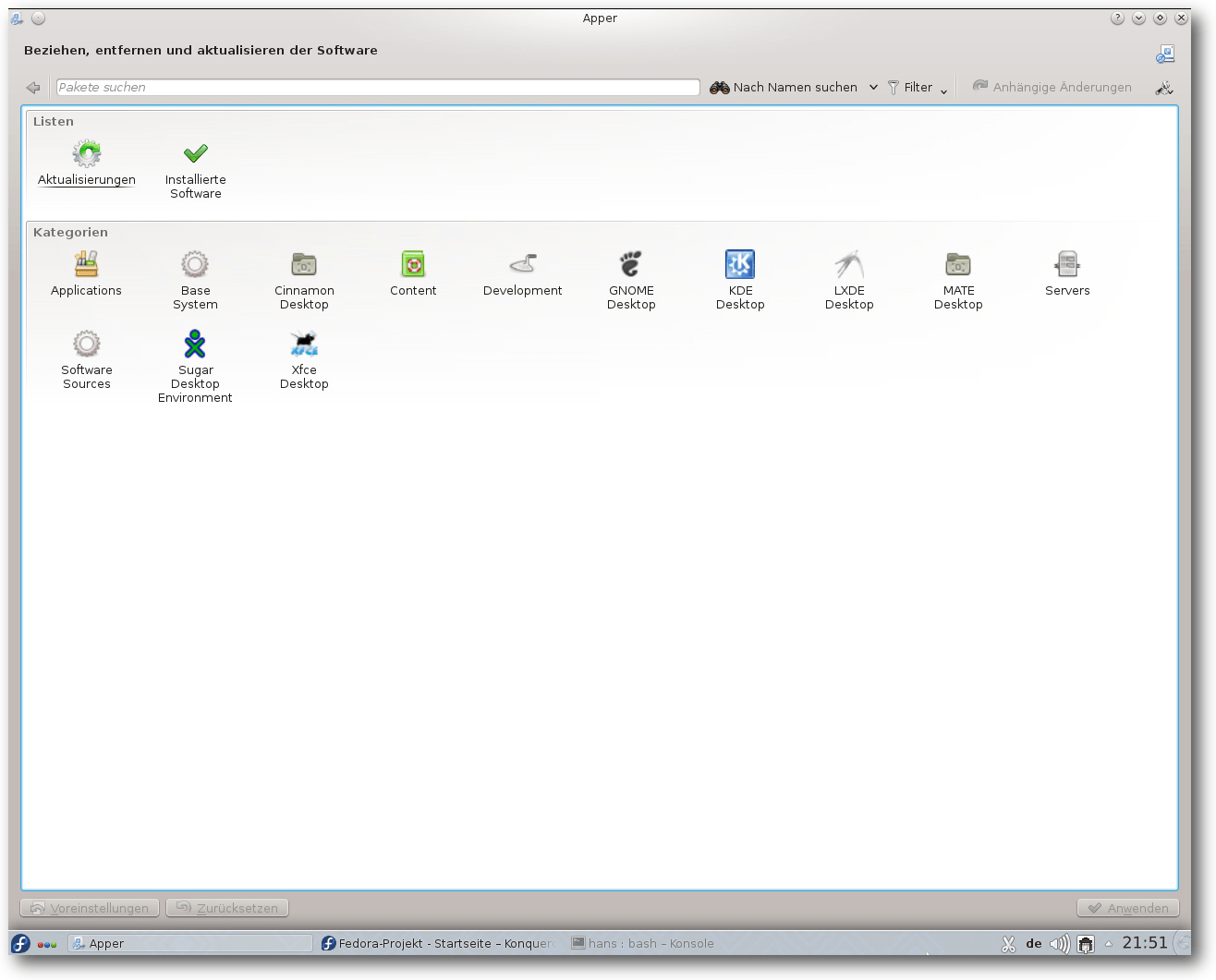
Paketverwaltung Apper in KDE.
Mate verwendet die grafische Oberfläche Yumex (Yum Extender) für die
Paketverwaltung.
Das Programm funktioniert recht ordentlich,
allerdings besitzt es eine Unart, die in anderen Programmen bereits beseitigt
wurde: Es zeigt sowohl die 32- als auch die 64-Bit-Softwarepakete an, obwohl man
normalerweise nur eines davon benötigt. Auch die
Suche nach Anwendungen ist
nicht sehr
komfortabel. Interessant ist dagegen, dass man mit Yumex den Verlauf
der Software-Installationen und Updates ansehen kann. Und
da diese seit einiger
Zeit als Transaktionen ausgeführt werden, ist es auch möglich, diese rückgängig
zu machen. In den Programmen von Cinnamon/GNOME und KDE fehlt diese Möglichkeit.
DNF, ein möglicher und teilweise schnellerer Ersatz für Yum, wurde von Version
0.2 auf 0.3 aktualisiert. DNF ist zwar inoffiziell, aber wer gerne auf der
Kommandozeile arbeitet, kann ruhig damit experimentieren.
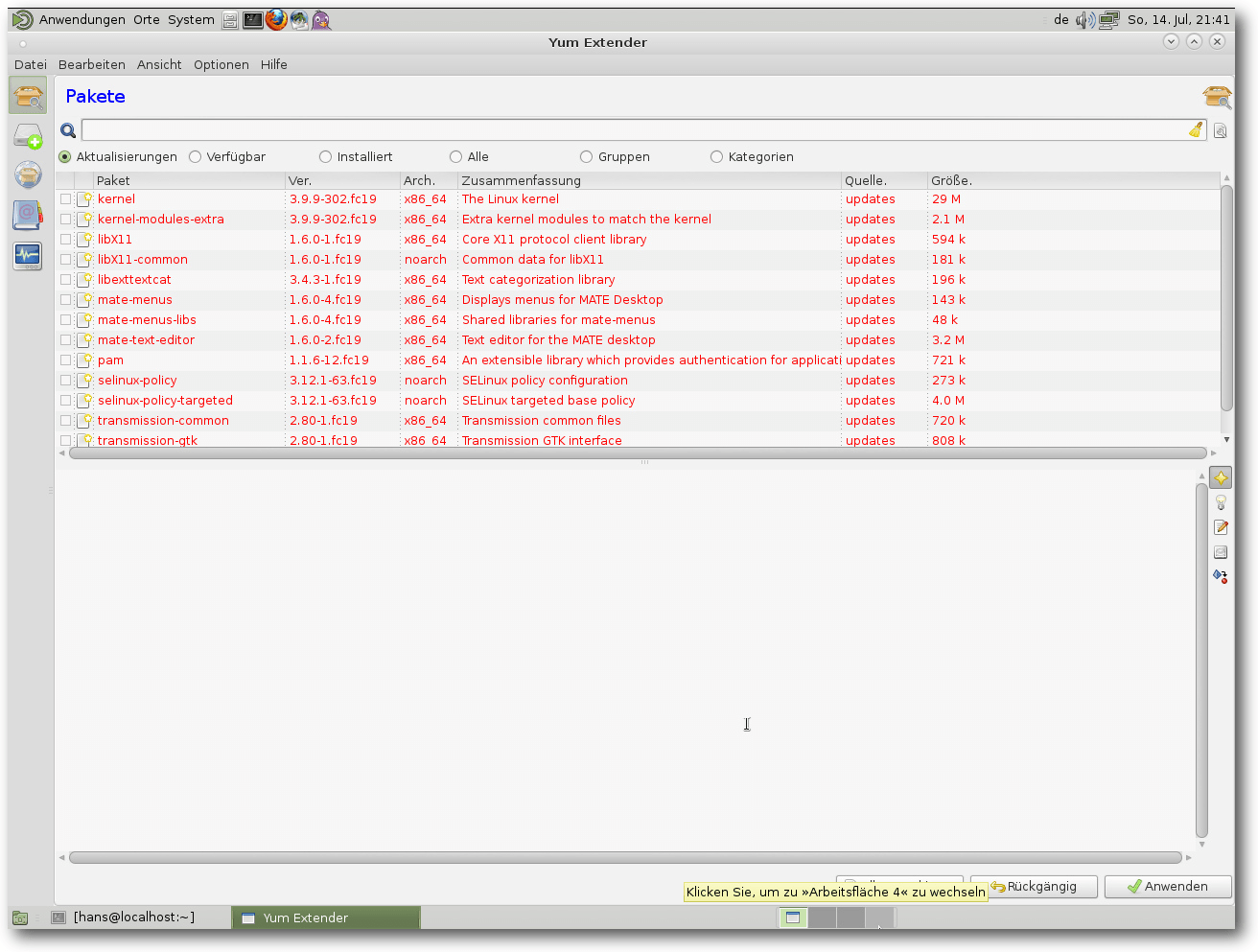
Paketverwaltung YumEx in Mate.
Fazit
Es liegt in der Natur der Sache, dass man bei der Installation eines neuen
Systems auf Neuerungen stößt, die man erst einmal als ärgerlich oder
unverständlich empfindet. Bisweilen ist es nötig, damit Erfahrungen zu sammeln,
bis man sie verstanden hat und sie akzeptiert. Manchmal, aber bei weitem nicht
immer, handelt es sich um echte Fehler. Beides macht man bei Fedora jedes halbe
Jahr mit. Was die Fehler betrifft, so halten sie sich in Fedora 19 in engen
Grenzen, und viele anfängliche Fehler wurden schnell behoben.
Insgesamt ist Fedora für die hohe Qualität zu loben, die das Projekt mit Version
19 abgeliefert hat. Obwohl einige bedeutende Neuerungen eingeflossen sind, ist
die neue Version in einem ausgezeichneten Zustand. Vielleicht spiegelt das aber
auch nur die allgemeine Weisheit wider, dass die neueste Version von freien
Softwareprojekten fast immer die beste ist.
Bedeutende Neuerungen gegenüber Fedora 18 sind die
Aufnahme von
Cinnamon als
Desktop-Option und die erneuerte Version von Mate. Beides wird
Anhänger
des alten GNOME jubeln lassen. Wie
zahlreich die Nutzer von Mate bzw. Cinnamon sind, lässt sich zwar nicht
beziffern, beide Umgebungen sind jedoch, rein subjektiv gesehen, für Desktops
die bessere Wahl als GNOME. Enttäuschend ist, dass es es keinen
Enlightenment-Spin zu geben scheint, ja nicht einmal E17-Pakete im Repository,
was nach dem Erscheinen von Enlightenment 17 doch wünschenswert gewesen wäre.
Doch Desktopumgebungen sind ein Stück weit auch Geschmackssache, und neben den
genannten stehen noch
andere zur Nutzung bereit, so dass nahezu jedem
geholfen werden kann.
Von den weiteren Neuerungen soll noch hervorgehoben werden, dass man nun ein
rein auf btrfs beruhendes System einrichten kann, was bisher zumindest nicht auf
so einfache Weise möglich war. Damit können nun viel mehr Benutzer direkt von
den überragenden Fähigkeiten des neuen Dateisystems profitieren.
Insgesamt hat sich an der Ausrichtung von Fedora
nichts geändert.
Fedora bringt reichliche und häufige Updates und ist damit immer aktuell. Doch
das ist auch die größte Schwäche der Distribution: Die Basis ändert sich ständig
und es gibt keine Version mit langfristigem Support. Alle sechs Monate,
spätestens aber nach 13 Monaten mit dem Ende des Supports der installierten
Version, ist das Update auf die neueste Version Pflicht. Das ist normalen
Anwendern nicht zumutbar, nicht nur wegen des Aufwands, sondern auch weil es
dabei durchaus zu unliebsamen Überraschungen kommen kann. Andere Distributionen,
insbesondere Ubuntu oder Debian, bieten nicht nur wesentlich längeren Support,
sondern ermöglichen auch das Update ohne Unterbrechung des Betriebs.
Für mich bleibt es dabei, dass Fedora in erster Linie für erfahrene Benutzer
geeignet ist, die immer die neueste Software wollen und auch kein Problem mit
den Updates haben. Andere Benutzer haben keine vollständig mit Fedora
vergleichbare Alternative. Es gibt natürlich Red Hat Enterprise Linux und einige
davon abgeleitete Distributionen, aber diese Distributionen sind eben nicht
exakt Fedora, schon weil sie nie genauso aktuell sein können. Dennoch stellt
Fedora eine der besten Optionen dar, sich den aktuellen Stand der Technik in
Linux anzusehen.
Links
[1] https://fedoraproject.org/wiki/F19_release_announcement
[2] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1638/fedora-19.html
[3] https://fedoraproject.org/wiki/Features/NewInstallerUI
[4] http://forums.mate-desktop.org/viewtopic.php?f=16&t=1890
[5] http://rpmfusion.org/
| Autoreninformation |
| Hans-Joachim Baader (Webseite)
befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss er erfolgreich sein
Informatikstudium ab, machte die Softwareentwicklung zum Beruf
und ist einer der Betreiber von Pro-Linux.de.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend
weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und
welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen
Entwickler-Kernel im Auge behält.
Linux 3.11
Die Entwicklung von Linux 3.11 ist noch nicht zum Ende gelangt. Die vierte
Entwicklerversion [1] ließ noch keine
Anzeichen zur Beruhigung erkennen und hatte nahezu das gleiche Volumen wie -rc3.
Immerhin lässt sich ein guter Teil der Änderungen auf den Umzug von printk() in
ein eigenes Unterverzeichnis zurückführen. Dies ändert zwar nichts an der
Funktionalität, sorgt aber für ein wenig Ordnung.
Am 11. August legte Torvalds den -rc5 [2]
vor.
Seine
Veröffentlichungsmail lässt darauf schließen, dass er insgeheim hoffte, Linux
3.11 an diesem Datum als fertige Version zur Verfügung stellen zu können, doch
eine Entwicklungszeit von nur 42 Tagen war dann doch etwas unrealistisch.
Immerhin ging das Volumen der Änderungen ein gutes Stück zurück und konnte als
Signal für die Stabilisierung in der Entwicklung gesehen werden. Linux
3.11-rc6 [3] konnte diesen Trend fortsetzen
und wies abermals weniger Änderungen auf. Neben der Korrektur eines älteren,
jedoch nur selten ausgelösten Fehlers in einem Teil der Speicherverwaltung,
nahmen sich die Patches recht unspektakulär aus.
Die siebte
Entwicklerversion [4] konnte
wieder mit einem besonderen Datum aufwarten, wenn auch der Jahrestag nicht ganz
„rund“ war. Am 26. August 1991 schrieb Torvalds an die Usenet-Liste
comp.os.minix [5]
seine erste Ankündigung des damals noch namenlosen Betriebssystem. Daran
angelehnt formulierte er seine Ankündigung des -rc7:
„I'm doing a (free)operating system (just a hobby, even if it's big and professional) …“
Die Zahl
der Änderungen reduzierte sich abermals und weist nur noch Korrekturen auf.
Damit dürfte die Veröffentlichung der finalen Version bald erfolgen.
Linux 3.10
Jedes Jahr wählt Greg Kroah-Hartman eine Kernel-Version aus, die er für
mindestens zwei Jahre pflegen wird. Als Ersatz für die im Oktober diesen Jahres
auslaufende Langzeit-Unterstützung des Linux-Kernels 3.0 wurde nun der
derzeitige Stable-Kernel 3.10 ausgewählt. Auch der LTSI-Kernel der Long Term Support
Initiative [6] wird künftig auf Linux 3.10
basieren.
Kernel Summit
Einer der Termine, an denen die Entwickler des Linux-Kernels zusammenkommen, ist
der Kernel Summit [7].
Zum diesjährigen, im schottischen Edinburgh
stattfindenden Kernel Summit, lädt der Hauptentwickler des Ext4-Dateisystems,
Ted Ts'o nun einige Hobby-Entwickler ein. Jeder, der am Linux-Kernel und seinen Komponenten mitarbeitet, ohne dafür
bezahlt zu werden, konnte sich hierfür bewerben.
Links
[1] https://lkml.org/lkml/2013/8/4/124
[2] https://lkml.org/lkml/2013/8/11/125
[3] https://lkml.org/lkml/2013/8/18/202
[4] https://plus.google.com/+Linux/posts/f96weYxzEu1
[5] https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ
[6] http://ltsi.linuxfoundation.org/
[7] http://events.linuxfoundation.org/events/linux-kernel-summit
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
behält die Entwicklung des Linux-Kernels im Blick, um über kommende Funktionen
von Linux auf dem laufenden zu bleiben.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
Das Internet und dessen primär HTML-basierter Inhalt ist heute allgegenwärtig.
Dem Einstellen von eigenen Inhalten stehen dabei keine fundamentalen Hindernisse entgegen -
(kostenlosen) Webspace gibt es in Hülle und Fülle. Den Inhalt für die Webseite
zu schreiben, ist in der Regel nicht das Problem, eine ansprechende Formatierung
dann schon eher. Hier hilft die CSS-Bibliothek 960-Grid-System [1].
Im Print-Bereich werden schon lange Gestaltungsraster [2]
eingesetzt. Dabei wird der Inhalt anhand (nicht sichtbarer) Rasterlinien auf
der Seite ausgerichtet. Dieses
bewährte Konzept lässt sich auch sehr gut auf HTML-basierte Webseiten
übertragen [3].
CSS macht es möglich
In der „Sturm und Drang“-Zeit des Webs wurden mehrspaltige Layouts gerne mit
Tabellen realisiert – was heute zurecht als verpönt gilt. Gemäß der Maxime
„Trennung von Form und Inhalt“ werden HTML-Seiten mit Hilfe vom Cascading Style
Sheets [4] (kurz: CSS) in Form
gebracht. Nun ist das Schreiben von eigenen Style Sheets grundsätzlich nicht
weiter schwierig, kann aber, je nach gewünschtem Ergebnis, doch recht komplex
werden. Und gerade Einsteiger und Gelegenheitswebdesigner tun sich manchmal
schwer, Elemente auf der Webseite wie gewünscht zu positionieren.
Hier kommt das 960-Grid-System ins Spiel. Dieses definiert in einer CSS-Datei
verschiedene CSS-Klassen, mit deren Hilfe man den Inhalt schnell und einfach in
Spalten ausrichten kann. Dies ist natürlich nicht nur für Einsteiger
interessant, sondern ermöglicht auch professionellen Webdesignern, schnell und
einfach zu einem Ergebnis zu kommen.
960 Pixel Breite
Das 960-Grid-System setzt auf einen 960-Pixel-breiten Darstellungsbereich.
Dieser wird automatisch zentriert auf dem Bildschirm dargestellt. Innerhalb
dieser 960 Pixel kann die CSS-Bibliothek
entweder 12-, 16- oder 24-spaltige
Layouts
erstellen. Dabei können Spalten natürlich beliebig
zusammengefasst werden. Eine Reihe von
Webseiten – u. a. auch die des Fedora-Projekts – welche
960-Grid-System nutzen, sind auf der Homepage der CSS-Bibliothek aufgelistet.
Download des 960-Grid-Systems
Bevor es los geht, werden die notwendigen CSS-Dateien benötigt. Auf der Homepage
des Projekts [1] findet sich der Download prominent verlinkt. Hier lädt man
allerdings eine ca. 4 MB große zip-Datei herunter. Diese enthält viel mehr als
nur die CSS-Dateien. In dem Archiv sind unter anderem auch Layoutvorlagen für
z. B. Gimp, Inkscape, Flash und diverse kommerzielle Design-Programme enthalten.
Die eigentlichen CSS-Dateien befinden sich im Ordner /code/css. Benötigt
werden drei Dateien: 960.css, text.css und reset.css.
Alternativ kann man nur diese drei Dateien bei Github herunterladen [5].
Ein einfaches Beispiel
Um die CSS-Bibliothek zu nutzen, müssen die drei weiter oben genannten Dateien
in der richtigen Reihenfolge eingebunden werden. Davon ausgehend, dass die
Dateien im Verzeichnis css liegen, müssen in der eigenen HTML-Datei die
folgenden drei Zeilen im <head>-Bereich der Seite eingefügt werden:
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/text.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/960.css" />
reset.css setzt die Einstellung für alle Element zurück, text.css definiert
ein einfaches Format für die diversen HTML-Elemente, 960.css enthält die
eigentlichen Klassen zur Layout-Gestaltung. Wer noch ein eigenes Stylesheet
benötigt, der kann dies danach noch einbinden.
Eine komplette HTML-Datei sieht dann z. B. so aus:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>960 Grid System - freiesMagazin</title>
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/text.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/960.css" />
</head>
<body>
<div class="container_12">
<h2>
12-spaltiges Layout
</h2>
<div class="grid_12">
<p>
Dieser Text geht über die volle Breite aller zwölf Spalten.
</p>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="grid_4">
<p>
Dieser Text geht über die ersten vier Spalten.
</p>
</div>
<div class="grid_8">
<p>
Und dieser Text geht dann über die verbleibenden acht Spalten.
</p>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</body>
</html>
Listing: 960gridsystem.html
Wie darin zu sehen ist,
ist der Einsatz der CSS-Bibliothek recht einfach.
Als erstes wird innerhalb eines <div>-Elementes, welches den zu
formatierenden Inhalt umschließt,
die CSS-Klasse container_12 festgelegt. Diese steht für
ein 12-spaltiges Layout. In den darauf folgenden <div>-Elementen wird über
class="grid_X" festgelegt, über wie viele Spalten das Element sich erstrecken
soll. Hier also im ersten Fall über 12 Spalten, also die volle Breite, im
zweiten Fall über vier und acht Spalten.
Wichtig ist, dass nach jedem Wechsel der Spaltenzahl ein <div class="clear"></div>
eingefügt wird, damit der folgende Inhalt korrekt dargestellt wird.
Der Einsatz von class="grid_X" ist übrigens nicht auf <div>-Elemente beschränkt,
sondern kann auch auf andere HTML-Elemente angewendet werden. Wer ein 16- oder
24-spaltiges Layout benötigt, der ersetzt einfach class="container_12" durch
class="container_16" bzw. class="container_24". Wichtig ist noch, dass sich die
Werte von grid_X immer auf die angegebene Gesamtspaltenzahl addieren.
Eine Übersicht über die Spaltenbreiten ist auf
der Demo-Seite des Projekts zu finden [6].
Weitere Möglichkeiten
Das oben gezeigte, zweispaltige Layout mittels grid_4 und grid_8 ist z. B.
recht praktisch, um schnell und unkompliziert einen Navigations-
und einen
Inhaltsbereich zu erstellen. Aber vielleicht sähe es ja besser aus, wenn der
grid_4-Bereich rechts wäre und der grid_8-Bereich links? Um
dies schnell zu
testen, kennt das 960-Grid-System noch die Klassen push_X und pull_X, wobei
das X auch hier für eine Zahl steht.
Um
die Spalten zu tauschen, werden die beiden Zeilen im
Listing oben geändert:
<div class="grid_4 push_8">
<div class="grid_8 pull_4">
Das ist alles. Wird die Seite im Browser neu geladen, dann sind die Spalten
vertauscht.
Oder vielleicht soll aus optischen Gründen noch eine Leerspalte zwischen dem
4-spaltigen und 8-spaltigen Bereich stehen? Dazu ersetzt man die beiden Zeilen
wie folgt:
<div class="grid_4 suffix_1">
<div class="grid_7">
Wer eine Leerspalte davor statt dahinter benötigt, der nutzt statt der CSS-Klasse suffix_X
einfach prefix_X.
Unterspalten
Sollte eine weitere Unterteilung innerhalb der Spalten notwendig sein, so kennt
das 960-Grid-System auch eine Lösung.
Um den grid_8-Bereich gemäß obigen Beispiel nach dem vorhandenen Text noch
weiter in zwei vierspaltige Bereiche aufzuteilen, wird nach dem </p> noch
folgendes HTML eingefügt:
<div class="grid_4 alpha">
<p>Erste Unterspalte.</p>
</div>
<div class="grid_4 omega">
<p>Zweite Unterspalte.</p>
</div>
Die Klassen alpha und omega stehen dabei für die erste und letzte
Unterspalte.
Alternativen
Das 960-Grid-System ist nicht die einzige CSS-Bibliothek, die solche
spaltenbasierten Layouts vereinfacht. So bietet z. B. auch die zur Zeit recht
populäre, von Twitter entwickelte CSS-Bibliothek
bootstrap.css [7] ein Grid-System. Dieses ist
940 Pixel breit und „reagiert“ auf unterschiedliche
Media-Queries [8]. Hier
ist die Spaltenanzahl aber auf maximal 12 festgelegt.
Des Weiteren wird früher oder später auch ein Grid-Layout direkt via CSS3
möglich sein, ohne zusätzliche Bibliotheken. Allerdings befindet sich dieses
System seitens des W3C noch im
Entwurfsstadium [9] und es gab schon
verschiedene Änderungen an der Syntax. Wann eine finale, stabile Version
feststeht und wann diese dann letztendlich von allen gängigen Browser
unterstützt wird, ist offen.
Zusammenfassung
Die CSS-Bibliothek 960-Grid-System macht es einfach, Webseiten mit einem
spaltenbasiertem Layout zu formatieren. Durch die Wahl der Gesamtbreite des
Darstellungsbereichs von 960 Pixeln sind die Layouts gleichermaßen für
Desktoprechner als auch mobile Geräte,
die zumeist nur eine geringere Bildschirmauflösung besitzen,
geeignet.
Links
[1] http://960.gs/
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltungsraster
[3] http://www.egh-online-media.de/onlinemedien/professionelles-webdesign/der-raster-im-webdesign.html
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
[5] https://github.com/nathansmith/960-Grid-System/tree/master/code/css
[6] http://960.gs/demo.html
[7] http://getbootstrap.com/
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Responsive_Webdesign
[9] http://dev.w3.org/csswg/css-grid/
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle (Webseite)
programmiert ab und an Python-basierte
Webapplikation. Das 960-Grid-System benutzt er dabei, um den Inhalt „in Form“ zu
bringen.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Sujeevan Vijayakumaran
Als Linux-Anwender greift man häufig zur Shell, um mit dieser zu arbeiten,
beispielsweise zur Aktualisierung oder Installation von Paketen.
Liquid prompt [1]
erweitert automatisch die Kommandozeile um einige nützliche Funktionen
und ist besonders für die Nutzer geeignet, die viel mit der Shell arbeiten.
Dabei wird sowohl die Bash [2] als auch die zsh [3] unterstützt. Welche Features es hat
und in welchen Fällen es ziemlich nützlich ist, wird im Artikel
erklärt.
Installation
Für die Installation von Liquid prompt gibt es für die gängigen
Distributionen kein Paket, stattdessen kann man sich
den aktuellen Stand
aus dem Git-Repository herunterladen und dann nutzen. Dazu muss git installiert
sein. Zunächst holt man den aktuellen Stand vom GitHub-Repository:
$ git clone https://github.com/nojhan/liquidprompt.git
Im Anschluss kann man Liquid prompt mit folgendem Befehl aktivieren:
$ source liquidprompt/liquidprompt
Hiermit wird Liquid prompt allerdings nur ein einziges Mal aktiviert. Um es
dauerhaft zu aktivieren, muss der obere Befehl in die .bashrc bzw. in die
.zshrc kopiert werden, je nachdem welche Shell man nutzt. Dabei muss
beachtet werden, dass der absolute Pfad eingetragen wird.
Im letzten Schritt kann Liquid prompt noch sehr gut konfiguriert werden.
Die Konfigurationsdatei liegt unter
liquidprompt/liquidpromtrc-dist.
Diese Datei sollte dann entweder nach ~/.config/liquidpromptrc oder
nach ~/.liquidpromptrc kopiert werden.
Die Installation von Liquid prompt ist hiermit abgeschlossen. Bei Erscheinen
einer neueren Version reicht es, ein git pull im Verzeichnis liquidprompt
auszuführen.
Was es kann
Bis jetzt wurde noch nicht wirklich erklärt, was Liquid prompt wirklich kann.
Die Aktivität von Liquid prompt merkt man im schlechtesten Falle gar nicht. Dies
hängt meist davon ab, in welchem Verzeichnis man sich gerade befindet. Der
Anwendungsfall von Liquid prompt ist nämlich ziemlich variabel, nicht zuletzt
deswegen heißt es „liquid“ (auf Deutsch: „flüssig“).
Bei einer reinen Bash, d. h. ohne eine modifizierte .bashrc, sieht die Prompt
in etwa so aus:
[sujee@thinkpadx ~]$
Den meisten dürfte bekannt sein, dass hierbei vier Dinge angezeigt werden: Der
Benutzername (hier: sujee), der Rechnername (hier: thinkpadx), das aktuelle
Verzeichnis (hier: ~) sowie das Dollar-Zeichen, die eigentliche Shell-Prompt.
Wie oben beschrieben, aktiviert man mit
$ source ~/liquidprompt/liquidprompt
Liquid prompt. Bei einer angepassten Konfiguration von Liquid prompt
erscheint das Home-Verzeichnis beispielsweise mit weiteren Informationen:
11:24:51 ⌁58% [sujee:~] $
Dies wäre zum einen die aktuelle Uhrzeit und zum anderen der aktuelle Ladestatus
des Laptop-Akkus. Die einzelnen Elemente der Prompt werden dabei farbig dargestellt.
Für die einzelnen Funktionen gibt es in der Konfigurationsdatei Schalter zum
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion. Die Uhrzeit in der Prompt ist im
Standard ausgeschaltet. Zum Aktivieren reicht es,
LP_ENABLE_TIME=1
zu setzen.
Die Konfigurationsdatei ist generell ziemlich gut kommentiert, sodass man
recht gut sieht, welcher Schalter welche Funktionen auslöst.
Für Entwickler
Für Entwickler ist besonders die Funktion für die verschiedenen Versionsverwaltungssysteme
interessant und ziemlich nützlich. Unterstützt werden Git, Subversion, Mercurial,
Fossil und Bazaar. Liquid prompt erkennt automatisch, wenn man sich in einem
Verzeichnis befindet, welches ein
Repository [4] der oben genannten Versionsverwaltungssysteme
ist.
Beim Betreten eines Git-Repositorys wird angezeigt, in welchem Zweig man sich
befindet und ob lokale Änderungen durchgeführt worden sind, die noch nicht
in das Repository übertragen wurden. Wenn keine lokalen Änderungen vorhanden sind,
wird der Zweigname in Grün angezeigt, wenn doch, wird er in Rot dargestellt
und in Klammern die Anzahl von hinzugefügten und gelöschten Zeilen
angezeigt. Entwicklern kann dies zum Teil Arbeit ersparen, da so ein
Prüfen des Repositorys mit git status nicht notwendig ist. Ähnliche Funktionen
sind dabei auch für andere unterstützte Versionsverwaltungssysteme enthalten.
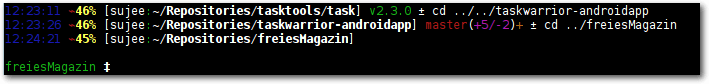
Ansicht von Repository-Informationen mit der Uhrzeit und der aktuellen Ladekapazität des Akkus.
Weitere Anzeigen
Neben diesen Features können noch einige System-Informationen dargestellt werden.
Im
Standard werden jedoch nur wenige Informationen dargestellt. Diese erscheinen
nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind. So wird unter anderem die Systemlast nur
dann angezeigt, wenn diese sehr hoch ist. Das gleiche gilt dabei auch für die
Prozessor-Temperatur. Diese Werte lassen sich aber ebenfalls sehr gut und
individuell anpassen.
Liquid prompt besitzt noch einige weitere Funktionen, die hier nicht weiter
aufgeführt werden. Wer die komplette Funktionsvielfalt nachlesen möchte,
findet eine Feature-Liste in der README des GitHub-Repositorys [5].
Darin wird auch erklärt, wie man beispielsweise die Reihenfolge der Elemente der Prompt
vertauschen kann oder auch die Nutzung verschiedener Themes. Auch die
Anpassung
von einzelnen Farben eines Themes ist möglich.
Fazit
Der Nutzer kann dabei Liquid prompt
vollkommen nach seinem eigenen Gefallen anpassen. Besonders für Shell-Liebhaber
bietet Liquid prompt sehr viele nützliche Features, die die Funktionen der Prompt
deutlich erweitern und somit auch die eigene Arbeit erleichtern. Durch die
hohe
Anpassungsfähigkeit kann jeder Benutzer selbst seine Prompt
designen.
Links
[1] https://github.com/nojhan/liquidprompt
[2] http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html
[3] http://zsh.sourceforge.net/
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Repository
[5] https://github.com/nojhan/liquidprompt#features
| Autoreninformation |
| Sujeevan Vijayakumaran (Webseite)
stolperte vor einigen Monaten über Liquid prompt, nachdem er einen Blog-Artikel
gelesen hatte und war von Anfang an von den Möglichkeiten, die Liquid prompt
bietet, begeistert.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Florian E.J. Fruth
Passt ein Artikel über Steam überhaupt in dieses Magazin? Gerade weil Valve
mit Steam für Linux nicht nur positives Feedback erhalten hat, sollen die
Vor- und
zu einem Teil auch die
Nachteile zum anstehenden zehnten
Geburtstag [1] als
Diskussionsgrundlage dargestellt werden. Vor allem an der Frage, ob Steam der
Linux-Community eher hilft oder schadet, scheiden sich die Geister.
Kurz nach der Jahrtausendwende war Linux als Standardbetriebssystem auf
Desktops die Ausnahme. Nur von einigen wenigen Kennern und in Teilbereichen von
Universitäten wurde Linux als Standard gelebt. Sehr häufig war jedoch auch
weiterhin eine Windows-Partition mit auf der gleichen Festplatte, da es zu
viel Software gab (und leider immer noch gibt), die nur mit Windows
lauffähig war (z. B. Microsoft Outlook, Autocad, SteuerSparErklärung). Ein
weiterer Teilbereich, der fast ausschließlich auf Windows setzte, war die
Spielebranche. Electronic Arts hat beispielsweise als einer der großen
Publisher bis heute nur rudimentäre Gehversuche unter Linux vorzuweisen,
mit zwei Browserspielen, die im Ubuntu Software Center veröffentlicht
wurden [2]
und auch bei den meisten anderen Publishern suchte man vergebens nach
Linux-Portierungen ihrer Spiele. Dies hatte zur Folge, dass selbst bei überzeugten
Linux-Nutzern eine Windows-Partition zum Spielen vorhanden war.
Der Anfang
Ich hatte schon sehr früh versucht, auch unter Linux nicht auf Spiele
verzichten zu müssen. Das Spiel Quake III
Arena [3]
war jedoch eine der wenigen Ausnahmen, die ohne
Probleme unter Linux lauffähig waren. Die Versuche, Windows-Spiele
unter Linux mittels Wine [4] zu starten, hatten
selten Erfolg. Im besten Fall führte dies nur zu leichten Grafikfehlern oder
Performance-Problemen.
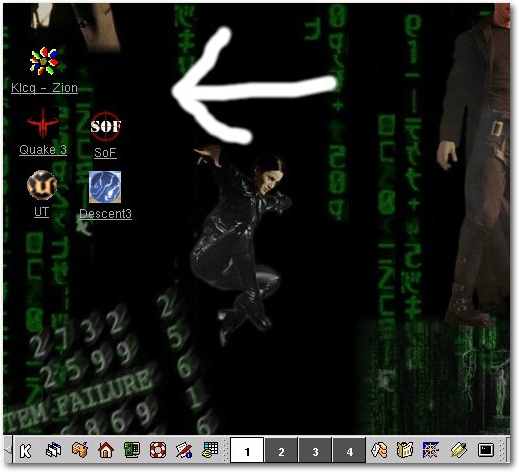
Mein Desktop im Jahr 2000.
Meist hatten die Spiele jedoch ihren Dienst komplett verweigert.
Als positives
Beispiel sei hier
Counter-Strike [5] erwähnt,
welches relativ gut unter Wine
funktionierte [6].
Dieser Umstand war wahrscheinlich der breiten CS-Spielergemeinde
geschuldet.
Anfang des Jahrtausends konnten die meisten Bewohner
Deutschlands, erstens nur
zeitweise
und zweitens nur mit einem
56k-Modem [7] im Internet surfen.
Somit „musste“ man sich für das Spielen eines Multiplayer-Spiels zwangsweise
mit Freunden treffen.
Es wurde also lange geplant, wann und wo man
sich in der Freizeit mit ein paar Hundert
Leuten in Schulen, Fabrikhallen oder ähnlichen trifft, um
gemeinsam bzw. gegeneinander spielen zu können. Eines der am weitesten
verbreiteten Spiele war der oben schon erwähnte Taktik-Shooter
Counter-Strike.
Die Grundlage
Am 12. September 2003 hat Valve mit Steam [8] die
Grundlage für ihr heutiges Geschäftsmodell gelegt.
Gedacht war Steam zuerst
als Kopierschutz, Anti-Cheat-Technologie und für die zentrale Verwaltung der
Multiplayer-Spiele aus dem eigenen Hause. Da das Spielen von aktuellen
Counter-Strike-Versionen
(v1.6 Beta [9])
auf LAN-Partys [10] damit jedoch auch
zwingend Steam voraussetzte, mussten sich viele Spieler zwangsweise bei
Steam registrieren. Somit hatte sich Valve eine breite Benutzerbasis
gesichert und diese bis heute kontinuierlich ausgebaut. Über mittlerweile
fast 10 Jahre wurden auch Spiele von Drittherstellern über Steam
veröffentlicht und die Funktionalitäten ausgebaut. Zum Beispiel können
heutzutage Spieler ihre Spielstände in der Steam-Cloud sichern, erhalten
sogenannte „Achievements“ und können plattformübergreifend spielen. Nicht
alle Hersteller verwenden dabei das Kopierschutzmodul, welches von der
Steam-Plattform zur Verfügung gestellt wird. Somit können einige über Steam
gekaufte Spiele nach der Installation kopiert und als Standalone-Variante
gespielt werden [11].
Dies sind jedoch nur Ausnahmen. Die meisten Spiele lassen sich nicht von Steam
entkoppeln.
Die Vision
Michael Larabel, der Gründer von Phoronix, hatte schon im Frühjahr 2010 erste Anzeichen dafür gefunden, dass
es neben der Mac-OS-X-Version auch eine Linux-Version von Steam geben
könnte [12].
Sicherlich waren es nicht nur Skeptiker, die diesen Andeutungen nicht den
geringsten Glauben geschenkt hatten.
Dies liegt sicher auch daran, dass Linux-Spieler doch in vielen
Jahren immer wieder von Firmen und ihren leeren Versprechen enttäuscht werden. Ein
Beispiel hierfür ist der Linux-Port des Ego-Shooters Unreal Tournament 3, welcher kurz
nach der Windows-Veröffentlichung im Jahr 2008 erscheinen
sollte [13] und
Ende 2010 aber endgültig für tot erklärt
wurde [14]. Eine
weitere Enttäuschung war ID Software, die Linux anfänglich sehr gut
unterstützt hatten und einige Spiele auf Linux portiert haben, bei ihren beiden neusten Veröffentlichungen Doom 3 BFG und Rage jedoch das Interesse an einer
Portierung für Linux verloren
hatten [15] [16].
Dies hatte zur Folge, dass Robert Beckebans als unabhängiger
Linux-Entwickler nach der Veröffentlichung des Doom3-BFG-Quellcodes das
Spiel für Linux portieren musste [17].
Als der Steam-Client Ende 2012 nun doch für Linux (insbesondere Ubuntu)
verfügbar war [18], bot sich die
Gelegenheit für die etwas vergrößerte
Anzahl an Linux-Desktop-Benutzern,
Steam unter
ihrem Standardbetriebssystem zu installieren. Die ersten
Gehversuche auf nicht unterstützten Linux-Derivaten waren noch etwas
hakelig. Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr Anleitungen (z. B. für
Debian [19])
und weniger Probleme, wenn Steam auch unter
Nicht-Ubuntu-Distributionen installiert werden soll.
Doch zurück zur eigentlichen Frage: Ist das Engagement von Valve für Linux
eher ein Fluch oder ein Segen für die Linux-Gemeinde?
Das Kapital
Ein Grundgedanke von Linux ist die GPL [20]
und damit der Gedanke, seine Programme als Open Source freizugeben. Einige
Firmen schaffen es, mit Open-Source-Software Geld zu verdienen, indem sie
z. B. kostenpflichtigen Support für Open-Source-Produkte anbieten. Als
Beispiel können hierfür sowohl große Distributionen wie
SuSE [21] und RedHat [22]
herangezogen werden, aber auch kleinere Produkte wie
OTRS [23].
Spiele-Entwickler haben jedoch keine Firmen als Endkunden, welche jährlich
für Support zahlen würden. Stattdessen muss ihr Lebensunterhalt
komplett durch den einmaligen Verkauf der Spiele bestritten werden
(Ausnahmen hiervon sind
Abomodelle [24]
und In-Game-Werbung [25]). Das
bedeutet auch, dass viele Entwickler ihr Spiel mit einem Kopierschutz
versehen, um die Umsätze zu steigern.
Steam ist hierbei eine der Plattformen, welche betriebssystemübergreifend für
Windows, Mac OS X und Linux verfügbar ist (daneben gibt es zum Beispiel noch
Desura [26], das im Gegensatz zu Steam jedoch keinen Kopierschutz mitliefert). Somit haben Spiele-Entwickler und
Spieler den Vorteil, das gleiche Produkt (und damit den gleichen
Kopierschutz) auf mehreren Betriebssystemen einsetzen zu können. Spiele
werden beim Online-Kauf beziehungsweise bei der Registrierung von im Laden gekauften
Spielen fest mit dem Steam-Konto des Benutzers verbunden. Das Verleihen an
Freunde und der Weiterverkauf von einmal registrierten Spielen ist bisher
unmöglich.
Dafür sind die Spiele jedoch nicht fest an einen PC gebunden.
Dies kann gerade dann von Vorteil sein, wenn das Spiel sowohl auf einem
Desktop-PC als auch einem Laptop unterwegs gespielt werden soll und dabei
evtl. sogar noch unterschiedliche Betriebssysteme verwendet werden.
Für kleinere Firmen (unter anderem auch Ein-Mann-Firmen) in der
Spiele-Entwickler-Branche stellt Steam die Möglichkeit einer rein
digitalen Verbreitung ihrer Spiele dar. Dies kann finanziell einen Vorteil
gegenüber der Verbreitung in Ladengeschäften darstellen. Gerade bei
unbekannten Entwicklern kann es problematisch sein, einen Publisher zu
finden, welcher das Spiel in Umlauf bringen will. Rein digitale
Verbreitungsmodelle wie Steam und Desura senken so die Hürde für Entwickler und haben bei einigen Spielen die
Veröffentlichung überhaupt erst
ermöglicht [27].
Die Privatsphäre
In der „Steam Privacy Policy
Agreement“ [28] kann man nachlesen,
welche Informationen Valve über seine Steam-Benutzer sammelt. Der Grund für das Sammeln der Daten
ist laut Valve, dass Spiele und Dienste besser an die Plattformen und
Gewohnheiten der Spieler angepasst werden sollen. Gerade diese Datensammlung
stößt einigen Vertretern der Open-Source-Gemeinde bitter auf. Sofern diese
Datensammlung positiv auslegt werden soll, ist anzuführen, dass es damit
unter anderem möglich ist, den Anteil der Linux-Distributionen unter den
Steam-Benutzern zu bestimmen [29].
Somit ist es für Spieleentwickler einfacher, zu entscheiden, ob sich eine Portierung
eines Spiels überhaupt lohnt und wenn ja, auf welche Distribution der Fokus
gelegt werden sollte.
Die Treiber
Das wichtigste Argument für Steam ist in meinen Augen jedoch die
Verbesserung der Treiber-Situation unter Linux. Primär seien hier die
Grafiktreiber von Intel, AMD und NVIDIA genannt. Und obwohl Linus Torvalds
für NVIDIA nur ein
„Fuck You“ [30] [31]
übrig hatte, haben viele Nutzer mit den binären, proprietären Treibern von
NVIDIA in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht. Es wäre
wünschenswert, wenn AMD und NVIDIA ihre Treiber direkt als Open Source in den
Linux-Kernel mit einbringen würden, allerdings gibt es aktuell im Bereich
der Spiele nur mit den binären Treibern die Möglichkeit, das Maximum aus
seiner Grafikkarte herauszuholen.
Intel hat jedoch auch dazugelernt: Die Entwicklung von der
miserablen Politik der Treibersituation des
Intel-GMA500-Grafikchips [32]
bis zur zeitnahen Unterstützung aktueller Intel-HD-Grafikeinheiten muss positiv erwähnt
werden [33].
Das Fazit
In der Hoffnung, dass dieser Artikel einige der Argumente für und
im Ansatz auch
gegen
Steam mit den dazugehörigen Hintergründen aufzeigen konnte, kann sich nun
jeder entscheiden, ob er mit der Datensammlung und dem DRM-System von Steam
leben kann oder nicht. Sofern die Entscheidung gegen Steam fällt, bleibt
immer noch die Möglichkeit, DRM-freie Spiele für Linux über Projekte wie das
Humble Bundle [34] oder
Groupees [35] zu erwerben. Hätte es bei den Humble Bundles
jedoch keine Steam-Keys dazu gegeben, wäre ihnen wahrscheinlich
weniger Aufmerksamkeit zu Teil geworden (u. a. auch aufgrund von nicht ganz
so bescheidenen
Käufern [36]).
Meiner Meinung nach hat es Valve mit dem Steam-Client für Linux und der
Portierung ihrer eigenen Spiele geschafft, zum einen die Treibersituation –
zumindest für Intel-Grafikkarten – zu
verbessern [37]
und zum anderen die Portierung von weiteren Spielen anzustoßen. Für mich überwiegen somit
die Vorteile und ich sehe den Steam-Client großteils als Segen. Zum
Vergleich: Aus den ehemals vier Linux-Spielen sind bei mir aktuell 46 unter
Linux lauffähige Spiele geworden (von insgesamt 90 Steam-Spielen in meiner
Steam-Sammlung).

Mein aktueller Steam-Account.
Die Chance
Da der Anteil der Linux-Steam-Benutzer noch weiter steigen soll, werden noch
drei Linux-Spiele für Steam verlost.
Zu gewinnen gibt es das preisgekrönte
„Bastion“ [38], „Thomas was
alone“ [39] und „Cubemen
2“ [40]. Um zu gewinnen, muss die folgende Frage
richtig beantwortet werden:
„Wie heißt (einer) der Gründer von Valve?“
Die Antworten können bis zum 8. September 2013, 23:59 Uhr über die
Kommentarfunktion unterhalb des Artikels oder per E-Mail an
 geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis
zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Die drei Linux-Spiele werden dann unter allen
Einsendern, die die Frage richtige beantworten konnten, verlost.
Links
geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis
zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Die drei Linux-Spiele werden dann unter allen
Einsendern, die die Frage richtige beantworten konnten, verlost.
Links
[1] http://store.steampowered.com/news/183/
[2] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTA5ODk
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Quake_III_Arena
[4] http://www.winehq.org/
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike
[6] http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=3507
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Modem
[8] http://www.steampowered.com/
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_(software)#Beginnings
[10] https://de.wikipedia.org/wiki/LAN-Party
[11] http://www.gog.com/forum/general/list_of_drmfree_games_on_steam/page1
[12] http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=steam_linux_script&num=1
[13] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=NTk5MQ
[14] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=ODU3NA
[15] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTIxMTQ
[16] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTA5MzQ
[17] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTI1NzE
[18] http://store.steampowered.com/news/9289/
[19] http://www.cheesed-off.com/229_cleanly-installing-steam-for-linux-beta-on-debian/
[20] http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
[21] https://www.suse.com/de-de/
[22] http://www.redhat.de/
[23] http://doc.otrs.org/3.0/de/html/commercial-support-for-otrs.html
[24] https://de.wikipedia.org/wiki/Massively_Multiplayer_Online_Role-Playing_Game#Finanzierung_und_Kosten
[25] https://de.wikipedia.org/wiki/In-Game-Werbung
[26] http://www.desura.com/
[27] http://www.statesman.com/news/technology/download-distribution-opening-new-doors-for-inde-1/nRZHP/
[28] http://www.valvesoftware.com/privacy.htm
[29] http://store.steampowered.com/hwsurvey
[30] http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/06/torvalds-nvidia-linux/
[31] http://www.youtube.com/watch?v=iYWzMvlj2RQ
[32] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTMyODA
[33] http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel_haswell_linux&num=2
[34] http://www.humblebundle.com/
[35] http://groupees.com/
[36] http://blog.humblebundle.com/post/14549340777/1-min-price-for-getting-steam-keys
[37] http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTE0MzQ
[38] http://supergiantgames.com/
[39] http://www.thomaswasalone.com/
[40] http://cubemen2.com/
| Autoreninformation |
| Florian E.J. Fruth
hatte schon im vorherigen Jahrtausend Kontakt mit SuSE und Debian Linux.
Dabei hat er schon immer versucht, auch Spiele unter seinem
Standardbetriebssystem zu nutzen.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Es ist kalt im Land, sehr kalt. Seit Jahren schon schneit es vom Himmel
herab und will gar nicht mehr aufhören. Dicke Wolken hängen über der Stadt
und lassen die Sonne nicht mehr erscheinen. Aber glücklicherweise gibt es ja
„Little Inferno Entertainment Fireplace”, den tollen, neuen Kamin fürs
Wohnzimmer. Einfach den Katalog durchstöbern, Dinge bestellen und im Kamin
verbrennen – und schon wird einem warm ums Herz. Das ist Little
Inferno [1], das Spiel!
Gefangen in der Endlosschleife
Das Spielprinzip von Little Inferno ist in der Tat so einfach, wie es in
der Einleitung beschrieben ist. In einem Katalog kauft man Dinge ein wie
Backsteine, Bauklötze, Puppen oder Teddybären, legt diese in seinen Kamin
und verbrennt sie. Für das Verbrennen erhält man Geld – und zwar immer etwas
mehr als der Gegenstand selbst gekostet hat. Und von diesem Geld kauft man
sich wieder tolle, neue Dinge zum Verbrennen.
Wäre dies das ganze Spiel, wäre man wirklich in einer Endlosschleife gefangen –
in einer sehr monotonen noch dazu. Glücklicherweise steckt etwas mehr
hinter dem Verbrennen von Gegenständen, denn es gibt sogenannte Kombos.
Verbrennt man zwei oder drei Gegenstände gleichzeitig im Kamin und passen
diese zusammen, erreicht man eine Kombo. Als Beispiel: Für die „Japanische
Kombo“ – die Namen der Kombos
plus die Anzahl der benötigten Gegenstände ist
in einer Liste dargestellt – stellt man einfach einen Spielzeug-Ninja und
ein Sushi-Röllchen in den Kamin und verbrennt diese gemeinsam.

Japanische Kombo aus Sushi und Ninja.
Was hat man aber von diesen Kombos? In der Regel bringen sie etwas mehr Geld
und zusätzlich Briefmarken ein. „Briefmarken?“ mögen jetzt manche fragen.
Genau, Briefmarken! Diese werden für das Spiel nicht unbedingt benötigt,
beschleunigen den Spielfluss aber erheblich. Jeder Gegenstand muss nach der Bestellung
im Katalog natürlich geliefert werden. Je teurer ein Gegenstand, desto
länger ist oft die Lieferzeit. Zugegeben dauert es eine gewisse Zeit, einen
ganzen Mond einzupacken
und zu verschicken… Um nicht ewig warten zu müssen,
kann man mit Briefmarken den Versand und damit die Wartezeit stark
verkürzen. Statt nach zwei Minuten Wartezeit ist das Paket dann schon in 10 Sekunden
da.
Was hat man von den Kombos aber nun – neben etwas mehr Spielspaß? Hat man
den Katalog leer gekauft – Keine Sorge! Alle Gegenstände lassen sich
beliebig oft nachkaufen! – und eine gewisse Anzahl an Kombos erreicht, gibt
es einen neuen Katalog mit tollen, faszinierenden Gegenständen zum
Verbrennen. Ob Plüschtiere, Haushaltsgegenstände oder Elektronikgeräte –
wirklich alles brennt!

Appetitliche Sachen zum Verbrennen.
Das Spiel hinter dem Spiel
Ehrlich gesagt würden auch Hunderte Kataloge und Tausende von Gegenstände den
Spielspaß auf Dauer nicht hochhalten können, wäre da nicht ein zweites Spiel
neben dem „Feuerchen machen“ eingebaut. So erhält man nämlich in
regelmäßigen Abständen Nachrichten. Zum einen vom geheimnisvollen
Wettermann, der hoch über der Stadt über den Wolken in seinem Wetterballon
sitzt und regelmäßig mitteilt, wie das Wetter wird. Und auch Miss Nancy, die
Besitzerin der Tomorrow Corporation, die „Little Inferno“-Kamine verkauft,
meldet sich ab und an zu Wort.
Am interessantesten sind aber die Briefe einer unbekannten Freundin, die
sich Sugar Plumps nennt. Sie möchte mit dem Spieler Freundschaft knüpfen und
Gegenstände tauschen. Was dahintersteckt, wird hier nicht verraten, doch es
ändert das Spiel am Ende völlig.
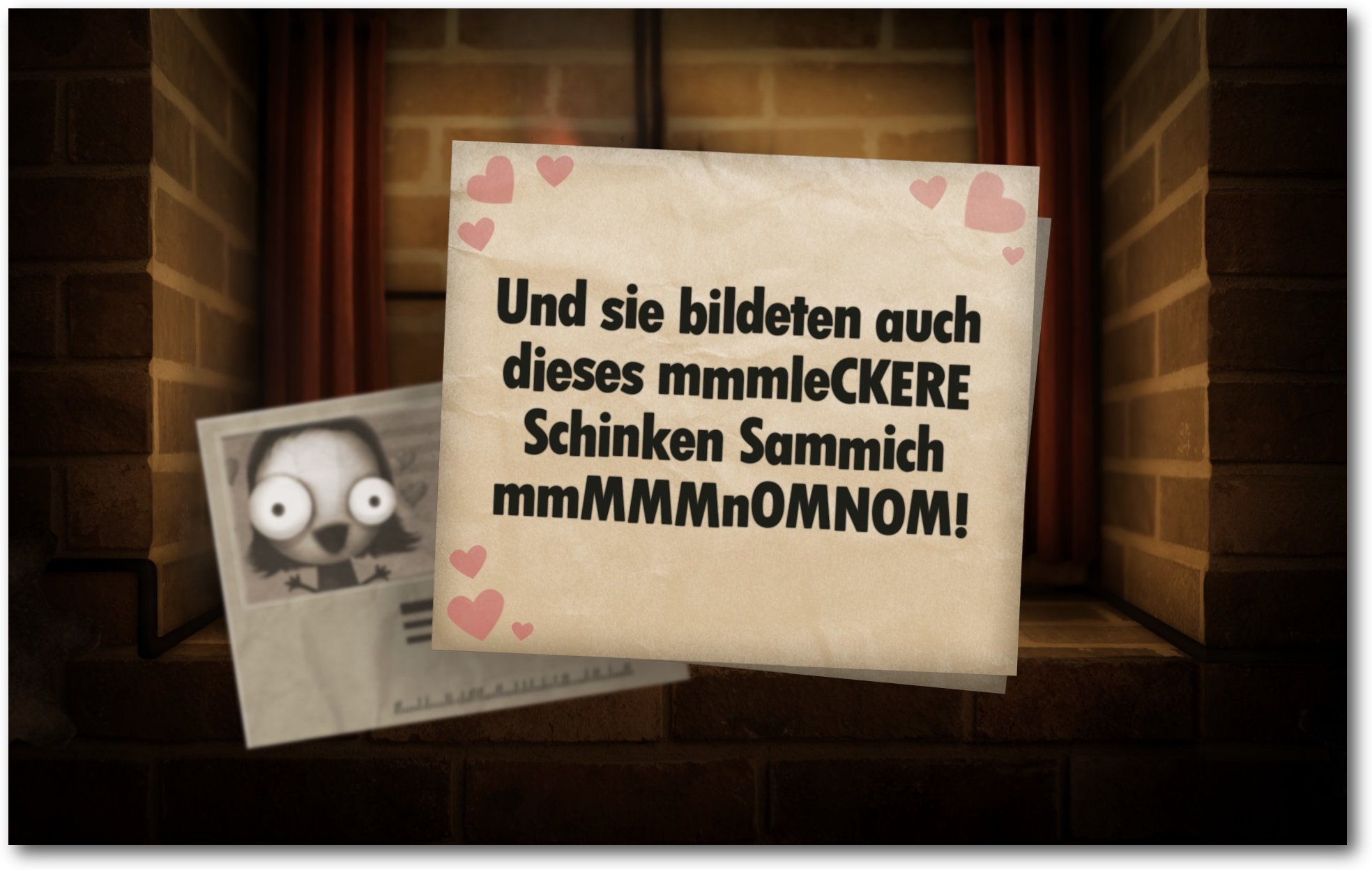
Post von Sugar Plumps.
Sozialkritik?
Auch wenn es in den letzten 15 Minuten nicht mehr um das Verbrennen von
Sachen geht – zumindest nicht direkt – bleibt der Grundton die ca. vier
Stunden, die Little Inferno dauert, eher düster. Der Humor ist mitunter sehr
schwarz und makaber und es macht Spaß, Dinge zu verbrennen. Aber irgendwann
beginnt man sich schon zu fragen: „Wieso kaufe ich Dinge, nur um diese zu
verbrennen. Sollten wir so mit unserem Geld umgehen?“
Die Antwort bleibt das Spiel schuldig. Das offene Ende lässt
Interpretationsspielraum. Aber wie schon bei „World of Goo“ (siehe
freiesMagazin 03/2009 [2],
dessen Schöpfer Kyle Gabler zusammen mit Allan Blomquist und Kyle Gray
das Spiel Little Inferno entwickelte) kann man die Kritik doch erahnen.
Ob es nun das virtuelle Geldverbrennen an der Börse ist, die
Klimaerwärmung, die die Menschen mit ihrem Hunger nach mehr
Energie antrieben
und antreiben, oder einfach nur die Sorglosigkeit, wie wir mit globalen
Problemen umgehen. Sicherlich findet jeder etwas, woran Little Inferno ihn
kritisch zu erinnern vermag. Der Trailer zum
Spiel [3] deutet das bereits an.
Glücklicherweise halten sich die Macher mit direkten Hinweisen aber zurück.
Nirgends taucht ein erhobener Zeigefinger auf (was prinzipiell gelogen ist,
denn so einen kann man in einem der Kataloge kaufen – und natürlich
verbrennen), sodass man selbst entscheiden kann, wie kritisch man das Ganze
sieht oder ob man einfach nur Spaß am Verbrennen von Dingen hat.
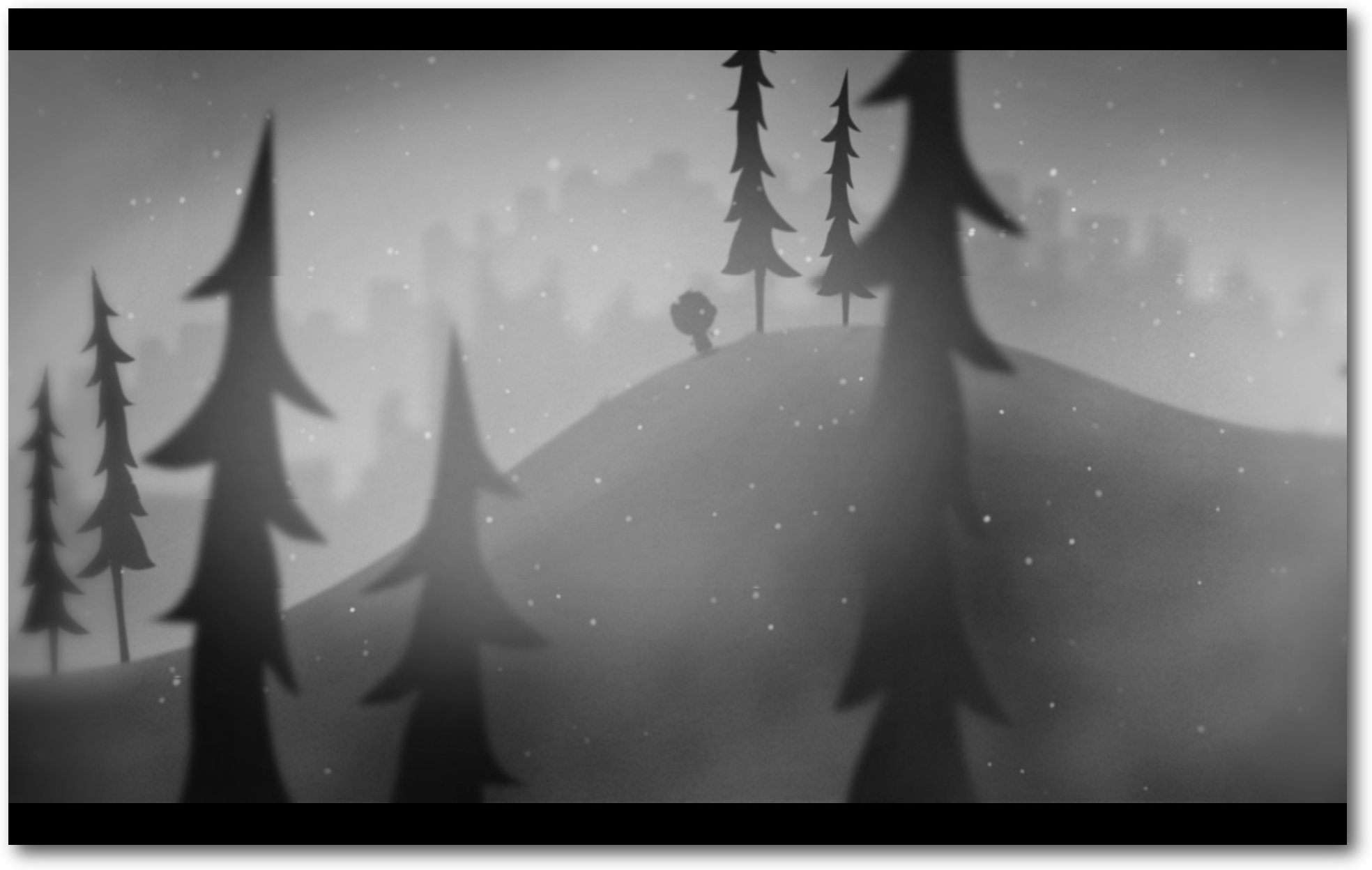
…
Technisch brillant
Technisch ist Little Inferno ebenso wie World of Goo brillant. Es erfordert
eben nicht immer alles eine riesige 3D-Engine, um ein ansprechend aussehendes
Spiel zu erstellen. Das Feuer im Kamin oder die verschiedenen Gegenstände, die
man kaufen kann – alles ist wunderschön gestaltet.
Dazu passend sind auch die großartigen und lustigen Texte. Sei es in den
Briefen der unbekannten Freundin, den Beschreibungen der Gegenstände oder in
Referenzen auf andere Indie-Spiele. Hier zeigt sich ein toller Humor – der
sogar im Deutschen funktioniert. Die Übersetzungen sind sehr gut gelungen.
Nahtlos, unaufdringlich und doch so schön, dass man ihn nebenbei anhören
kann, ist der
Soundtrack von Kyle Gabler, den es auf der Webseite zum
Anhören und kostenlosen Herunterladen
gibt [4]. Wie
schon bei World of Goo spielt Gabler mit verschiedenen Melodien, sowohl
orchestral als auch elektronisch und findet zu jeder Spielsituation und
jedem Gegenstand einen eigenen Sound.

Alles brennt so lichterloh!
Fazit
Little Inferno war Teil des achten Humble Indie
Bundles [5], was im Mai 2013 erschien. Wahrscheinlich wäre ich von selbst
nie auf die Idee gekommen, mir das Spiel einzeln zu kaufen, wäre es nicht
Teil des Bundles gewesen. Im Endeffekt bin ich froh darüber.
Wie schon bei World of Goo bietet Little Inferno viel Spielspaß und
kurzweilige Unterhaltung für zwischendurch. Es gibt keinen
20-Stunden-Story-Modus, an dem man als Gelegenheitsspieler ein Jahr lang
sitzt. Innerhalb von ein bis zwei Wochen kann man das Spiel ohne Probleme
durchspielen, wenn man sich an manchen Tagen
Abends ein Stündchen Zeit nimmt.
Wer nicht gerne beim Spielen denkt oder actionreiche Kost bevorzugt, wird
mit Little Inferno wohl weniger glücklich. Für alle anderen, vor allem eben
Gelegenheitsspieler, ist das Spiel eine wunderbare Abwechslung zum
Einheitspuzzler.
Redaktioneller Hinweis: Weil das Spiel so gut ist, will der Autor Dominik Wagenführ es gerne
unter das Linux-Spiele-Volk bringen. Deshalb gibt es ein Exemplar von Little
Inferno für Linux zu gewinnen. Hierzu muss man nur folgende Frage beantworten:
„Wie heißt das Projekt, dass Kyle Gabler zusammen mit anderen Studenten an
der Carnegie Mellon University startete und heute noch zusammen mit seinen
Mitstreitern betreut?“
Die Antworten können bis zum 8. September 2013, 23:59 Uhr, über die
Kommentarfunktion unterhalb des Artikels oder per E-Mail an
redaktion@freiesmagazin.de geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis
zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Das Spiel wird dann unter
allen richtigen Einsendungen verlost.
Links
[1] http://tomorrowcorporation.com/littleinferno
[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2009-03
[3] http://www.youtube.com/watch?v=-0TniR3Ghxc
[4] http://tomorrowcorporation.com/little-inferno-soundtrack
[5] http://blog.humblebundle.com/post/51572104517/make-way-for-humble-
indie-bundle-8
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
spielt sehr gerne, inzwischen nur unter Linux. Nach World of Goo
begeisterte ihn auch Little Inferno.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
Python [1] gilt als besonders leicht zu erlernende
Programmiersprache und ist somit gerade für Programmieranfänger interessant.
Das im Juli diesen Jahres erschienene Buch „Einführung in Python 3“ richtet sich
primär an Anfänger und behandelt die aktuelle Python Version 3 – eigentlich zwei
sehr gute Voraussetzungen.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem Carl Hanser Verlag für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplares.
Der Untertitel des Buchs lautet „in einer Woche Programmieren lernen“ – ein erst
einmal ehrgeizig klingendes Ziel. In der Einleitung bestätigt der Autor Bernd
Klein, welcher u. a. auch Kurse zum Thema Programmierung mit Python veranstaltet,
dieses Ziel nochmals. Und richtigerweise folgt dann auch direkt die
Relativierung: Ja, man kann in einer Woche Programmieren lernen
und nein, man kann dann sicherlich noch nicht jedes Problem programmtechnisch lösen.
Dreigeteilter Inhalt
Der Inhalt des Buches ist in drei Teile unterteilt.
Im ersten Teil werden dem Leser die Grundlagen von Python
vermittelt wie die verschiedenen Datentypen sowie den Umgang damit,
Kontrollstrukturen, Schreiben und Lesen von Dateien, Umgang mit Modulen und
Funktionen, Rekursion und Grundlegendes zur objektorientierten Programmierung.
Im zweiten Teil werden dann automatisierte Tests, Systemprogrammierung (mittels
des os-Moduls), reguläre Ausdrücke, List Comprehension, Generatoren sowie das
externe Modul NumPy behandelt.
Im dritten Teil gibt es dann noch drei ausführliche Beispiele inklusive
Erklärungen, welche das zuvor Erlernte vertiefen. Programmiert werden dabei ein
Modul zur Bruchrechnung, eine Textversion des Brettspiels „Master
Mind“ sowie ein
Bayes-Klassifikator [2] für
Texte.
Am Ende eines jeden Kapitels finden sich einige Übungsaufgaben zu dem zuvor
behandelten Thema. Die vollständigen Lösungen inklusive einiger Erklärungen
bilden dann den Abschluss des Buches.
Licht …
Das Buch ist durchweg gut und flüssig zu lesen, auch wenn es an diversen Stellen
doch einige Anglizismen enthält. Alle Beispiele sind vollständig im Buch
abgedruckt, sodass dieses sich auch ohne Weiteres zur „Offline Lektüre“ eignet.
Außerdem stehen alle Listings zum Download bereit.
Bei den Inhalten ist das Kapitel zur Objektorientierung und zum Erstellen eigener
Klassen gut gelungen, da von den Grundlagen bis zur Überladung von Operatoren
alles erklärt und anhand des weiter oben bereits erwähnten Moduls zur
Bruchrechnung anschaulich gezeigt wird.
Gut ist auch das Kapitel zu Iteratoren
und Generatoren – beides wird in Python ja gerne eingesetzt – sowie die
Erklärungen und Beispiele zu regulären Ausdrücken.
Das Kapitel zur Python Bibliothek NumPy ist zwar für Einsteigerliteratur eher ungewöhnlich,
behandelt aber recht kompakt und verständlich Matrizenrechnung und lineare
Algebra an Aufgaben, wie sie auch in der Schule (Mittelstufe/Oberstufe)
vorkommen. Ebenfalls sehr ausführlich ist das Kapitel zum os-Modul aus der
Python-Standardbibliothek, wobei hier aber in erster Linie Leser, welche die
Programmiersprache zur Systemprogrammierung und -verwaltung nutzen wollen, auf
ihre Kosten kommen.
… und Schatten
Aber es gibt auch inhaltliche Schattenseiten – und davon leider einige. So wird
zum Beispiel an keiner Stelle erklärt, welche Arten von Strings (Unicode- und
Bytestrings) es in Python 3 gibt. Ein Stolperstein, über den
höchstwahrscheinlich jeder Einsteiger irgendwann stolpern wird. Außerdem werden
Strings fast durchweg mittels + verknüpft. Das funktioniert zwar, jedoch gilt
es als unschön. Der empfohlene und bessere Weg mittels der String-Methode format() taucht
zwar in manchen Beispielen im Buch auf, allerdings wird er an keiner Stelle erklärt.
Und das, obwohl die Kapitel zu Strings im Buch ansonsten recht ausführlich sind.
Weiterhin wird nirgendwo im Buch auf die Python-übliche Formatierungen von
Einrückungen mittels vier Leerzeichen eingegangen – wenn auch alle Listings im
Buch korrekt formatiert sind. Einen Hinweis auf die PEP
8 [3] – den „Python Style Guide“ –
sucht man auch vergebens.
Aufgrund das Umfangs der bei Python mitgelieferten Module kann – und muss – man
als Buchautor sicherlich nicht alle behandeln. Die Auswahl im vorliegenden Buch
erscheint aber nichts desto trotz zu stark eingeschränkt, selbst für Anfänger.
Das Thema Datenpersistenz wird auf gerade zwei Seiten zum Modul pickle
abgehandelt. Mögliche Alternativen – welche Python ebenfalls an Bord hat – wie
z. B. anydbm oder SQLite werden nicht erwähnt.
Ebenso geht der Autor an keiner Stelle auf die Möglichkeiten von Python zum
Umgang mit strukturierten Daten wie XML, JSON oder CSV ein. Genau so wenig
werden Themen rund um das Internet behandelt.
Das ganze wiegt um so schwerer, da das Buch keinerlei Links oder Hinweise auf
(weiterführende) Quellen enthält, wo der interessierte Leser weiter beziehungsweise
zusätzlich lesen könnte.
Wie weiter oben erwähnt enthält das Buch ein eigenes Kapitel zum Thema
Rekursion, rekursive Funktionsaufrufe findet man in diversen Beispielen. Leider
erwähnt der Autor nirgends, dass Python von Hause aus eine eingeschränkte
Rekursionstiefe hat, noch wie man diese ändern könnte.
Ärgerlich ist auch, dass der Leser an
diversen Stellen im Buch Sätze wie „der blaue Kreis in Abbildung …“
findet, aber alle Abbildungen ausschließlich in Graustufen gedruckt sind.
Fazit
Auch wenn das Buch einige gute Kapitel und Ansätze hat, überwiegt der schwache
Eindruck. Besonders die irgendwo zwischen ungewöhnlich und unzureichend
angesiedelte Auswahl der besprochenen Python-Module machen es dem geneigten
Anfänger schwer, einen guten Einblick in die Möglichkeiten von Python zu
bekommen.
Wer sich für Python-Programmierung interessiert und auch dieses Buch in der
engeren Auswahl hat, sollte beim Buchhändler seiner Wahl einen Blick in
das Buch werfen und gegebenenfalls auch mit anderen Büchern vergleichen. Als
alleiniges Werk reicht das Buch aufgrund der zu geringen Themenabdeckung
jedenfalls auf keinen Fall.
Redaktioneller Hinweis: Auch wenn das Buch seine Schattenseiten hat, kann es sicher für den
ein oder anderen hilfreich sein, weswegen wir es hier verlosen.
Die Gewinnfrage lautet:
„Wie weiter oben erwähnt besitzt Python von Hause aus eine voreingestellte maximale Rekursionstiefe. Wie ist der Standardwert dafür?“
Die Antworten können bis zum 8. September 2013, 23:59 Uhr über die
Kommentarfunktion unterhalb des Artikels oder per E-Mail an
 geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis
zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Das Buch wird dann unter den
Einsendern, die die Frage richtig beantworten konnten, verlost.
geschickt werden. Die Kommentare werden aber bis
zum Ende der Verlosung nicht freigeschaltet. Das Buch wird dann unter den
Einsendern, die die Frage richtig beantworten konnten, verlost.
| Buchinformationen |
| Titel | Einführung in Python 3: In einer Woche programmieren lernen [4] |
| Autor | Bernd Klein |
| Verlag | Carl Hanser Verlag |
| Umfang | 447 Seiten |
| ISBN | 978-3446435476 |
| Preis | 24,99 Euro
|
Links
[1] http://www.python.org
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Bayes-Klassifikator
[3] http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
[4] http://www.hanser-fachbuch.de/buch/Einfuehrung+in+Python+3/9783446435476
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle (Webseite)
interessiert sich generell für Programmierung,
insbesondere für Python.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Niedermair
Das Buch „Rapid Android Development“ stellt eine Einführung der etwas anderen Art in die
Android-Programmierung dar. Als Grundlage dient hier die
Entwicklungsumgebung „Processing“ [1],
die einen Ersatz für Eclipse
darstellt,
der darauf abzielt, Studenten
die wesentlichen Lernziele in Sachen App-Programmierung zu vermitteln.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken O'Reilly für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplares.
Der Autor Daniel Sauter ist Künstler und Professor im Bereich „New
Media Arts“ an der Universität von Illinois (School of Art and
Design) in Chicago und Organisator der „Chicago Mobile Processing
Conference“.
Was steht drin?
Das Buch ist in 13 Kapitel mit Einleitung, Anhang und Index
aufgeteilt und umfasst 363 Seiten. Am Ende wird der Druckbogen mit 7
Seiten Werbung für andere Bücher abgeschlossen.
Der wesentliche Unterschied zu anderen
Android-Büchern
über Softwareentwicklung für Android
ist, dass
hier nicht eine Entwicklungsumgebung wie Eclipse verwendet wird,
sondern die IDE „Processing“, die einem viele Einstellungen und
Definitionen im Programmcode abnimmt und diese „unsichtbar“ im
Hintergrund erledigt. Dadurch wird der Code sehr
übersichtlich
und vom „Boilerplatecode“ befreit.
Das erste Kapitel (14 Seiten) beschreibt, welche Programme, Tools
etc. benötigt werden und wie man Processing installiert, sodass
Android-Apps erstellt werden können. Anschließend wird ein kleines
Beispiel erstellt und gezeigt, wie man dieses im Simulator startet.
Ein Export der Dateien in ein Eclipse-Android-Projekt wird kurz
beschrieben.
Im zweiten Kapitel (22 Seiten) beschäftigt sich der Autor damit, wie
man mit dem Android Touch-Display arbeitet und im Code darauf
reagiert. Als Beispiel werden „Fingerwischer“ mit farbigen Ellipsen
dargestellt. Danach wird die Ketai Library eingeführt, die viele
Funktionen bietet,
u. a. die Themen Sensorabfrage, Kamera, Location,
Gesichtserkennung, Bluetooth, WiFi, NFC und Gesten
abdeckt.
Das dritte Kapitel (28 Seiten) beschäftigt sich mit
mit der Abfrage von
Sensoren,
z. B. für Beschleunigung, Magnetfeld,
Licht,
und der
Anzeige
der jeweiligen Messwerte.
Das viertel Kapitel (23 Seiten) widmet sich dem Kompass und der
Ortsbestimmung und wie man den Weg zu einem bestimmten Ziel findet.
Kapitel fünf (32 Seiten) widmet sich der Kamera, dem Aufnehmen von
Bildern und Videos und deren Bearbeitung.
In Kapitel sechs (24 Seiten) geht es um WiFi und das Netzwerk. Im
Folgekapitel sieben (38 Seiten) wird der Netzwerkbereich mit
Peer-to-Peer, Bluetooth und WiFi-Direct erweitert.
Das achte Kapitel (23 Seiten) beschäftigt sich mit NFC (Near Field
Communication), z. B. wie man die URL von einem NFC-Tag auslesen kann.
In Kapitel neun (30 Seiten) geht es um Daten, beispielsweise, wie
man diese im Dateisystem abspeichert oder in einer SQLite Datenbank.
Das zehnte Kapitel (17 Seiten) vertieft das Thema SQLite,
beispielsweise wie man Sensordaten in der DB abspeichert.
Das elfte Kapitel (23 Seiten) stellt eine Einführung mit kleinen
Beispielen in 3D mit OpenGL dar. Im Folgekapitel zwölf (26 Seiten)
wird das Thema mit verschiedenen Shapes und 3D Objekten vertieft. Es
wird u. a gezeigt, wie man SVG-Grafiken darstellt.
Das dreizehnte Kapitel (26 Seiten) zeigt, wie man Projekte nach
Eclipse exportiert und dann Apps veröffentlicht.
Im Anhang findet man eine Übersicht der verschiedenen
Android-Versionen, die Beschreibung der Ketai Library und
Infos
zum Troubleshooting.
Am Ende folgt das Stichwortverzeichnis (13 Seiten).
Wie liest es sich?
Das Buch ist für Einsteiger geschrieben. Dem englischen Text kann
auch ein Leser gut folgenden, der nicht oft englischsprachige Bücher
liest. Durch die IDE Processing und die
Ketai-Bibliothek [2] werden
die Beispiele sehr einfach, kurz und übersichtlich. Somit wird dem
Leser sehr viel Ballast erspart und er kann sich auf das Wesentliche
beschränken. Programmiergrundkenntnisse in Java sind hier
erforderlich. Die vielen Beispiele bauen aufeinander auf und werden
bis zum Ende des Buchs immer umfangreicher und komplexer, lassen
sich aber alle gut nachvollziehen.
Alle Code-Beispiele sind ausreichend gut erläutert. Im Buch werden
nur die wichtigen Codeteile abgedruckt, der komplette Code findet
sich auf der Webseite des Verlages [3].
Jeder Anfänger kann der Beschreibung gut folgen. Der erfahrene Leser
kann ohne weiteres Kapitel überspringen, ohne dabei in anderen
Kapiteln Probleme zu bekommen.
Kritik
Das Buch ist für Einsteiger geschrieben und dafür sehr gut geeignet.
Der Autor hat es geschafft, komplexe Funktionalitäten stark zu
vereinfachen. Man merkt deutlich, dass der Autor hier viel Erfahrung
in didaktischer Reduktion hat. Will man aber umfangreichere Apps
schreiben, muss man irgendwann die IDE Processing verlassen und
beispielsweise auf Eclipse [4] umsteigen.
Toll dabei ist, dass sich alle
Processing-Projekte in Eclipse-Projekte umwandeln lassen, sodass
man dann dort aufbauen und weiterentwickeln kann. Der Umweg über
Processing lohnt sich für den Anfänger auf jeden Fall, da viele
Stolpersteine auf diesem Wege entfallen und der Spaß- und
Erfolgsfaktor erhalten bleibt.
Das Stichwortverzeichnis ist für den Buchumfang sehr gut und man
findet die entsprechenden Stellen schnell. Das
Preis-Leisungsverhältnis (Buch, Umfang und Preis) macht einen guten
Eindruck.
Gesamt betrachtet gefällt mir das Buch sehr gut und ich werde es bei
meinen Schülern als Einstiegsbuch für die Android-Programmierung
empfehlen.
| Buchinformationen |
| Titel | Rapid Android Development – Build Rich, Sensor-Based Applications with Processing [5] |
| Autor | Daniel Sauter |
| Verlag | O'Reilly, Mai 2013 |
| Umfang | 370 Seiten |
| ISBN | 978-1-93778-506-2 |
| Preis | 29,00 €
|
Links
[1] http://processing.org/
[2] https://code.google.com/p/ketai/
[3] http://pragprog.com/titles/dsproc/source_code
[4] http://eclipse.org/
[5] http://www.oreilly.de/catalog/9781937785062/index.html
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair
ist Lehrer an der Münchener IT-Schule
und Koordinator für den Bereich Programmierung und
Anwendungsentwicklung. Er beschäftigt sich seit Jahren mit vielen
Programmiersprachen, u. a. mit der Android-Programmierung.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Niedermair
Das Buch „Android 4“ stellt ein Übungsbuch dar und richtet sich an
interessierte Leser, die schon Grunderfahrung mit der
Android-Entwicklung haben und diese mit zahlreichen
Beispielen vertiefen möchten. Dabei enthält jedes Kapitel
Übungsaufgaben mit vollständigen und kommentierten Lösungen.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem mitp-Verlag für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplares.
Die Autorin Elisabeth Jung ist freie Autorin und hat früher
Grundlagen der Informatik unterrichtet. Sie hat schon einige
Übungsbücher zu Java 6 & 7, Servlets und JSP geschrieben.
Was steht drin?
Das Buch ist in drei Kapitel mit Einleitung und Index aufgeteilt und
umfasst 454 Seiten. Zum Schluss wird der Druckbogen mit zehn Seiten
Werbung für andere Bücher gefüllt.
Das erste Kapitel (34 Seiten) stellt die Architektur und
Installation von Android-Applikationen in den Vordergrund.
Angefangen vom Unterschied zwischen „Native Apps” und „Web-Apps”
und gefolgt vom Aufbau einer App geht es schnell zum ersten
Android-Projekt mit den Layout-, Ressourcen- und Klassendateien.
Abgeschlossen wird der Bereich mit der
ersten Übung „HalloApp“ mit Lösung.
Das zweite Kapitel (138 Seiten) hat das Thema „Einführung in die
App-Programmierung“.
Es wird dabei mit DDMS (Dalvik Debug Monitor
Server [1])
begonnen und dem sinnvollen Einsatz von Log-Meldungen. Es
folgt auch dann dazu gleich die erste Übung „LogCat-Meldungen
ausgeben“. Anschließend folgt die Ereignisbehandlung, sowie die
Menü- und Dialog-Klassen. Danach geht es gleich an die Telefon-,
SMS- und E-Mail-Funktion und das Android Dateisystem.
Mit den Themen Speichermedien, URLs im Browser anzeigen, Adapter-Klassen
etc. und Animation geht es weiter.
Zum Schluss folgen die Lösungen zu den
vielen Übungen.
Das dritte Kapitel (259 Seiten) widmet sich am Anfang der erweiterten
App-Programmierung mit den Themen SQLite-Datenbank, Content
Provider, Multimedia, Sensoren, Geocoding, Google Maps. Danach
folgen Prozesse, Threads und asynchrone Tasks. Weiter geht es mit
dem Veröffentlichen von Apps und dem Android SDK 4.2.2. Zum
Abschluss folgen wieder die Lösungen zu den vielen Übungen.
Wie liest es sich?
Das Buch ist als Übungsbuch ausgelegt. Es ist daher notwendig, dass man
nicht nur Java-Kenntnisse mitbringt, sondern auch bereits Erfahrung mit der
Programmierung von Android-Programmen hat.
Die Aufgabenstellungen zu den Übungen sind
klar formuliert und bauen aufeinander auf. Es folgen dann oft viele
Seiten mit Screenshots, bei denen es leider manchmal schwer fällt,
den roten Faden nicht zu verlieren. Die im Buch gezeigten Lösungen sind alle
kommentiert und mit Syntaxhighlighting werden die wichtigsten
Stellen hervorgehoben. Drucktechnisch wurde bei den Lösungen auf Leerzeilen
verzichtet, was dem Codeverständnis nicht immer gut tut. Auch wurden
die Beispiele (Sourcecode, XML-Dateien, …) komplett abgedruckt.
Der Code zu den Beispielen ist online
verfügbar, so dass man ihn nicht abtippen muss um ein Beispiel auszuprobieren
(unter „Downloads“ [2]).
Kritik
Das Buch ist als Übungsbuch geschrieben und erfüllt diesen Anspruch auch gut. Man
merkt deutlich, dass die Autorin mit Übungsbüchern Erfahrung hat.
Leider sind die Screenshots oft zu einem Paket zusammengefasst, z. B.
bei einem Block um die 80 Stück auf 20 Seiten. Hier verliert man
sehr leicht den Überblick. Die Codebeispiele mit den Kommentaren
enthalten leider keine Leerzeilen (es sollte wohl Platz gespart
werden), was gerade bei langen Listings nicht zum Verständnis
beiträgt. Zum Glück kann man diese in der IDE deutlich besser
betrachten (hier hilft die Eclipse-Funktion „Source-Format“) und kann
jeweils an die entsprechende Stelle springen.
Das verwendete
Syntaxhighlighting kann nicht immer nachvollzogen werden. Meist sind
jedoch die Klassendefinition und der Methodenkopf hervorgehoben.
Wünschenswert wäre hier jedoch eine übersichtlichere Darstellung mit einem
Auszug der wichtigsten Stellen. Den kompletten Code kann man sich dann ja in der
Datei genauer betrachten.
Die Beispiele und Übungen sind hingegen gut aufgebaut und die dazugehörigen Erklärungen
erleichtern einem das Verständnis.
Das Stichwortverzeichnis ist merkwürdigerweise erst nach einer
zusätzlichen Seite Werbung zu finden. Es sieht teilweise so aus, als
wäre das Stichwortverzeichnis automatisch generiert worden. Es sind meist viel zu viele
Seitenangaben pro Eintrag vorhanden (beispielsweise bis zu 16
Seitenangaben pro Eintrag) und der Haupteintrag ist dabei nicht
hervorgehoben, was dem Leser das Auffinden doch deutlich schwerer macht. Dabei
sind Stichwörter, Klassen und Methoden bunt gemischt.
Das Preis-Leistungsverhältnis (Buch, Umfang und Preis) macht einen
guten Eindruck, allerdings hätte der abgedruckte Quellcode etwas gekürzt werden können
um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
Gesamt betrachtet muss man trotz der oben genannten Schönheitsfehler
das Buch als gut bewerten.
Die Übungen sind gut und tragen dazu bei, dass man sich schnell und
praxisnah in die einzelnen Android-Bereiche einarbeiten kann.
| Buchinformationen |
| Titel | Android 4 – Übungsbuch für die App-Entwicklung [3] |
| Autor | Elisabeth Jung |
| Verlag | mitp, 2013 |
| Umfang | 464 Seiten |
| ISBN | 978-3-82669-501-8 |
| Preis | 24,95 € (e-book 21,99 €)
|
Links
[1] https://developer.android.com/tools/debugging/ddms.html
[2] http://www.mediendb.hjr-verlag.de/upload/upload.html?isbn=978-3-8266-9501-8
[3] http://www.it-fachportal.de/shop/buch/Android 4/detail.html,b188498
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair
ist Lehrer an der Münchener IT-Schule
und Koordinator für den Bereich Programmierung und
Anwendungsentwicklung. Er hat dort das Zusatzangebot
„Androidprogrammierung“ konzipiert und eingeführt.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
Für Leserbriefe steht unsere E-Mailadresse
 zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
Leserbriefe und Anmerkungen
Editorial
->
Ich glaube, der Rückgang liegt daher, dass es in der letzten Ausgabe nicht
so viele interessante Themen gab. Ich freue mich immer auf neue Ausgaben
und lese und downloade alle. Ich schätze eure Arbeit sehr und hoffe, dass
ihr so weitermacht!
Andreas (Kommentar)
->
Ich lade mir zwar jede freiesMagazin-Ausgabe herunter, nur ist die Anzahl der für
mich interessanten Artikeln in den letzten Monaten stark gesunken. Ich bin
ein überdurchschnittlich interessierter User, deshalb sind mir die meisten
Artikel in freiesMagazin zu technisch. Für mich von Nutzen sind Artikel über
Distributionen (z. B. Reviews zu neuen Versionen von Ubuntu und Fedora) und
über die Bedienung von Programmen. Der aktuellen Ausgabe (freiesMagazin 08/2013)
habe ich mich wieder länger gewidmet, weil die Artikel „Firefox OS”,
„Linux-Dateisysteme im Vergleich” und „XBMC” genau mein Wissensbedürfnis
befriedigen. Gratulation!!
Martin (Kommentar)
<-
Vielen Dank für die Kommentare. Wir versuchen natürlich die Vielfalt der
Artikel zu variieren, sind dabei aber stark auf die freien Autoren
angewiesen. Wenn diese lieber über bestimmte Themen wie Programmierung schreiben, dann
füllen diese natürlich mehr unsere Seiten. Aber vielleicht finden sich ja
da draußen noch mehr Autoren, die etwas zu einem nicht-technischem Thema schreiben wollen.
Dominik Wagenführ
Firefox OS
->
Firefox OS wirkt für mich wie ein (vergeblicher) Versuch, am
Smartphone-Markt mitzumischen: Da kam wohl ein Mitarbeiter von Mozilla auf
die Idee, Smartphones wären die Zukunft und Mozilla muss da jetzt
unbedingt auch was zu beitragen, nach dem Motto: „Was die haben,
brauchen wir auch!“, jedoch fehlt Mozilla hierin jahrelange Erfahrung.
Aber genau da liegt das Problem. Bei Firefox OS handelt es sich lediglich
um eine Nachmache bestehender Smartphone-Betriebssysteme, ohne jegliche
Revolution oder sehenswerte Neuerungen. Also wird es keine offensichtliche
Gründe geben, dieses System zukünftig auf Handys zu verwenden.
Gut, der wohl einzige Grund wird für manche sein, dass das System komplett
offen und frei ist, was aber die meisten potenziellen Kunden kaum
interessieren wird. Im Gegenteil, zu viel Freiheit führt für „normale”
Nutzer wieder zu Problemen. So können sie z. B. jegliche Software darauf
installieren, ohne zu wissen, was sie gerade tun, oder z. B. den Apps im
Nachhinein Rechte entziehen, was irgendwann zwangsläufig zu Problemen bzw.
Softwareabstürzen führen wird.
Ob Firefox OS ein Erfolg wird, kann nur die Zukunft zeigen, ich sehe dem
Ganzen aber sehr kritisch entgegen.
Maximilian (Kommentar)
Leserbriefe zum Raspberry Pi
->
In den Leserbriefen werden hohe Erwartungen (Blu-Ray Inhalte wiedergeben, etc.)
an den kleinen Raspberry gestellt. Zugegeben, deren Marketing suggeriert das ja
auch. […]
Ich besitze selbst einen Raspberry
und würde (trotz Marketing-Versprechen) nicht auf die Idee kommen einen 700MHz
Prozessor und 512MB RAM Full-HD Videos wiedergeben zu lassen. Bei mir leistet er
seine Dienste als „Besseres NAS“ mit DHCP, DNS und (bald auch) NIS Server für
mein Heimnetz. […]
H.Z. (Kommentar)
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gegebenenfalls zu
kürzen. Redaktionelle Ergänzungen finden sich in eckigen Klammern.
Die Leserbriefe kommentieren
Zum Index
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Sie kennen eine Linux-Messe, welche noch nicht auf der Liste zu
finden ist? Dann schreiben Sie eine E-Mail mit den Informationen zu
Datum und Ort an  .
Zum Index
.
Zum Index
freiesMagazin erscheint am ersten Sonntag eines Monats. Die Oktober-Ausgabe
wird voraussichtlich am 6. Oktober u. a. mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Desaster Recovery und Backup
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
freiesMagazin erscheint als PDF, EPUB und HTML einmal monatlich.
Erscheinungsdatum: 1. September 2013
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor. freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei Randall Munroe.
Zum Index
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 1 Sep 2013, 12:46.