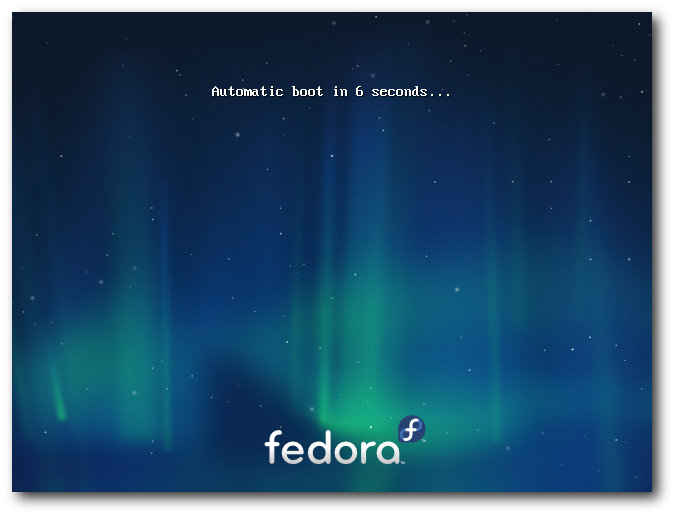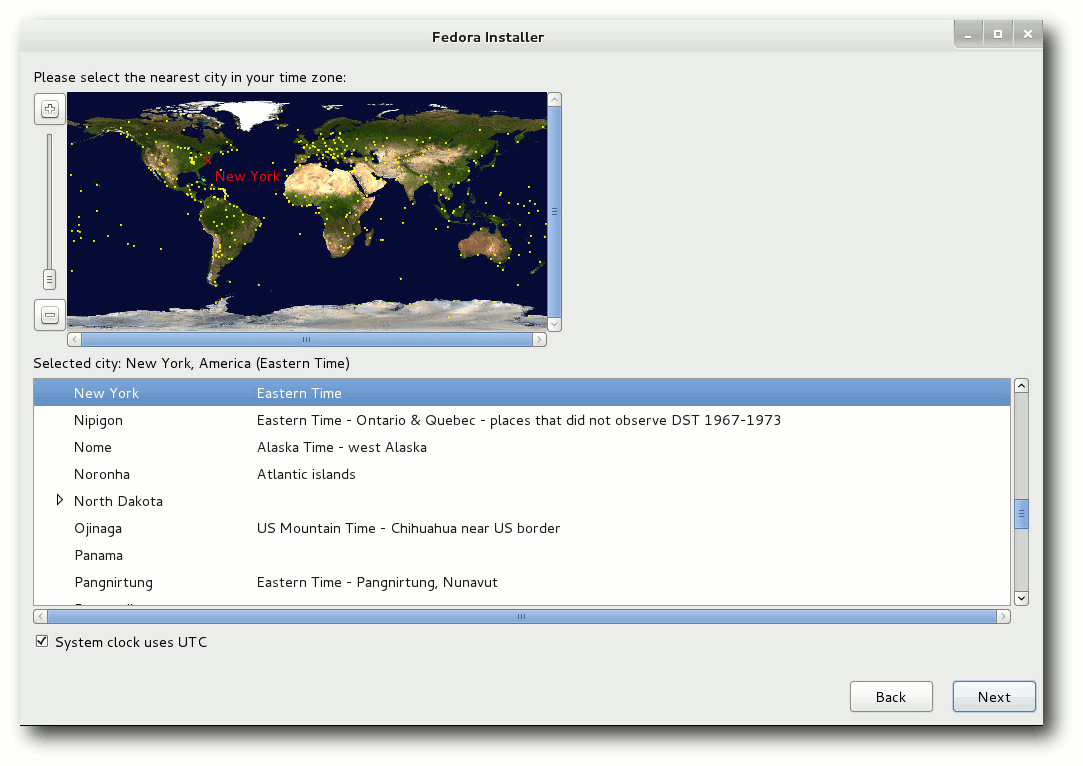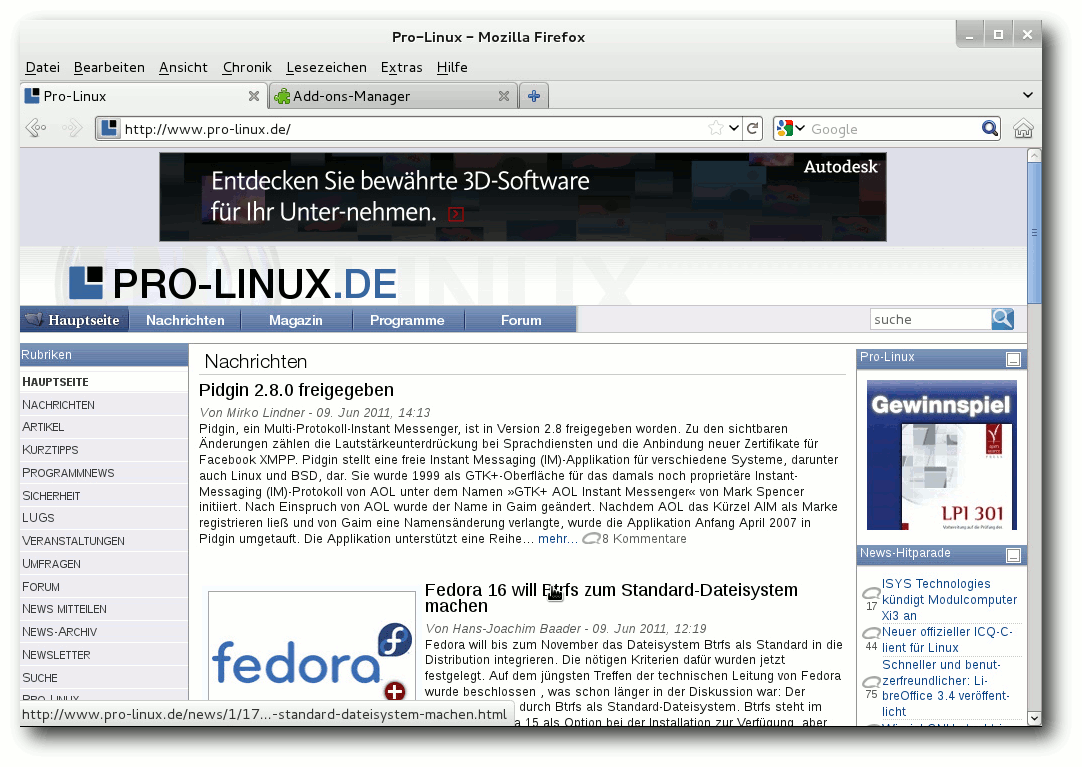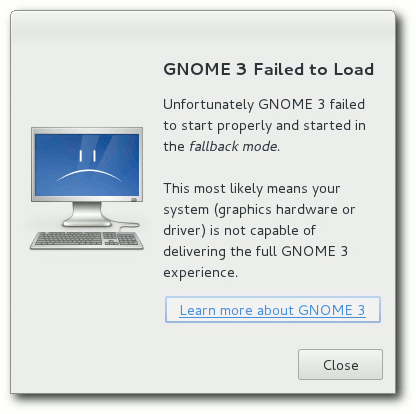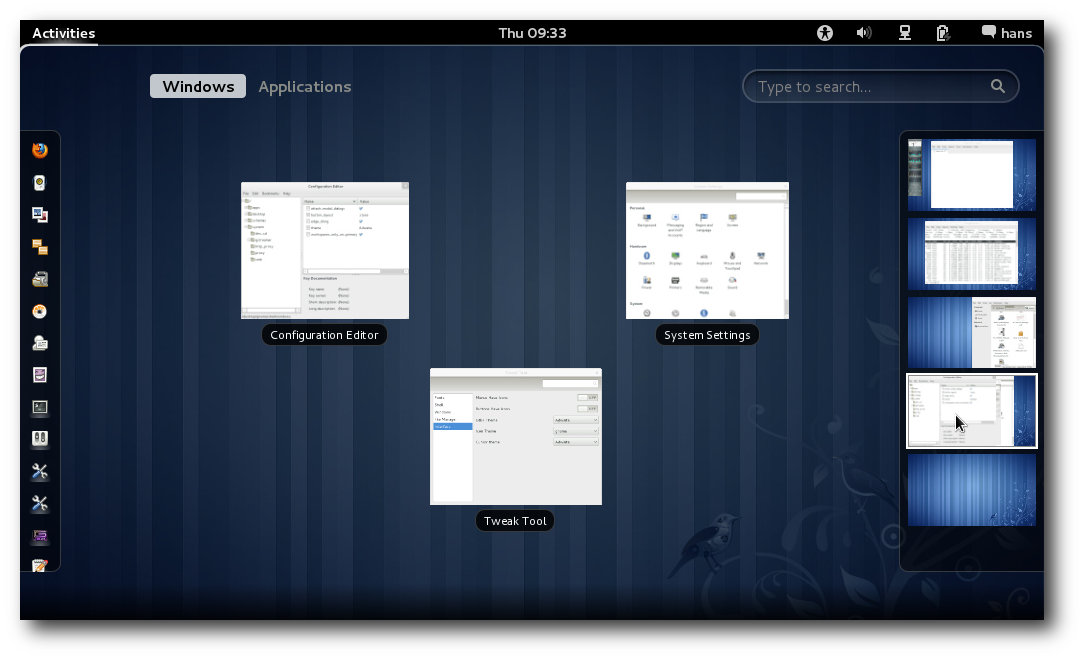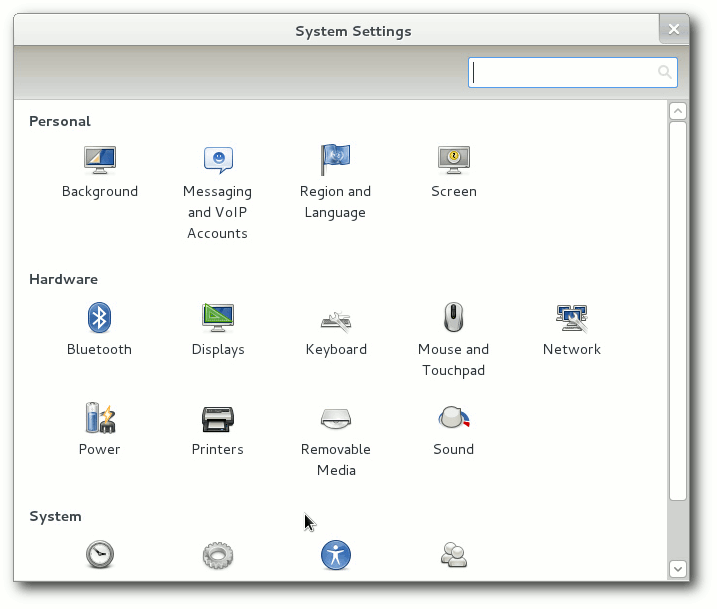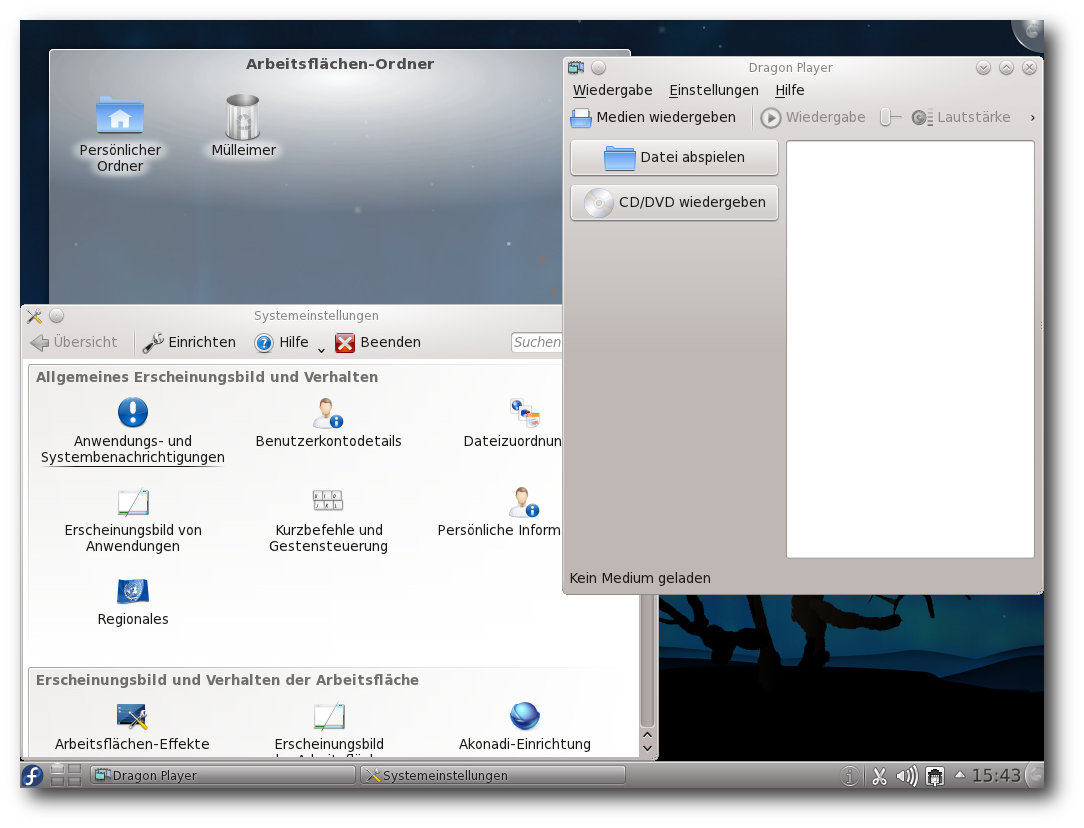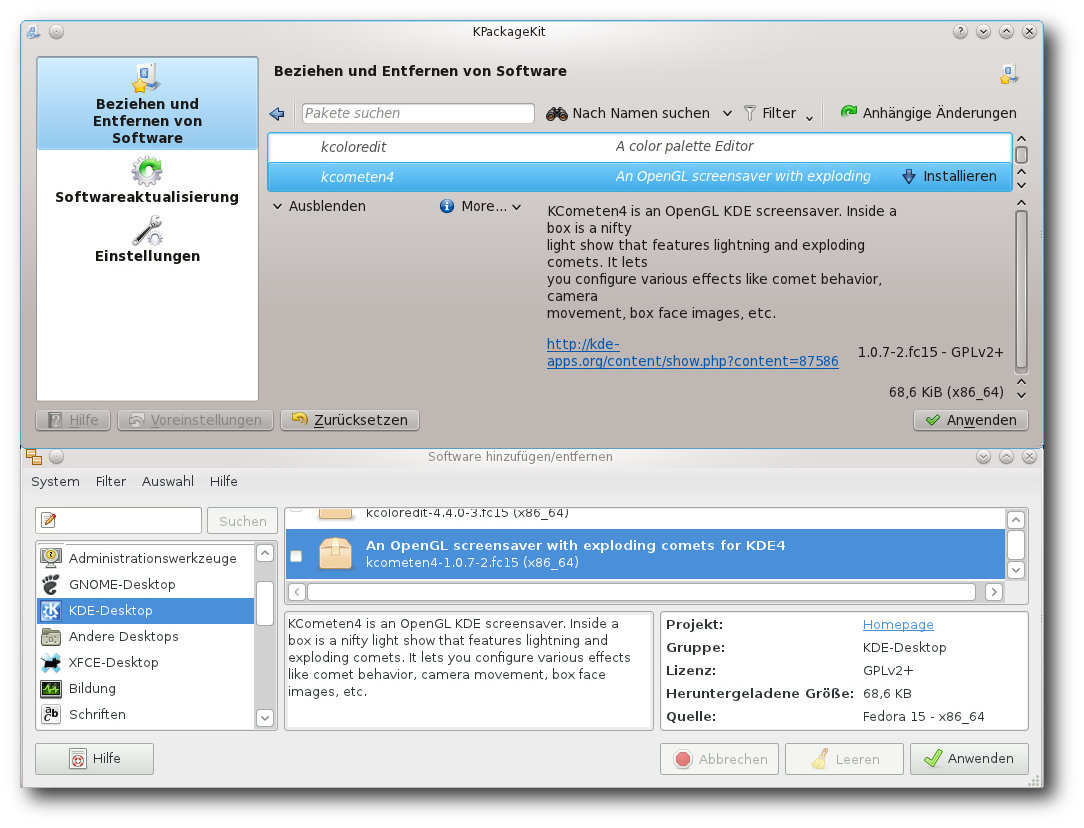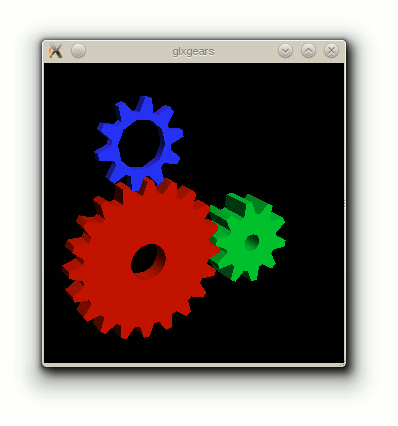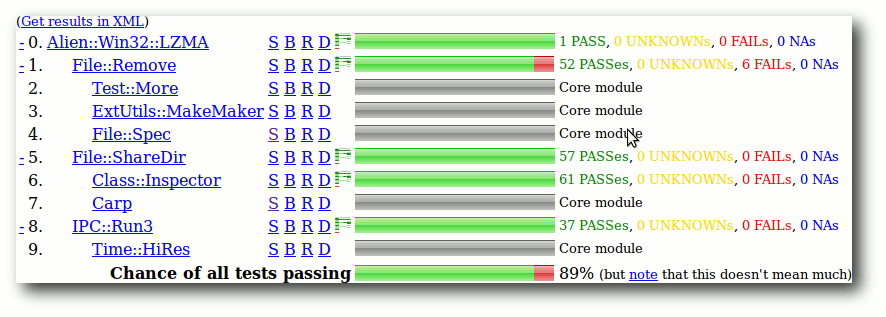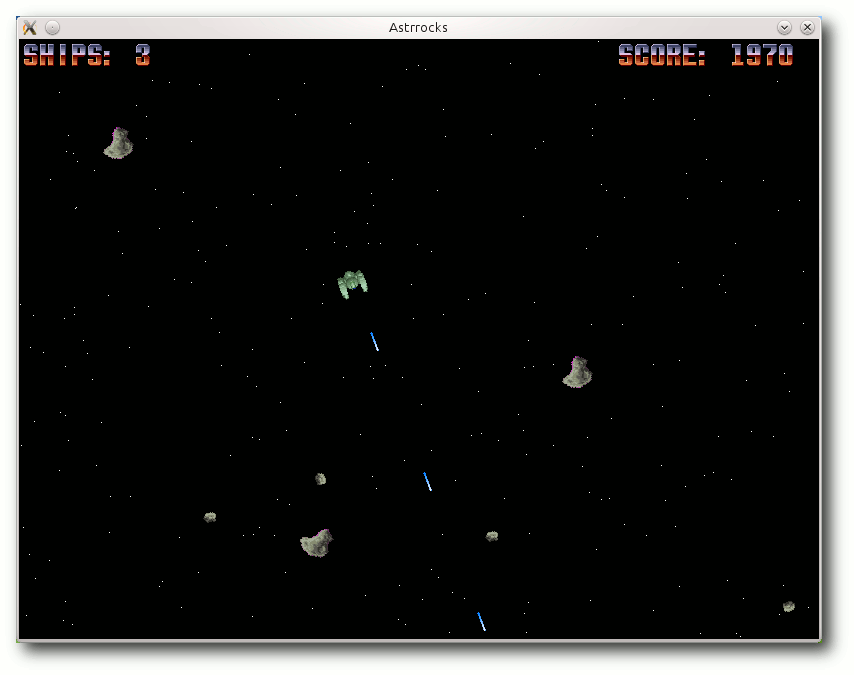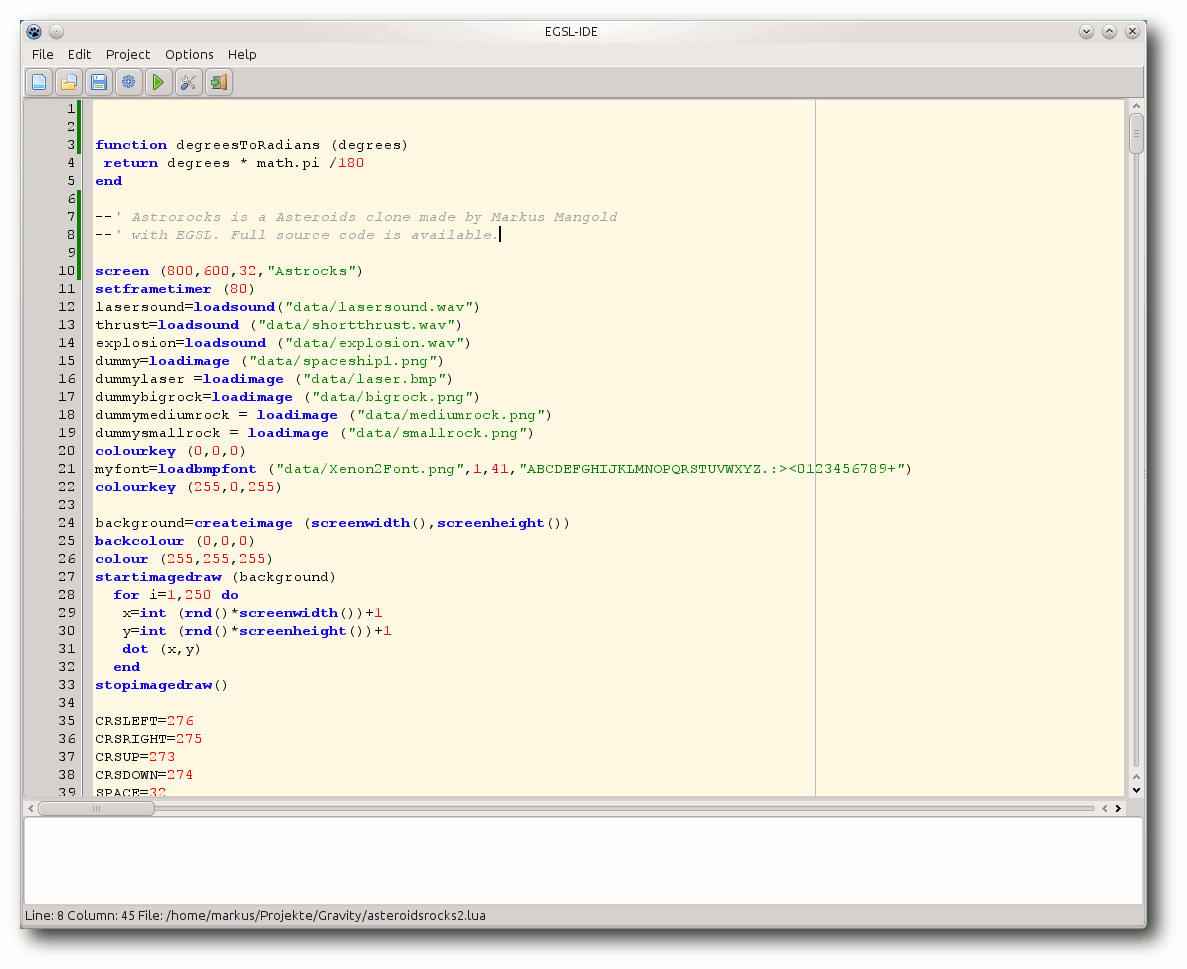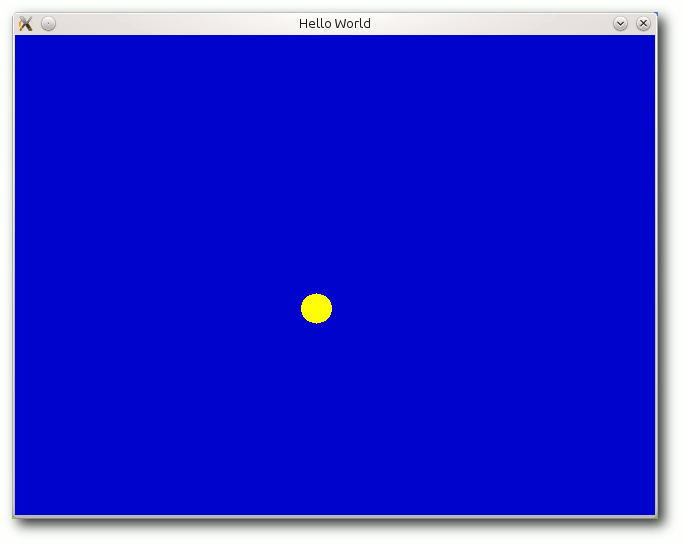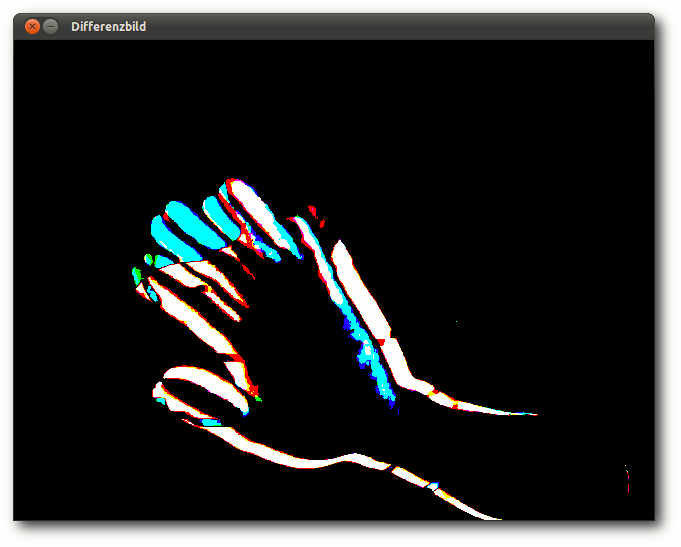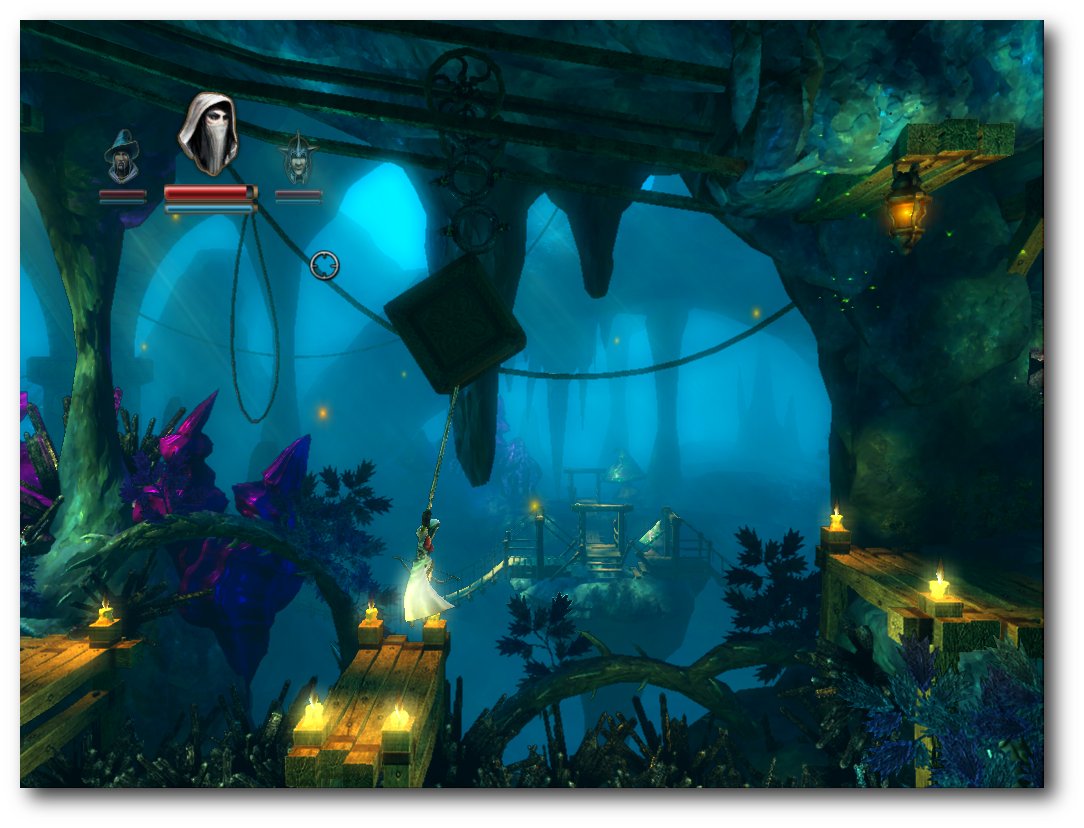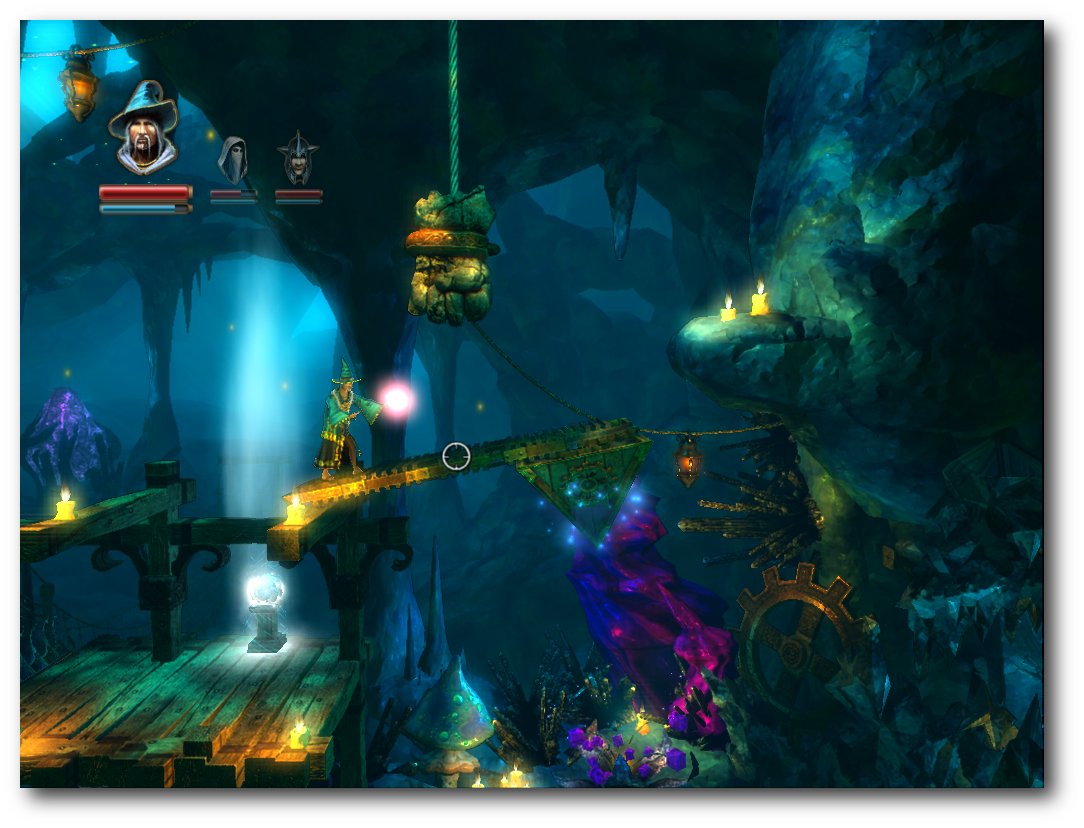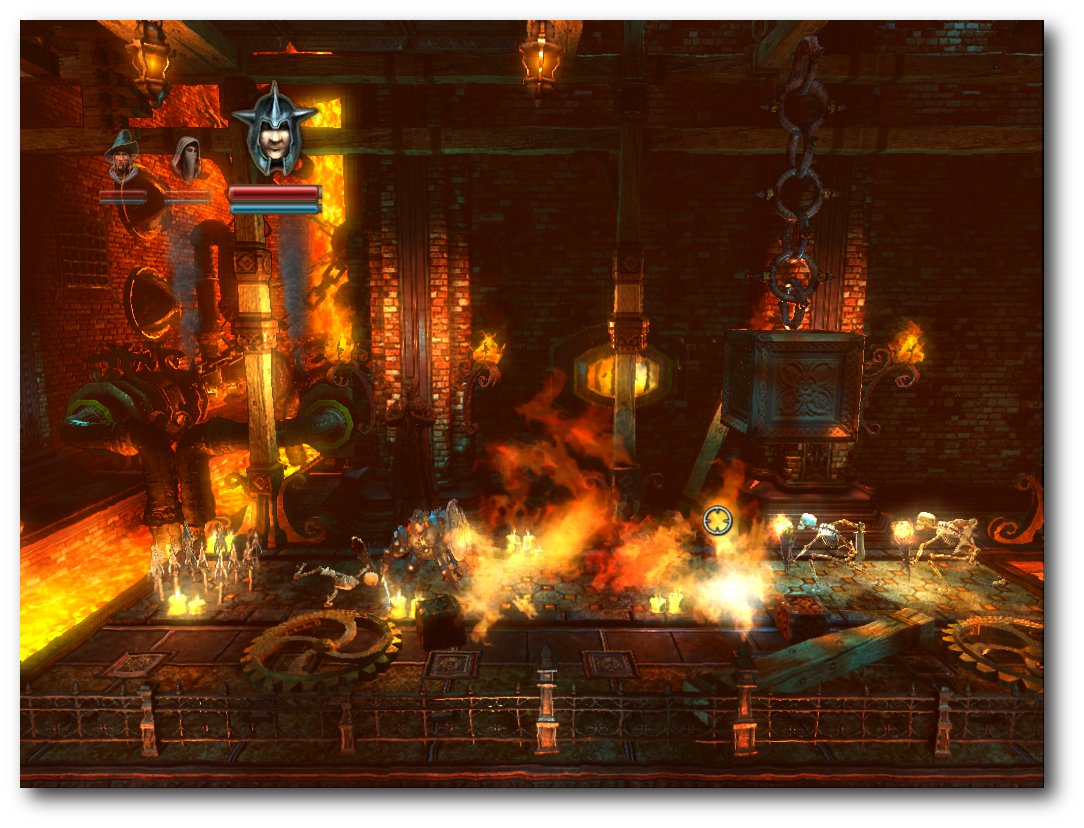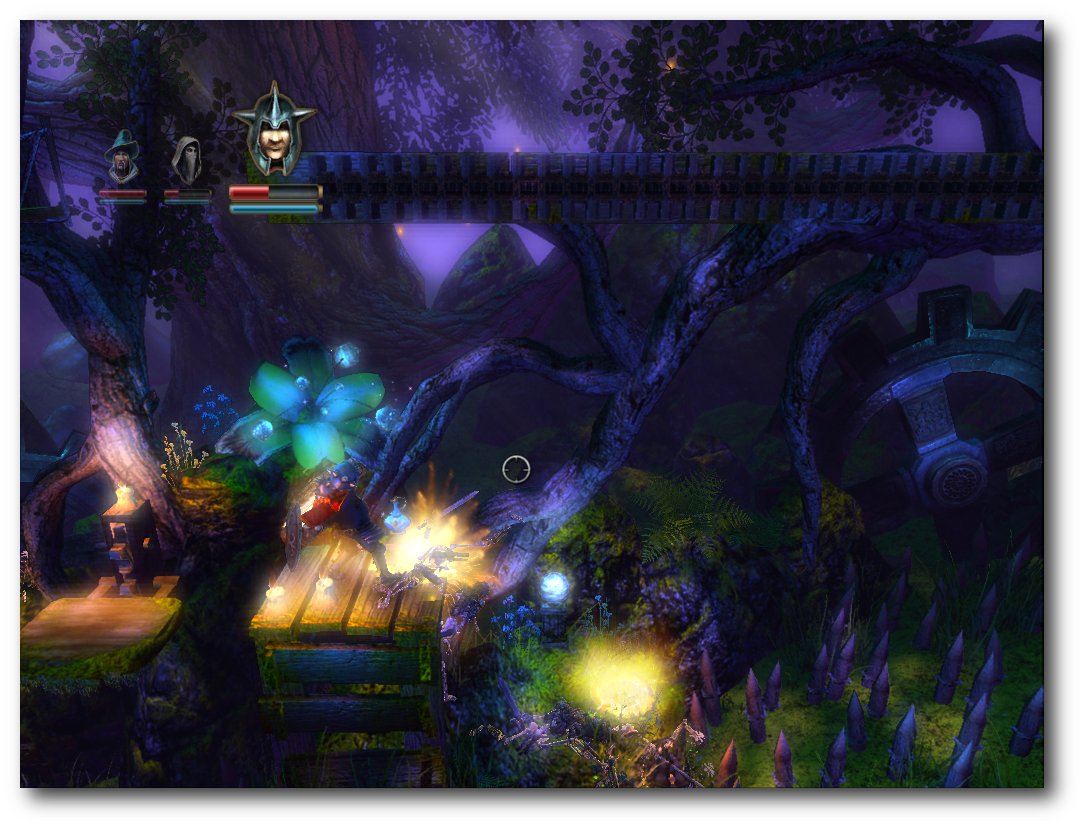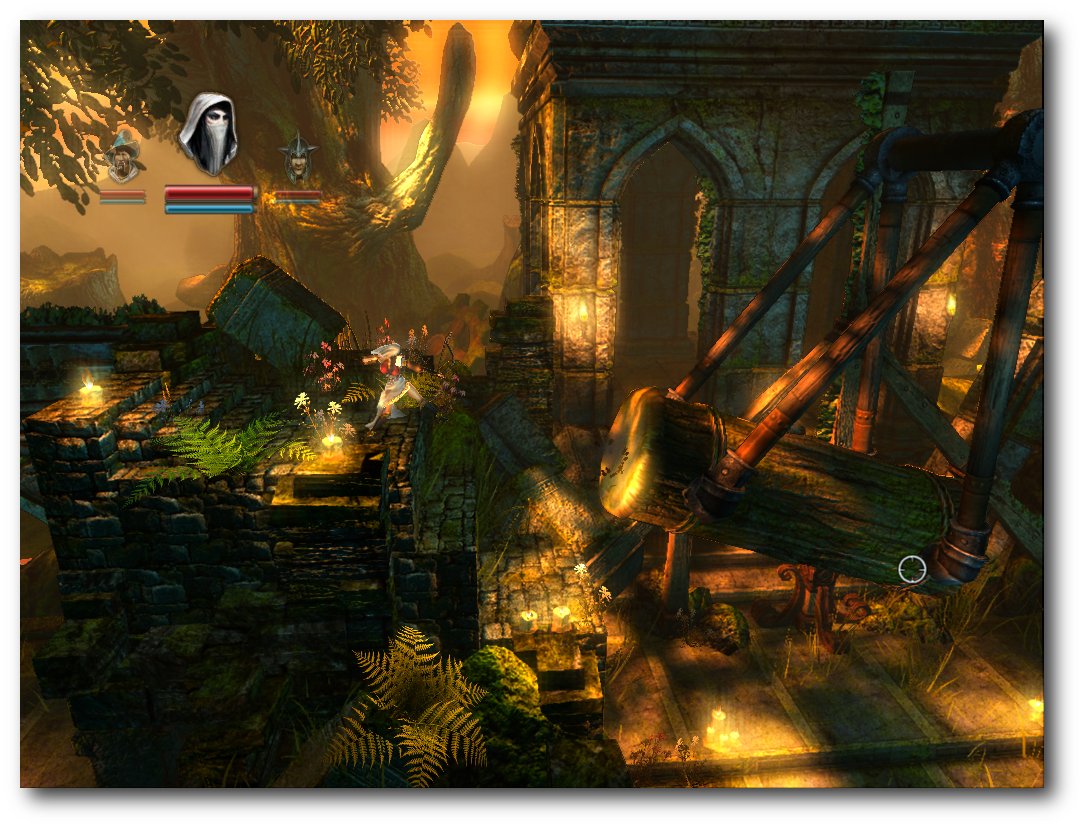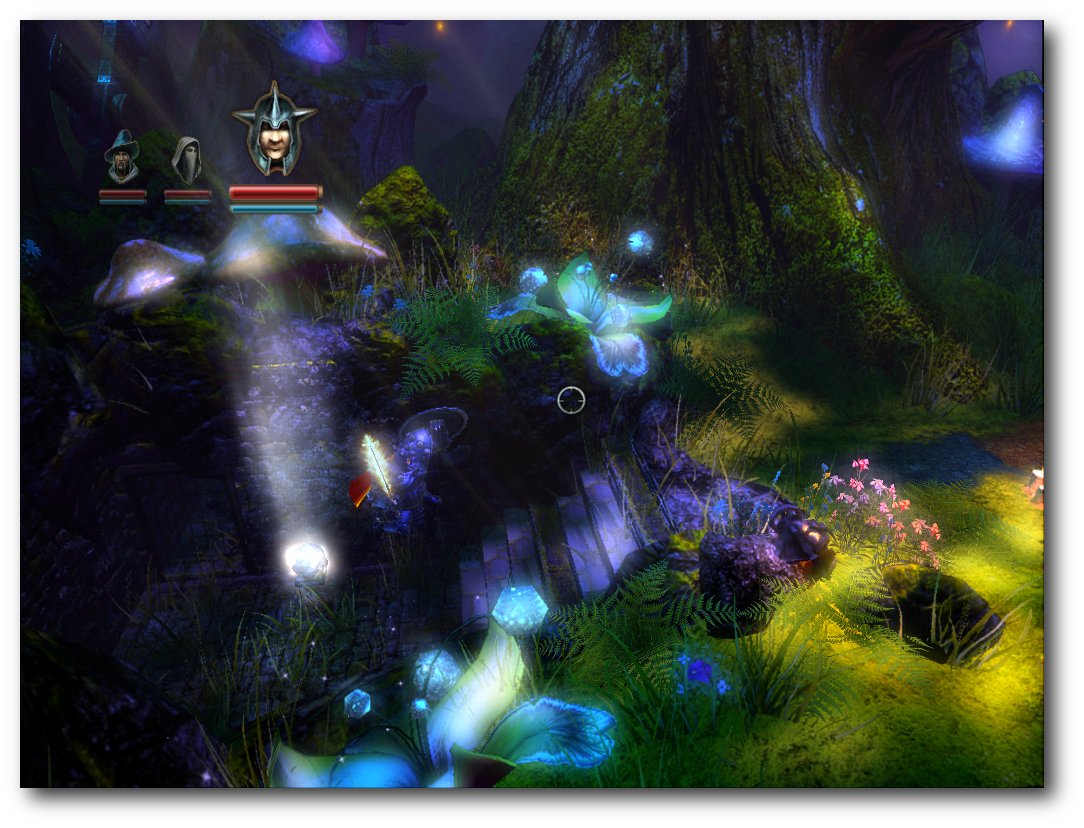Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin Juli 2011 (ISSN 1867-7991)
Topthemen dieser Ausgabe
Fedora 15
Das neu erschienene Fedora 15 will den Benutzern wie jedes halbe Jahr die neueste freie Software und neueste Technologien bringen. Zu den Highlights zählt aus Benutzersicht sicherlich GNOME 3, welches im Artikel neben KDE beleuchtet wird. (weiterlesen)
Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist Perl?
Die am 14. Mai erschienene Version 5.14 wäre ein guter Vorwand, sich mit der Sprache zu beschäftigen, die so viele emotionale Reaktionen provoziert. Ein besserer Grund sind aber die Funktionalitäten, Module, Werkzeuge und Webseiten, welche die Programmierlandschaft namens Perl in den letzten Jahren stark verändert haben. (weiterlesen)
Trine – Aller guten Dinge sind drei
Es heißt, aller guten Dinge sind drei. Und ob nun die Dreifaltigkeit, die Heiligen Drei Könige oder die drei kleinen Schweinchen, Drei kommt gut. Das hat sich wohl auch das Entwicklerstudio Frozenbyte gedacht, als sie das Spiel Trine (gesprochen wie „3n“) entwickelten. (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Fedora 15
Über Benchmarks
Der Juni im Kernelrückblick
Anleitungen
Python – Teil 8: Schöner iterieren
Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist Perl?
Easy Game Scriptin mit Lua (EGSL)
Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV
Software
Trine – Aller guten Dinge sind drei
Community
Rezension: Seven Languages in Seven Weeks
Rezension: Vi an Vim Editors
Magazin
Editorial
Veranstaltungen
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Noch mehr Programmierung!
Neue Programmierartikel
Wie in den letzten Monaten häufiger, steht freiesMagazin auch in
dieser Juli-Ausgabe einmal mehr im Zeichen der Programmiersprachen –
und das gleich über mehrere Artikel hinweg.
Wir vervollständigen die Python-Reihe in
freiesMagazin [1] [2]
um einen weiteren Artikel von Daniel Nögel mit dem Thema
„Python – Teil 8: Schöner iterieren“. Überdies startet Herbert
Breunung mit einem „Perl-Tutorial: Teil 0 – Was ist
Perl?“. Aber auch die praktische Seite der Programmierung wird
beachtet: Markus Mangold zeigt in dem Artikel „Easy Game Scripting mit Lua (EGSL)“ wie mit EGSL
kleinere zweidimensionale Spiele ohne viel Aufwand programmiert werden
können. Darauf folgt prompt der Artikel „Webcambilder einlesen und bearbeiten mit Python und OpenCV“ von
Wolfgang Wagner – Thema: mit beiden Komponenten auf Bewegungen im Bild
reagieren.
…und noch mehr Themen
Darüber hinaus wagen wir mit Mirko Lindner einen Ausblick auf das
neu erschienene Fedora 15 „Lovelock“: Änderungen und Neuigkeiten
werden vorgestellt sowie ein Draufblick auf das neue GNOME 3
gegeben, das schon an vielen Orten für Erstaunen und Verwirrung
gesorgt hat. Aber das ist noch nicht alles.
Denn kurz darauf zeigt Martin Gräßlin die
Problemstellen der sogenannten Benchmarks auf, deren Messwerte als
Zahlen oft im Gewand der Eindeutigkeit daherkommen, aber nur
vordergründig für Klarheit sorgen, solange deren Entstehung und
Kontext im Verborgenen bleiben.
Weiterhin sorgt Dominik Wagenführ, seines Zeichens
freiesMagazin-Chefredakteur, für eine Runde Kurzweil mit der Vorstellung des Spiels „Trine“, einer Mixtur
aus Physik- und Rollenspiel.
Schließlich können wir noch die Rezensionen zweier
Bücher vorweisen: Jochen Schnelle hat sich das Buch „Seven Languages
in seven Weeks“ (von Bruce A. Tate) durchgelesen und kommt zu dem
Schluss, dass dieses Buch „eine andere Art von IT-Literatur ist,
mit frischem Ansatz“. In der zweiten Rezension stellt Michael
Niedermair das Buch „Vi and Vim Editors“ vor – und der Titel ist Programm.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/20110417-python-sonderausgabe-erschienen
[2] http://www.freiesmagazin.de/20110501-maiausgabe-erschienen
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Hans-Joachim Baader
Das neu erschienene Fedora 15 will den Benutzern wie jedes halbe Jahr die
neueste freie Software und neueste Technologien bringen. Zu den Highlights
zählt aus Benutzersicht das neue GNOME 3.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Fedora 15“ erschien erstmals bei
Pro-Linux [1].
Vorwort
Fedora 15 „Lovelock” stellt die neueste Version der alle sechs Monate
erscheinenden Linux-Distribution dar. Wie man den Anmerkungen zur
Veröffentlichung [2]
entnehmen kann, kommt Fedora 15 mit
GNOME 3.0.0, das
die neue GNOME Shell enthält, sowie den neuesten Versionen von
KDE (4.6.3)
und Xfce (4.8.1).
Das neue Init-System
systemd [3] wird
standardmäßig eingesetzt. Systemd, dessen aktuelle Version 26 ist, dient
auch zur Sitzungsverwaltung.
LibreOffice 3.3.2
ersetzt OpenOffice.org, und
Firefox 4
wurde in Version 4.0.1 integriert.
Dieser Artikel wird sich auf die Desktopumgebungen GNOME 3 und KDE
beschränken. Aus praktischen Gründen sind auch andere Einschränkungen nötig.
So wurden natürlich zahlreiche zur Distribution gehörende Softwarepakete
geändert oder ersetzt. Mit wenigen Ausnahmen kann auf diese Änderungen nicht
eingegangen werden; man darf annehmen, dass die meisten Pakete unter allen
aktuellen Distributionen nahezu gleich sind und überall gleich gut
funktionieren.
Wie immer sei angemerkt, dass es sich hier nicht um einen Test der
Hardwarekompatibilität handelt. Es ist bekannt, dass Linux mehr Hardware
unterstützt als jedes andere Betriebssystem, und das überwiegend bereits im
Standard-Lieferumfang. Ein Test spezifischer Hardware wäre zu viel Aufwand
für wenig Nutzen. Dies sei denen überlassen, die es für nötig halten. Falls
es Probleme mit Hardware gibt, stehen die Webseiten des Fedora-Projekts zur
Lösung bereit.
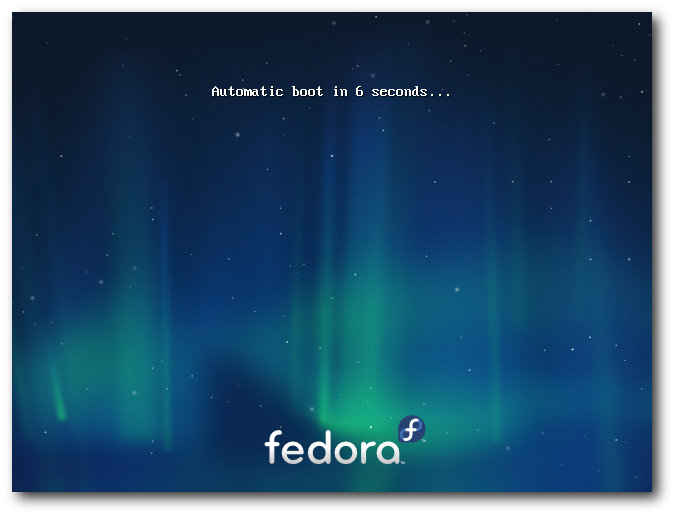
Bootloader der Live-CD von Fedora 15.
Da eine Erprobung auf realer Hardware nicht das Ziel des Artikels ist,
werden für den Artikel zwei identische virtuelle Maschinen, 64 Bit, unter
KVM mit jeweils 768 MB RAM verwendet. Weil KVM nicht die nötigen
Voraussetzungen für GNOME 3 bietet, wurde wie beim Test von
Ubuntu (siehe „Ubuntu 11.04 – Vorstellung des Natty Narwhal“, freiesMagazin
06/2011 [4])
versucht, dafür eine 64-Bit-VM unter
Virtualbox zu
verwenden. Dabei zeigte sich, dass Version 4.0.6 noch keine ausreichende
Funktionalität bei der Hardware-Beschleunigung bot. Ein Update auf Version
4.0.8 sollte Abhilfe schaffen. Allerdings stürzte die VM kurz nach dem Start
von GNOME 3 ab. Das Problem blieb ungelöst. Für den Test von GNOME 3 wurde
dann ein Acer-Netbook A150L verwendet.
Installation
Fedora kann von DVD, einem Satz von CDs, Live-CDs oder minimalen Bootmedien
installiert werden. Natürlich kann man aus einem ISO-Image auch ein
USB-Medium für die Installation erstellen. Die Live-CDs, in den Varianten
GNOME und KDE, sind aufgrund ihres geringen Umfangs eher eine Notlösung für
die Installation, denn es fehlen dann unter anderem LibreOffice und
Übersetzungen. Zwar erfolgt die Installation binnen Minuten, da hierbei
offenbar mehr oder weniger nur ein Abbild der CD auf die Platte geschrieben
wird, aber für normale, vollständige Installationen sind die DVD oder das
minimale Image vorzuziehen, bei dem die eigentliche Distribution über das
Netz installiert wird.
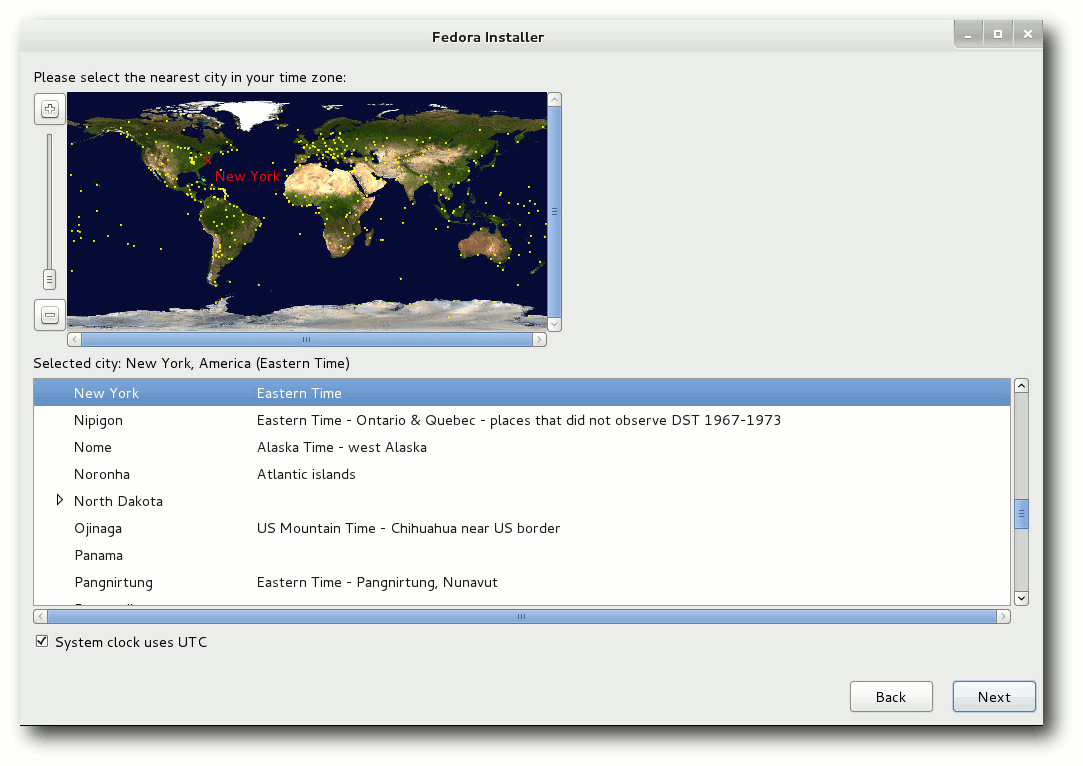
Auswahl der Zeitzone im Installer.
Die Installation von Fedora erfordert mindestens 256 MB RAM für den
Textmodus und 768 MB für die grafische Installation. Die verhältnismäßig
hohe Anforderung von 768 MB kann aufgrund von Änderungen im grafischen
Installer nötig sein, um die Installation überhaupt abschließen zu können;
das Team will aber daran arbeiten, dass die Anforderung in Fedora 16 wieder
auf 512 MB reduziert wird. Installiert man von den Live-CDs, dann ist der
grafische Installer die einzige Option. Bei den anderen Medien ist die
grafische Version des Installers Anakonda die Standardoption. Die
textbasierte Version kann man starten, indem man die GRUB-Zeile um das Wort
text ergänzt.
Das Dateisystem Btrfs steht als Option bei der Installation zur Verfügung,
aber das Standard-Dateisystem ist derzeit noch ext4. Es ist geplant, Btrfs
in Fedora 16 zum Standard-Dateisystem zu machen, wenn das Werkzeug btrfsck
für
Dateisystemreparaturen ausgereifter ist. Das unter Mitwirkung von Fedora
entwickelte btrfsck unterliegt in der aktuellen Version noch einigen
Einschränkungen. Außerdem kann der verwendete Bootloader GRUB nicht von
Btrfs (oder XFS) booten.
Die grafische Installation ist gegenüber Fedora 14 nahezu unverändert. Die
Auswahl der Zeitzone geht mit der Maus nun leichter vonstatten, da bei einem
Klick auf eine Region diese automatisch herangezoomt und die nächstgelegene
Stadt gewählt wird.
Standardmäßig wird keine separate /home-Partition angelegt, was nicht sehr
update- oder wiederherstellungsfreundlich ist. Aufgrund von Mount-Tricks
sieht es zwar so aus, als ob eine eigene Home-Partition verfügbar wäre, sie
ist aber identisch mit der Root-Partition. Für das Mounten ist nun systemd
zuständig, was bedeutet, dass die meisten Dateisysteme nicht mehr in
/etc/fstab auftauchen. LVM wird für die Partitionierung verwendet, und
Verschlüsselung und RAID sind verfügbar. Bezüglich der Partitionierung kann
wohl niemand Fedora etwas vormachen. Im eigens bereitgestellten
Installationshandbuch [5]
werden alle verfügbaren Optionen erörtert und Tipps gegeben. Dort wird unter
anderem davor gewarnt, /usr auf eine separate Partition zu legen, und es ist
nun auch der Tipp enthalten, momentan nicht benötigten Platz erst später
nach Bedarf zu vergeben, weil man LVM-Partitionen und Dateisysteme im
laufenden Betrieb leicht vergrößern kann.

Der leere KDE-Desktop.
Ausstattung
Fedora 15 startet etwa genauso schnell wie sein Vorgänger. Dass nahezu alle
Softwarepakete, bei denen das möglich war, aktualisiert wurden, versteht
sich von selbst. Der Kernel wurde auf Version 2.6.38.6 gebracht. Als
Desktop-Systeme stehen unter anderem KDE SC 4.6.3 und GNOME 3.0.1, teils mit
Updates, zur Verfügung. Der Standard-Browser unter GNOME ist Firefox 4.0.1.
Unter KDE steht neben dem etatmäßigen Konqueror ebenfalls Firefox zur
Verfügung. Firefox ist als 64-Bit-Version generiert, er bringt standardmäßig
das Plug-in nspluginwrapper mit, um auch 32-Bit-Plug-ins integrieren zu können.
Beim Start von GNOME war die Netzwerkverbindung zwar eingerichtet, aber
nicht aktiviert; es war eine manuelle Aktivierung durch Klick auf den
NetworkManager nötig. Noch schlechter verhielt sich KDE: Dort war die
Netzwerkverbindung nicht einmal vorhanden, was einige zusätzliche Klicks im
NetworkManager erforderte.
Die Standard-Office-Suite auf beiden Desktops ist LibreOffice 3.3.2. Sie
benötigte beim ersten Start deutlich länger als das in Fedora 14 enthaltene
OpenOffice 3.3.0. Eine Betrachtung der Funktionalität würde diesen Artikel
sprengen und kann daher hier kein Thema sein.
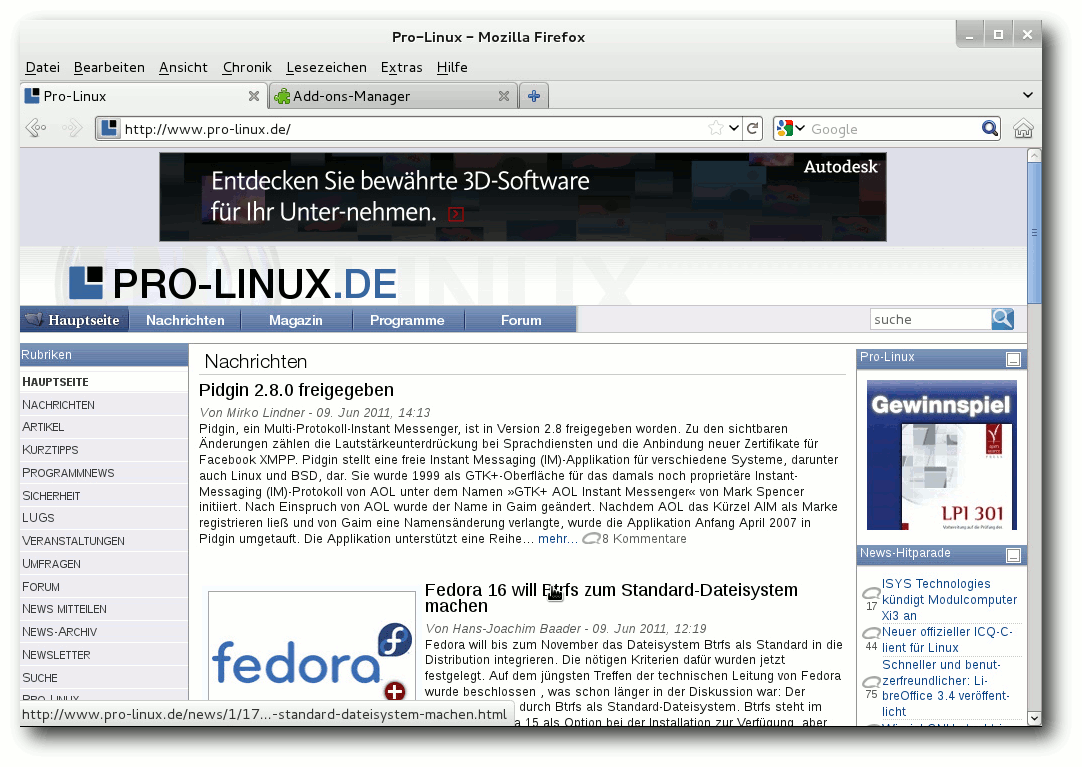
Firefox 4 (hier im Fallback-Modus von GNOME).
Im Dateisystem fallen die neuen Verzeichnisse /cgroup und /run auf. Ersteres
ist leer und wahrscheinlich für das Mounten des cgroup-Pseudodateisystems
gedacht, es fehlen aber Informationen dazu. /run hingegen ist der sinnvollere
Ersatz [6]
für /var/run, wie er wohl bald im File Hierarchy Standard
und in den meisten anderen Distributionen Einzug halten wird.
Informationen
über die von Systemd verwalteten Dienste, von denen jeder seine separate
Control Group erhält, sind unter /sys/fs/cgroup/systemd zu finden.
Wie immer ist in Fedora SELinux eingebunden und aktiviert. Aufgrund der
Neuerungen vor allem rund um Systemd ist noch mit gelegentlichen
Fehlermeldungen zu rechnen, die allerdings nicht fatal sind; offenbar sind
die neuen Profile noch nicht ganz ausgereift. Brauchbar, wenn auch teilweise
extrem umständlich sind die Tools zur Diagnose und Behebung von Problemen.
Man muss jedes Problem einzeln anklicken und erhält teilweise keine Lösung,
sondern nur die Möglichkeit, einen Fehler zu melden, oder es wird eine
Kommandofolge vorgeschlagen, die man dann in einem Terminal ausführen soll.
GNOME 3 benötigt in Fedora 15 direkt nach dem Start mit einem geöffneten
Terminal-Fenster etwa 240 MB RAM, KDE satte 100 MB mehr. Wer der Meinung
ist, auf Nepomuk und Desktopsuche in KDE verzichten zu können, kann diese
abschalten, wird dadurch aber fast nichts einsparen. Die GNOME-Umgebung
braucht damit in der neuen Version trotz GNOME Shell kaum mehr RAM als
vorher, es wurde offenbar einiges optimiert.
Bei der Geschwindigkeit lässt sich kein nennenswerter Unterschied zwischen
den Desktops feststellen, sofern genug RAM vorhanden ist. Für KDE bedeutet
das, dass man mindestens 768 MB RAM haben sollte.
Den Speicherverbrauch der Desktops zu messen ist nicht einfach. Schwankungen
von 20 MB und mehr nach oben und unten sind möglich, je nach dem Zeitpunkt
der Messung. Dies erklärt sich teilweise daraus, dass manche Programme bei
ihrem Start einen oder mehrere Dienste starten. Diese Dienste werden bei
Nichtbenutzung teilweise nach einiger Zeit auch wieder beendet. So sind die
Angaben zum Speicherverbrauch nur als Anhaltswerte zu sehen, die sich je
nach Hardware erheblich unterscheiden können.
GNOME 3
Fedora 15 ist eine der ersten Distributionen, die GNOME 3 einsetzt. GNOME 3
ist das erste nicht mehr binärkompatible Update von GNOME seit ca. zehn
Jahren. Dies war mittlerweile überfällig durch das Update der Bibliothek
GTK+ von Version 2.x auf 3. Die Entwickler nutzten die Gelegenheit, um ihren
Code weiter aufzuräumen und führten beispielsweise das neue
Konfigurationssystem GSettings und DConf ein, das GConf ersetzt. Das
obsolete Komponentensystem Bonobo, das virtuelle Dateisystem gnome-vfs und
die Bibliotheken libglade und libgnomeui wurden endlich entfernt.
Als markanteste Änderung für die Benutzer ist der Ersatz des Panels durch
die GNOME Shell und des Window-Managers Metacity durch Mutter zu sehen. Die
meisten anderen GNOME-Anwendungen wurden lediglich aktualisiert und sind im
Wesentlichen wie zuvor, nur natürlich mit der ein oder anderen Verbesserung.
An der GNOME Shell schieden sich schon lange vor der Veröffentlichung die
Geister, wobei sicher viele Faktoren eine Rolle spielten. Wer eine
Betaversion ausprobierte, dürfte naturgemäß auf Probleme gestoßen sein, die
im veröffentlichten GNOME 3 gar nicht mehr existieren. Ein paar Dinge, die
für Unmut sorgten, waren vielleicht auch nur in der Diskussion, wurden dann
aber doch nicht realisiert.
Tatsache ist, dass die Entwickler der GNOME Shell sich sehr viele Gedanken
über die Benutzbarkeit gemacht haben. Daraus resultierten dann eine Reihe von
Änderungen, die das Team auf gnome3.org [7] den
Benutzern zu vermitteln versucht. Einige der hauptsächlichen
Änderungen [8], die die GNOME Shell in
Version 3.0 enthält, sind ein vereinfachtes Panel ohne Applets, Abschaffung der
Minimieren/Maximieren-Buttons im Fensterrahmen, automatische Verwaltung von
Arbeitsbereichen (gleichbedeutend mit Aktivitäten), Umfunktionieren von
„Alt“ + „Tab“ zu einem Dialog, um das schnelle Wechseln zwischen
Anwendungsfenstern zu ermöglichen, eine vertikale Schnellstartleiste, eine
Übersicht über installierte Programme mit Suchfunktion (ähnlich Unity von
Ubuntu) und durchgängige Bedienung mit der Tastatur, wenn man nicht die Maus
benutzen will.
GNOME 3 soll auf einer Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen
Bildschirmgrößen und Bedienkonzepten nutzbar sein, von Netbooks über Tablets
bis Desktops. Darin ähnelt es Unity von Ubuntu, was auch zu Ähnlichkeiten in
einigen Konzepten führt. In den Details unterscheiden sie sich jedoch stark.
Beim ersten Start von GNOME 3 wird ermittelt, ob das System
Hardware-3D-Beschleunigung bietet. Falls nicht, wird ein
Kompatibilitätsmodus gestartet, der optisch und von der Bedienung her mehr
an GNOME 2 erinnert. Dennoch ist nichts mehr von GNOME 2 enthalten, außer
den Bibliotheken einschließlich GTK+ 2, um ältere GNOME- und GTK-Anwendungen
ausführen zu können. Wer über Hardware-Beschleunigung verfügt, kann diesen
Modus auch als Option im Sitzungsmanager einstellen. Manche Benutzer sehen
dies zwar als bessere Alternative zur GNOME Shell an, aber ab der kommenden
Version wird diese Option voraussichtlich entfallen, weil dann die GNOME
Shell auch ohne Hardware-Beschleunigung funktioniert.
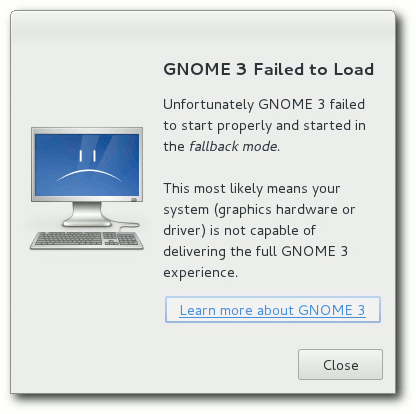
Ohne 3D-Beschleunigung gibt es nur den Fallback-Modus.
In der GNOME Shell ist das erste, was auffällt, dass statt zwei Panels nur
noch eines vorhanden ist. Auf das untere Panel, das Anwendungs-Icons und
Arbeitsflächenumschalter enthielt, wurde verzichtet. GNOME 3 stellt dafür
andere Methoden bereit. Wer sich aber nach dem alten Panel zurücksehnt, wird
keine Möglichkeit finden, es wieder herzustellen. Panels sind in GNOME 3
nicht mehr konfigurierbar. Auch das obere Panel wurde entschlackt. Statt der
bekannten Menüs für Anwendungen, Orte und System findet man nur noch einen
Button „Aktivitäten“, der zwar
wie ein Menü aussieht, sich aber anders
verhält.
Ansonsten besteht das Panel nur aus der Uhr mit dahinterliegender
Kalenderfunktion und den schon von früher bekannten Status- und
Indikatormenüs. Im Benutzermenü sind die Systemeinstellungen untergebracht,
die sich nun ein wenig wie die KDE-Systemeinstellungen präsentieren, aber
nicht so umfangreich sind.
In diesem Menü gibt es noch eine Besonderheit, den Menüpunkt „Suspendieren“,
um den Rechner in den Schlafzustand zu versetzen. Den
ebenfalls zu
erwartenden Menüpunkt
„Herunterfahren“ findet man nicht. Erst wenn man die
„Alt“-Taste drückt, wird aus dem „Suspendieren“ ein „Herunterfahren“. Dieses
Verhalten kann nur als Fehlentwicklung eingeschätzt werden.
Applets sind nicht mehr vorgesehen. Der Schmerz über den Verlust der Applets
dürfte sich aber in Grenzen halten. Bei vielen Anwendern dürften Applets gar
nicht oder nur vereinzelt zur Anwendung gekommen sein. Zu jedem Applet existieren
Programme mit äquivalenter oder weitergehender Funktionalität, und notfalls
kann man immer noch ein Dock oder einen Applet-Container wie das beliebte
gkrellm
installieren. Einen teilweisen Ersatz werden Applets auch durch die
Erweiterbarkeit der GNOME Shell finden, der man Plug-ins hinzufügen kann, die
in JavaScript geschrieben werden.
Der schon erwähnte Button „Aktivitäten“ ist der Dreh- und Angelpunkt von
GNOME 3. Über ihn erreicht man den Anwendungs-Starter und die
Arbeitsflächenansicht. Anwendungen lassen sich auch über „Alt“ + „F2“ starten.
Dazu muss man jedoch den genauen Namen des Programms kennen, denn dieser
Startdialog ist primitiv. Er merkt sich zwar eine Historie der Eingaben
(leider auch falsche) und kann Pfade vervollständigen, bietet aber sonst
keine Unterstützung bei der Eingabe. Hier wären wesentliche Erweiterungen
wünschenswert.
Der Aktivitäten-Bildschirm zeigt links eine vertikal angeordnete
Starter-Leiste, die ähnlich wie bei Unity sowohl „Favoriten“ als auch
aktuell laufende Programme enthält. Sie zeigt für jedes eingetragene
Programm ein Icon, anfänglich in recht großer Ausführung. Je voller die
Leiste wird, desto kleiner werden die Icons. Ein Ziehharmonika-Effekt wie
bei Unity ist nicht vorhanden. Ist das Minimum der Icon-Größe erreicht,
führen zusätzlich hinzugefügte Programme dazu, dass einige Icons nicht mehr
sichtbar sind – und es gibt keine Möglichkeit, zu scrollen.
Konfigurationsmöglichkeiten existieren ebenfalls nicht, sodass die
Implementierung insgesamt unbefriedigend ist.
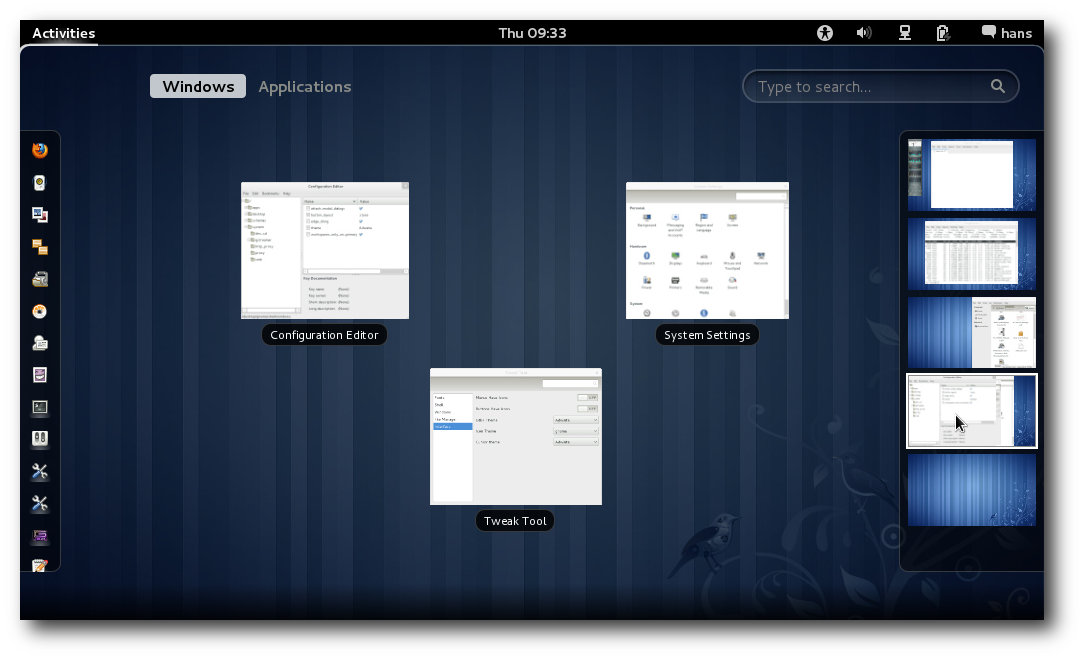
Aktivitätsübersicht in GNOME 3.
Der Hauptteil des Aktivitäten-Bildschirms hat mehrere Funktionen. Zum einen
zeigt er verkleinerte Abbildungen der Fenster der aktuell ausgewählten
Arbeitsfläche. Die Anordnung dieser Fenster entspricht nicht der realen
Anordnung auf dem Desktop, und die Größe der Darstellung hängt von der
Anzahl der Fenster ab. Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass man alle
Fenster ohne Überlappung sieht. Fährt man mit dem Mauszeiger zur rechten
oberen Ecke eines Fensters, erscheint dort ein Schließen-Button. Ob das
Schließen aber eine so wichtige Operation ist, dass man eine solche
Funktionalität in der Übersicht benötigt, darf bezweifelt werden.
Zum zweiten kann man durch Klicken auf „Applications“ (die Übersetzung
scheint noch zu fehlen) in eine Dashboard-artige Ansicht wechseln. Hier wird
für jede installierte Anwendung ein Icon angezeigt. Die Ansicht lässt sich
scrollen, sie lässt sich aber auch auf Kategorien oder Suchbegriffe
einschränken. Die Suche funktioniert auch in der Fensterübersicht und ist
jedenfalls eine praktische Neuerung. Durch einen Klick auf das Icon wird die
entsprechende Anwendung gestartet; über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
kann man sie auch den Favoriten hinzufügen. Das Arbeiten mit Einzel- statt
Doppelklicks, das nun an vielen Stellen anzutreffen ist, dürfte für viele
bisherige GNOME-Benutzer gewöhnungsbedürftig sein.
Zum dritten befindet sich rechts auch noch, standardmäßig halb verborgen, die
Übersicht über die existenten Arbeitsflächen, wiederum in vertikaler
Anordnung. Bewegt man die Maus in diesen Bereich, wird die Übersicht
vollständig hereingeschoben, wobei sich die zentrale Fensterübersicht etwas
verkleinert. Dieser Effekt scheint unnötig, genausogut könnte die Übersicht,
die durchaus mit früheren „Pagern” vergleichbar ist, ständig voll sichtbar
sein. In der Ansicht lassen sich die Fenster auf den Arbeitsflächen in ihrer
realen Anordnung erkennen und von einer Arbeitsfläche auf eine andere
verschieben.
Die Verwaltung der Arbeitsflächen erfolgt dynamisch. Sie sind linear
angeordnet. Hinter der letzten Arbeitsfläche, in der ein Fenster liegt, wird
automatisch eine neue leere Arbeitsfläche angelegt. Eine Arbeitsfläche, die
leer wird, wird dagegen sofort entfernt – ungünstig, wenn sie aus Versehen
geleert wird, denn eine Umkehrung der Operation ist nicht vorgesehen. Eine
bessere, durchaus akzeptable Lösung wäre es, leere Arbeitsflächen einfach
stehen zu lassen und lediglich zwei leere Arbeitsflächen am Ende der Reihe
zu einer reduzieren.
Die Begriffe Aktivität und Arbeitsfläche sind, wie schon erwähnt,
austauschbar. Die Entwickler von GNOME 3 wollten unter anderem den Wechsel
zwischen Arbeitsflächen schnell und einfach machen. Daher gibt es viele
Wege, dies zu tun, manche sind aber nicht gerade effizient. So gibt es
Tastenkürzel, um die oberhalb oder unterhalb liegende Arbeitsfläche zu
erreichen („Strg“ + „Alt“ + „Pfeil hoch“ bzw. „Strg“ + „Alt“ + „Pfeil runter“). Will man von der vierten
in die erste Arbeitsfläche wechseln, erfordert das drei Tastendrücke. Die
Kombination „Strg“ + „F1“ usw. wie bei KDE ist nicht definiert, man kann sie über
den Einstellungsdialog aber einstellen, womit man jede Arbeitsfläche mit
einem Tastendruck erreicht. Man kann allerdings nur Kürzel für so viele
Arbeitsflächen definieren, wie aktuell existieren. Eine weitere Möglichkeit
ist der Weg über die Aktivitätenansicht, der eindeutig zu umständlich ist.
Schneller geht es mit „Alt“ + „Tab“.
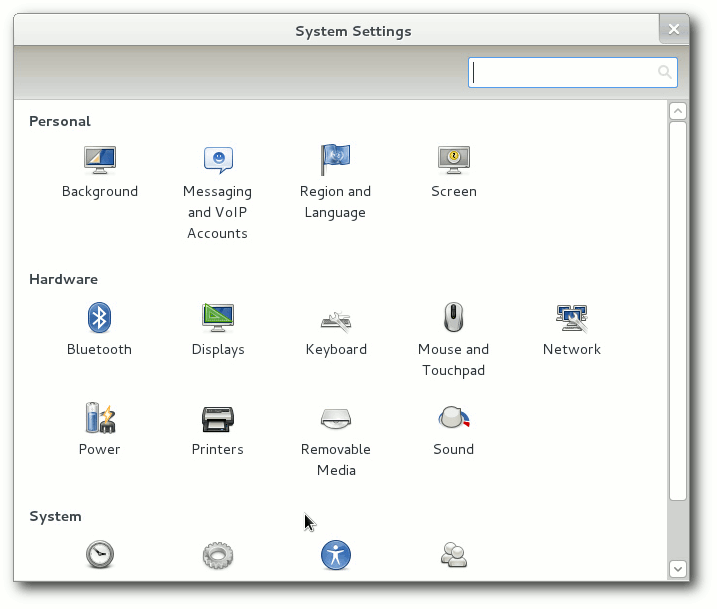
Systemeinstellungen von GNOME 3.
„Alt“ + „Tab“ sorgt, wie man es gewohnt ist, für das Umschalten zwischen
Anwendungen. Es wird ein
Dialog gezeigt, der alle offenen Anwendungen
als
Icons zeigt, auch wenn sie auf anderen Arbeitsflächen liegen. Senkrechte
Striche deuten dabei die verschiedenen Arbeitsflächen an. So lässt sich ein
schneller Wechsel erreichen. Komplizierter wird es, wenn man mehrere
Instanzen derselben Anwendung gestartet hat. Diese werden alle unter einem
Icon zusammengefasst. Wechselt man zu diesem und lässt die Alt-Taste noch
nicht los, dann erscheint nach einer Sekunde darunter eine Auswahl der
einzelnen Fenster. Es ist möglich, aber umständlich, eines davon mit der
Maus auszuwählen. Stattdessen sollte man wissen, dass man, die „Alt“-Taste
gedrückt lassend, mit der Taste über dem Tab (auf deutschen Tastaturen das
„^“),
zwischen diesen Fenstern zyklisch wechseln kann. An diese Funktion kann
man sich sicherlich gewöhnen; ob sie optimal ist, sei dahingestellt.
Der neue Window-Manager bringt noch einige weitere neue Funktionen mit. So
wird ein Fenster maximiert, wenn man es nach oben an das Panel zieht. Zieht
man es wieder weg, wird die ursprüngliche Größe wieder hergestellt. Dasselbe
bewirkt ein Doppelklick auf die Titelleiste. Durch Ziehen an den linken oder
rechten Bildschirmrand wird ein Fenster nur in der Vertikalen maximiert, was
praktisch sein kann, wenn man zwei Fenster nebeneinander stellen will. Es
gibt aber auch Fälle, in denen das nicht gewünscht ist, nur ändern lässt es
sich nicht. Für das Minimieren von Fenstern ist kein Button in der
Titelleiste mehr vorgesehen. Über das Fenstermenü ist es immer noch möglich.
Das Fenster wird damit effektiv unsichtbar, da kein Icon dafür auf dem
Desktop oder in einem Panel platziert wird. Nur über „Alt“ + „Tab“ lässt es sich
wieder herstellen.
Benachrichtigungen erscheinen nun am unteren Bildschirmrand ähnlich wie bei
KDE. Instant Messaging ist jetzt vollständig in den Desktop integriert.
Auch wenn GNOME 3 noch einige Einstellungen zulässt, würden einige weitere
nicht schaden. Man kann den dconf-editor installieren, um direkten Zugriff
auf alle GNOME-Einstellungen zu erhalten, aber bei solchen Dingen sollte man
wissen, was man tut. Zudem besitzen die GNOME Shell und Mutter auch da nur
sehr wenige Einstellungen. Einige weitere Einstellungen werden mit dem
gnome-tweak-tool zugänglich gemacht, aber auch das hat Grenzen. Weiteres ist
im GNOME-3-FAQ von Fedora [9]
zu finden. Es ist die offizielle Politik von GNOME, so wenig
Einstellungsmöglichkeiten wie möglich anzubieten. Man kann nur hoffen, dass
sich das ändert. In der Zwischenzeit sorgt die Gemeinschaft mit Plug-ins für die
GNOME Shell [10] für Abhilfe bei
einigen der Probleme. Zur Zeit existieren erst wenige Plug-ins, aber einige
darunter sind bereits empfehlenswert.
KDE
KDE liegt nun in Version 4.6.3 vor, gegenüber 4.5 mit der Möglichkeit,
Anwendungen und Dateien einer Aktivität zuzuordnen, einer neu geschriebenen
Energieverwaltung, optimiertem KWin und vielen Verbesserungen in den
einzelnen KDE-Anwendungen. GTK-Anwendungen sollen optisch dank eines neu
geschriebenen Oxygen-GTK-Themes noch besser in die KDE-Umgebung passen.
Feststellbar ist das kaum,
wie man am Bild der Paketmanager weiter unten
sehen kann. Ansonsten bringt KDE ein neues Standard-Hintergrundbild mit. Die
Icons aus
der letzten Version wurden beibehalten, was Geschmackssache ist.
Viele KDE-Anwendungen wurden natürlich auch stark verbessert. Insgesamt gibt
es an KDE nicht viel auszusetzen.
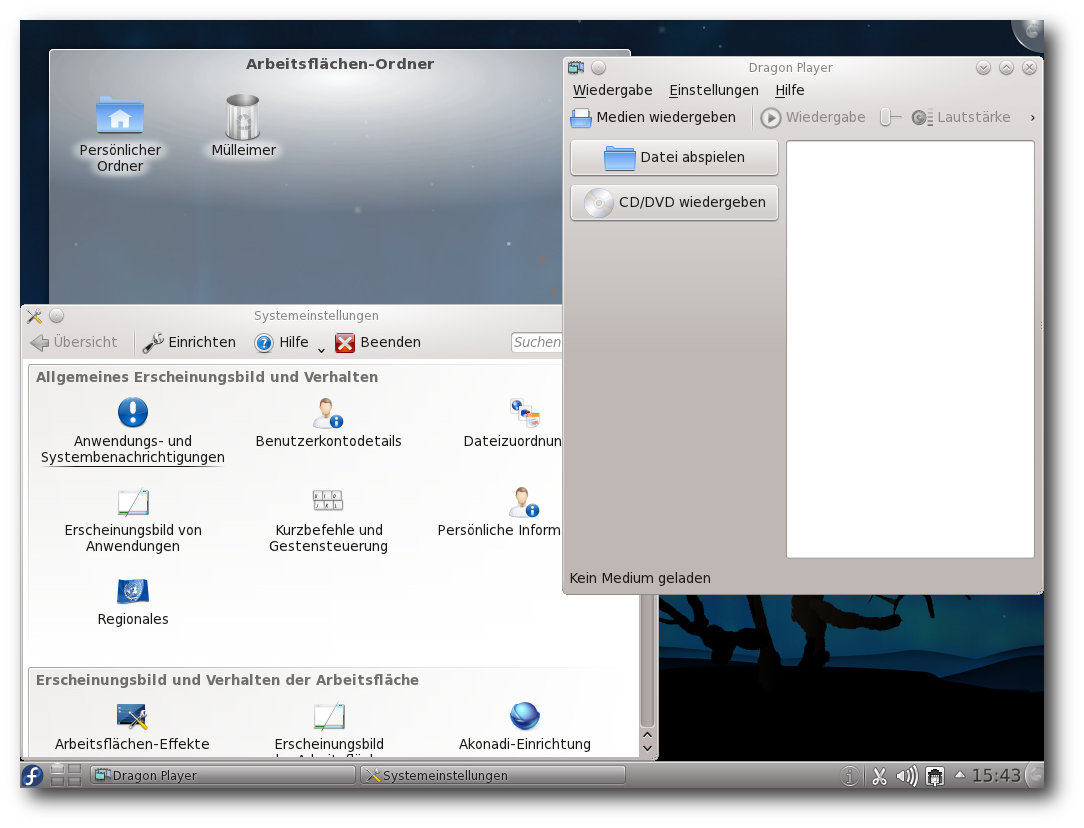
KDE 4.6 mit Applikationen.
Multimedia im Browser und auf dem Desktop
Wie gewohnt bringt Fedora den Multimedia-Server PulseAudio in der neuesten
Version mit. Auch der Musicians'
Guide [11],
der Einsteigern
eine Anleitung zu Audio-Software unter Linux geben soll,
wurde aktualisiert. Ansonsten gab es in diesem Bereich aber wenig Neues.
Wegen der Softwarepatente in den USA kann Fedora, ebenso wie die meisten
anderen Distributionen, nur wenige Medienformate abspielen, da es viele
benötigte Codecs nicht mitliefern kann. Wenn man versucht, eine MP3- oder
Videodatei abzuspielen, dann bieten die gängigen Player aber die Option an,
über die Paketverwaltung nach passenden Plug-ins zu suchen. Damit das
Aussicht auf Erfolg hat, muss man aber vorher in der Paketverwaltung die
zusätzlichen Repositorien eintragen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es im
Prinzip ganz einfach. Über die Webseite von RPM
Fusion [12] kann man Pakete installieren, die die
Repositorien hinzufügen. Dies gilt für GNOME wie für KDE.
Nach dieser Vorbereitung sollten die Player unter GNOME und KDE in der Lage
sein, die benötigten Plug-ins selbsttätig zu installieren. Merkwürdigerweise
hat Totem aber ein Problem, wenn man ausgerechnet mit der Suche nach einem
MP3-Plug-in anfängt und noch keine Codecs installiert sind – diese Suche
schlägt fehl. Bei Videoformaten funktioniert es aber. Die Alternative ist
eine manuelle Installation der GStreamer-Plug-ins, insbesondere
gstreamer-ffmpeg.
Totem erscheint bei Installation von DVD auch unter KDE als
Standard-Medienplayer, auch für MP3-Dateien. Kaffeine und Dragonplayer sind
als Alternativen installiert.
Nach Installation des Gnash-Plug-ins in Version 0.8.9 und Lightspark 0.4.8
ließen sich diverse Flash-Videos im Web abspielen. Leider sind weder Gnash
noch Lightspark perfekt, so funktionierte beispielsweise Youtube, ZDF
„Heute” (Flash-10-Format) dagegen nicht. WebM-Videos funktionierten in
Firefox problemlos. In Konqueror funktionierten die meisten Videos
einschließlich WebM gar nicht.
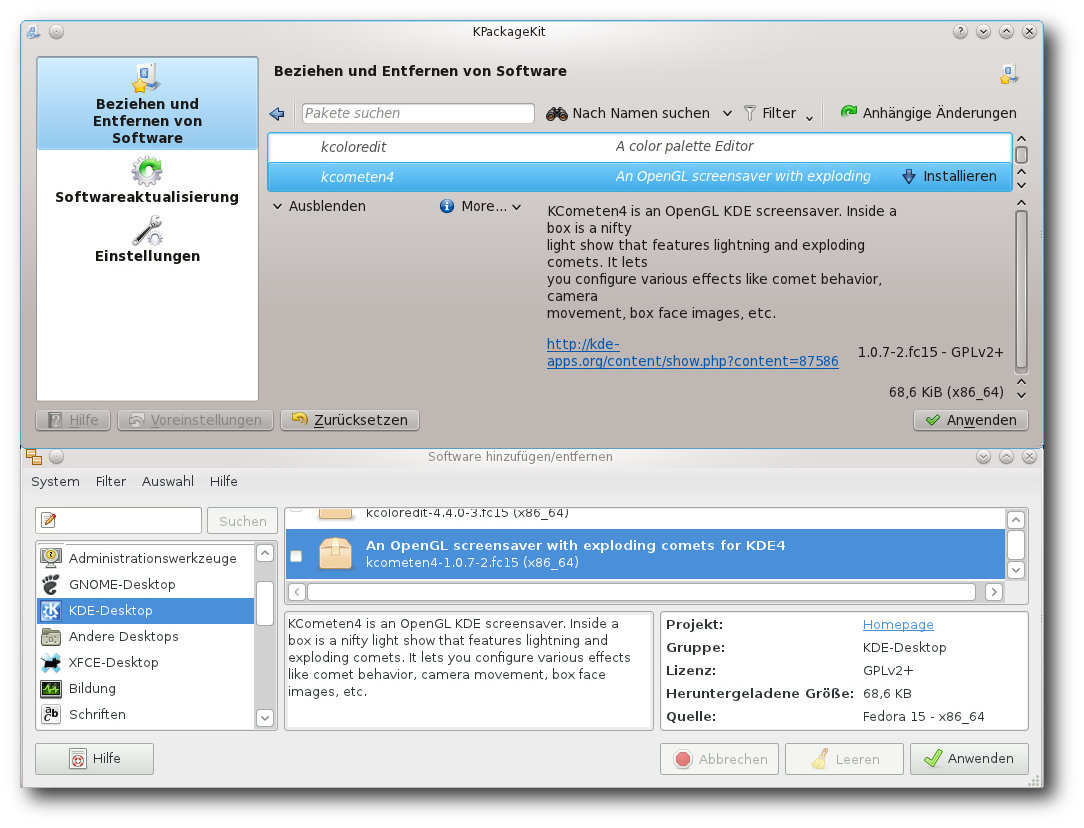
KPackageKit und gpk-application unter KDE.
Ein paar Verbesserungen gab es bei Fedora im Bereich der Paketverwaltung.
Das GNOME-Frontend von PackageKit, gpk-application, kann jetzt auch
Software-Repositorien hinzufügen oder entfernen und ist damit endlich
vollständig.
Die Package-Suites, Zusammenstellungen von thematisch zusammengehörenden
Paketen, wurden erweitert und umorganisiert. Die Gruppe Graphics Suite wurde
in Design umbenannt, und Robotics kam neu hinzu.
Auf KDE-Seite war in den letzten Versionen stets KPackageKit mein
Lieblingsblock, um darauf einzuhacken. Das hat nun ein Ende. In der neuesten
Version 0.6.3.3 wurde eine Repositorien-Verwaltung hinzugefügt, sodass nun
alles, was man für die Paketverwaltung und Updates benötigt, vorhanden ist.
Zwar hätte man die Oberfläche, wie schon früher angemerkt, platzsparender
gestalten können, und möglicherweise ist die Kombination von Such- und
Filterfunktion immer noch nicht ganz intuitiv, aber das Programm versieht
seinen Dienst einwandfrei.
Beim ersten Update meldete KPackageKit allerdings schon wie in früheren
Versionen einen unbekannten Repositorien-Schlüssel. Dies dürfte ein
Konfigurationsfehler von Fedora sein. Ein Problem hat die Paketverwaltung
auch mit dem Verhalten von Dialogboxen unter KDE. Das Problem ist aber
vielleicht eher KDE selbst anzulasten. Möglicherweise aufgrund der Tatsache,
dass mehrere verschiedene Prozesse an der Paketverwaltung beteiligt sind,
kann es vorkommen, dass die Dialogbox, die zur Bestätigung die Eingabe des
Root-Passworts verlangt, hinter anderen Fenstern zu liegen kommt, und wenn
man nicht auf die Taskleiste achtet, kann man sich darüber wundern, dass die
Paketverwaltung keinerlei Fortschritt mehr macht.
Systemd
Systemd [13] fügt sich ziemlich
unauffällig in das System ein. Viele Dienste werden nun über Systemd
verwaltet, eine Liste kann man sich mit systemctl list-units ausgeben
lassen. Begrenzt man die Ausgabe mit grep, so findet man beispielsweise für
die Firewall:
UNIT LOAD ACTIVE SUB JOB DESCRIPTION
ip6tables.service loaded active exited LSB: start and stop ip6tables firewall
iptables.service loaded active exited LSB: start and stop iptables firewall
Diese Dienste kann man mit
# systemctl restart iptables.service
neu starten, mit stop beenden und noch viele weitere Operationen ausführen.
Leider sind noch nicht alle Dienste auf systemd umgestellt, beispielsweise
SSH. Diese muss traditionell über /etc/init.d verwaltet werden, wobei
chkconfig helfen kann.
Weitere Neuerungen
Für Unternehmen wurde das Buchhaltungs- und Inventarsystem
Tryton
hinzugenommen. Das neue Werkzeug BoxGrinder soll es leicht machen, virtuelle
Maschinen für Plattformen wie KVM, Xen und Amazon EC2 aus einfachen
Definitionsdateien zu erzeugen.
Für Softwareentwickler stehen zahlreiche aktualisierte Programmiersprachen,
Compiler und Werkzeuge bereit. Dazu gehören neue Versionen wie Rails 3.0.5,
OCaml 3.12, Python 3.2, GDB 7.3, GCC 4.6 und Maven 3. Netzwerk-Gerätenamen
werden jetzt in konsistenter Weise
benannt [14],
wobei versucht wird, Informationen der Firmware
(ACPI oder andere Methoden) zu nutzen. Wenn der Rechner keine geeignete
Information bereitstellt, ändert sich nichts, wie beispielsweise beim
Acer-Netbook, dessen
Ethernet- und WLAN-Schnittstelle weiterhin eth0 und
wlan0 heißen. Man kann die Änderung der Gerätenamen aber auch mit einer
Bootoption verhindern oder mit udev-Regeln überschreiben. Eine optionale
dynamische Firewall, realisiert mit einem Daemon, ermöglicht die Verwaltung
über eine D-Bus-Schnittstelle.
Viele weitere Änderungen zeichnen die neue Version aus. So wurde die
Kompression auf den Live-Images durch die Verwendung von xz statt gzip
erhöht, wodurch die Größe verringert bzw. mehr Software integriert werden
konnte. Die Eingabemethoden für indische Sprachen wurden verbessert, die
Meldung von Abstürzen und die Problembehandlung von SELinux ebenfalls. Die
Verwaltung des verschlüsselten Dateisystems eCryptfs wurde in Authconfig
integriert. DNSSEC kann nun auf Workstations verwendet werden. Dazu nutzt
NetworkManager den DNS-Server BIND zum Auflösen und Verifizieren von
Rechnernamen. Auch die Energieverwaltung wurde weiter verbessert.
Fazit
Fedora 15 ist eine solide Distribution, die allerdings in der ersten Zeit
nach der Veröffentlichung immer einige Probleme zeigt. Wer sich nicht mit
der Lösung dieser Probleme aufhalten kann, sollte mit dem Update auf
Fedora 15 einige Wochen warten. Wer sicherer vor Updates sein will, sollte
vielleicht immer nur die zweitneueste Version einsetzen. Dabei macht sich
allerdings der kurze Support-Zeitraum von Fedora negativ bemerkbar. Man ist
im Prinzip gezwungen, alle sechs Monate zu aktualisieren. Aber eine große
Zahl von Updates gehört bei Fedora prinzipiell dazu – für eine typische
Installation von Fedora 15 dürften es schon jetzt mehr als 100 sein.
Die vielen fortgeschrittenen Funktionen, beispielsweise bei der
Virtualisierung, machen Fedora für fortgeschrittene Anwender interessant.
Auch Entwickler werden mit den verschiedenen neuen oder aktualisierten
Entwicklungsumgebungen stark umworben.
GNOME 3 ist im Moment noch zwiespältig. Man darf aber
nicht vergessen, dass es sich um eine erste Version handelt. Der Unterbau
von GNOME 3 ist extrem solide, der Schwachpunkt ist in erster Linie die
GNOME Shell.
Das erinnert stark an den Übergang von KDE 3 zu KDE 4. Aber
schon in der nächsten Version wird die GNOME Shell vermutlich stark
verbessert sein, denn stellenweise sind es nur Kleinigkeiten, die fehlen.
Das GNOME-Projekt sollte aber dringend für weitgehende
Konfigurationsmöglichkeiten sorgen, wie es sie beispielsweise bei KDE gibt.
Flexibilität ist eine der größten Stärken des Linux-Desktops, und nur mit
maximaler Flexibilität ist es möglich, den Desktop an seine Arbeitsabläufe
optimal anzupassen.
Links
[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1511/fedora-15.html
[2] http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/15/html/Release_Notes/
[3] http://www.pro-linux.de/news/1/16068/statusbericht-von-systemd.html
[4] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-06
[5] http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/15/html/Installation_Guide/
[6] http://www.pro-linux.de/news/1/16986/systemd-will-konfigurationsdateien-vereinheitlichen.html
[7] http://gnome3.org/
[8] https://live.gnome.org/GnomeShell/Tour
[9] http://www.fedorawiki.de/index.php/Gnome_3_FAQ
[10] https://live.gnome.org/GnomeShell/Extensions
[11] http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/15/html/Musicians_Guide/index.html
[12] http://rpmfusion.org/
[13] https://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[14] http://www.pro-linux.de/news/1/16636/konsistente-benennung-der-netzwerkschnittstellen-unter-linux.html
| Autoreninformation |
| Hans-Joachim Baader (Webseite)
befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss
er sein Informatikstudium erfolgreich ab, machte die
Softwareentwicklung zum Beruf und ist einer der Betreiber
von Pro-Linux.de.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Martin Gräßlin
Immer wieder werden in der Open-Source-Gemeinde verschiedenste
Programme an Hand von willkürlichen Zahlen miteinander verglichen.
In vielen Fällen haben diejenigen, die die „Benchmarks“
durchführen, jedoch keinen technischen tieferen Einblick in das, was
sie eigentlich vergleichen, und es werden einfach nur Zahlen ohne
jegliche Interpretation vorgelegt. In diesem Artikel wird am
Beispiel eines auf Phoronix veröffentlichten Benchmarks aufgezeigt,
wie wichtig es ist, die Benchmarks kritisch zu betrachten und
„Zahlen“ nicht spekulativ zu interpretieren.
Die Nachrichtenseite Phoronix [1], mit dem
Schwerpunkt X und Linux, veröffentlicht regelmäßig
Benchmark-Ergebnisse. Dabei wird die von Phoronix entwickelte
„Phoronix Test Suite“ [2]
eingesetzt. Betrachtet man die Ergebnisse, so stellt man sehr
oft die gleichen konzeptionellen Fehler [3]
in der Durchführung der Benchmarks fest. Bei Lesern, welche die
Benchmarks kritisch betrachten, hört man auch, dass Phoronix „alles
benchmarkt, was nicht bei drei auf den Bäumen
ist“ [4].
Unglücklicherweise werden die auf Phoronix veröffentlichten
Ergebnisse von Medien unreflektiert weiterverbreitet und Phoronix
als verlässliche Quelle angesehen (was sie durchaus ist, jedoch nicht bei Benchmarks
wie gezeigt wird).
Gute Benchmarks
Zuerst vorweg: Benchmarks sind, wenn sie richtig durchgeführt
werden, eine wichtige Unterstützung in der Softwareentwicklung und
auch in der Freien-Software-Welt eine wichtige Komponente. Ein
guter Benchmark kann sehr schnell Regressionen feststellen oder
aufzeigen, ob eine Optimierung überhaupt sinnvoll ist. Anhand eines
falschen Benchmark-Ergebnis zu optimieren, kann allerdings zu einer
Verschlechterung der vorherigen Situation führen.
Einen guten Benchmark aufzusetzen ist leider nicht einfach – es
muss die wissenschaftliche
Methodik [5]
eingehalten werden. Ein Benchmark ist zu betrachten wie ein
naturwissenschaftliches Experiment, d. h. jemand anderes muss unter
gleichen Bedingungen die Ergebnisse reproduzieren können und die
Werte müssen normalisiert sein. Die Versuche müssen mehrmals
durchgeführt werden und die Beeinflussung von externen Störfaktoren
muss ausgeschlossen werden. Ein guter und aussagekräftiger
Benchmark zum Vergleich verschiedener Anwendungen erfordert daher
den Aufwand vergleichbar mit wissenschaftlichen Arbeiten.
Am wichtigsten bei einem Benchmark ist jedoch seine Interpretation.
Einfach nur die Zahlen zu präsentieren, ist kein aussagekräftiger
Benchmark. Die Zahlen müssen verstanden und erklärt werden.
Abweichungen zu bestehenden theoretischen Annahmen müssen
betrachtet und dürfen nicht einfach ignoriert werden, da sie
auf einen Fehler im Versuchsaufbau hinweisen können.
Falsche Benchmarks
Der Klassiker unter den falsch verstandenen Benchmarks ist das
Programm glxgears. Führt man es aus, wird in der Konsole alle fünf
Sekunden die Anzahl der gerenderten Frames ausgegeben. Viele
Anwender nutzen diese Zahlen zum Vergleich von Systemen oder melden
sogar Bugreports, weil sich die Anzahl der Frames verschlechtert.
Jedoch ist glxgears kein
Benchmark [6].
Seit einiger Zeit verwendet glxgears
VSync [7], womit die Zahlen
sowieso der Bildschirmfrequenz von in der Regel 60 Hz entsprechen.
Jedes mehr gerenderte Frame kann von
der Hardware nicht dargestellt
werden und ist somit eine Verschwendung von Rechenzeit. Jedoch
hätte glxgears auch ohne diese Einschränkung keine Aussagekraft,
da es völlig realitsätsferne Elemente der OpenGL-API austestet, wie
sie so von keiner modernen OpenGL-Anwendung verwendet wird. Bei
glxgears ist es sogar wahrscheinlich, dass die Softwareemulation
bessere Ergebnisse liefert als eine hardwarebeschleunigte Ausführung.
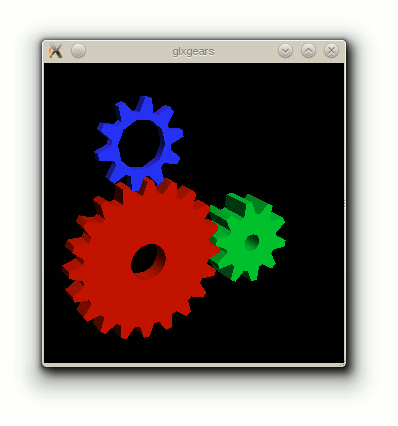
glxgears ist kein Benchmark-Programm.
Fallbeispiel Phoronix
Der Phoronix Benchmark „How Unity, Compiz, GNOME Shell & KWin Affect
Performance“ [8]
(deutsch: „Wie Unity, Compiz, GNOME Shell und KWin die Leistung
beeinflussen“) hat in etwa so viel Aussagekraft wie ein mit
glxgears durchgeführter Benchmark. Ziel des Benchmarks ist es,
herauszufinden wie die Leistung (d. h. Anzahl gezeichneter Bilder
pro Sekunde) von OpenGL-Computerspielen unter verschiedenen
Fenstermanagern und Desktopumgebungen beeinflusst wird, und zwar unter
Betrachtung des Einflusses von
OpenGL-Compositing [9].
Betrachtet man den Artikel, so fallen sofort einige Fehler in der
Durchführung auf. Der Benchmark erfolgte auf einem Grundsystem
einer Distribution und für die verschiedenen Tests wurde die
Grafikkarte ausgetauscht. Um einen allgemeingültigen Benchmark zu
erhalten, hätte der Test auf verschiedenen Hardwareplattformen
ausgeführt werden und auf jedem System hätten mehrere Distribution
verwendet werden müssen. In der dargestellten Ausführung ist die
einzige Aussagekraft des Benchmarks, dass unter dem getesteten
System die angegebenen FPS der verschiedenen Spiele erreicht
wurden. Ob das eine allgemeingültige Aussage hat, wie sie zum Teil
abgeleitet wurde [10],
kann aus den präsentierten Zahlen nicht erkannt werden.
Das nächste offensichtliche Problem erkennt man, wenn man versucht,
zu klären, wie oft die Tests wiederholt wurden. Man findet dazu im
Artikel keine Angaben. Möchte man als interessierter Dritter die
Ergebnisse reproduzieren, so ist dies nicht möglich, da wichtige
Bestandteile der Testausführung nicht bekannt sind. So stellt sich
die Frage, ob die Tests nur einmal durchgeführt wurden oder
mehrmals, ob Ausrutscher herausgenommen wurden oder ob vielleicht
die präsentierten Zahlen eigentlich Ausrutscher sind.
Technische Rahmenbedingungen
Nun sollte man sich auch die Relevanz der Ergebnisse betrachten. Ist
die Framerate in Spielen etwas, worauf die Fenstermanager hin
optimieren? Ist die Framerate in dem Zusammenhang überhaupt
relevant? Linux ist nicht als Spielerplattform bekannt. Daher ist
es fraglich, ob Entwickler Zeit auf die Optimierung dieser
investieren sollten.
Zuerst sollte man wissen, dass OpenGL-Compositing einen erheblichen
und zu erwartenden Overhead produziert. Die Entwickler sind sich
dessen bewusst [11].
Durch die „Umleitung“ des Compositing-Vorgangs wird jede Anwendung
zuerst in eine Off-Screen-Pixmap [12]
und anschließend vom Compositor auf den Bildschirm gezeichnet, wozu
von den bereits in OpenGL gezeichneten Frames eine OpenGL-Textur
generiert und dann durch den Scenegraph des Compositors
geschickt wird.
Logischerweise kann jede Anwendung durch das Compositing nur noch
die Framerate des Compositors erreichen, welcher in der Regel VSync
ausführt. Also kann nur noch die Bildschirmfrequenz erreicht
werden. Ohne Compositing kann eine Anwendung direkt in den
Framebuffer zeichnen und so viele Frames zeichnen, wie sie will
(auch wenn das nicht sinnvoll ist). Mit Compositing wird sie durch
das Umleiten durch den Compositor gedrosselt. Anstatt einer
Anwendung, die auf den Framebuffer zeichnet, sind nun drei
Anwendungen involviert: das Spiel selbst, der Compositor und der
X-Server.
Auch für Spiele ist es nicht sinnvoll, mehr Frames zu zeichnen, als
die Bildschirmfrequenz ermöglicht. Mit dem als X-Nachfolger
gehandelten Wayland Display Server scheint es sowieso nicht mehr
möglich zu sein, mehr Frames zu zeichnen, als der Compositor auf
den Bildschirm bringen kann. Das heißt also, dass alle getesteten
Fenstermanager gleich gut skalieren, falls die Spiele mindestens
die Anzahl an Frames wie der Bildschirm liefern. Es gilt nicht,
dass mehr Frames zwangsläufig besser sind. Bei fast allen Tests
erreichen alle Fenstermanager Werte über der Bildschirmfrequenz.
Bei den Tests, bei denen dies nicht der Fall ist, scheinen die
Grafikkarte oder die Treiber an ihre Grenzen zu kommen, da
Full-HD-Bildschirme verwendet werden.
Die KWin-Entwickler vertreten, seitdem der Fenstermanager um
OpenGL-Compositing erweitert wurde, die Position, dass man
Compositing bei OpenGL-Spielen ausschalten soll und bieten dafür
mit „Alt“ + „Shift“ + „F12“ standardmäßig ein Tastenkürzel an. In der
kommenden Version 4.7 der KDE-Plasma-Workspaces gehen sie noch
weiter und erlauben Anwendungen selbst, Compositing auszuschalten
oder dem Nutzer dieses über Fensterregeln auf Anwendungsbasis
bestimmen zu lassen [13]
[14].
Mit diesem Wissen dürfte es klar sein, dass zumindest die
KWin-Entwickler die Ergebnisse eines Benchmarks, wie von Phoronix
durchgeführt, nicht ernst nehmen können. Die Entwickler haben ganz
bestimmt nicht diesen Anwendungsfall optimiert. Ja, sie sehen es
nicht einmal als validen Anwendungsfall an. Was Phoronix getestet
hat, liegt außerhalb dessen, was KWin überhaupt abdecken will. Um so
überraschender ist, dass KWin als „Benchmarksieger“ aus dem Test
herausgeht. Phoronix ist sich der Einstellung der KWin-Entwickler
bewusst und verweist auch im Artikel auf die Änderungen in der
nächsten Version.
Systematische Fehler
Somit muss man sich fragen, wie es zu den Ergebnissen kommen konnte.
Diese Frage ist schwer zu beantworten, da erneut wichtige
Informationen zum Wiederholen der Benchmarks fehlen. Um die
Ergebnisse zu interpretieren, was Phoronix nicht macht, muss man
daher leider Vermutungen anstellen. Mit dem Wissen als
KWin-Maintainer dürfte eine der Wahrheit nahe kommende Analyse
möglich sein: In den Standardeinstellungen verwendet KWin eine
Option um Vollbindanwendungen nicht umzuleiten. Die Fenster werden
somit fast so gezeichnet wie ohne Compositing, ein gewisser
Overhead bleibt jedoch erhalten. Diese Option scheint bei allen
Phoronix-Tests aktiviert zu sein. Bei Compiz muss diese Option
jedoch manuell über CCSM aktiviert
werden [15]. Dies alleine
erklärt schon, warum KWin „besser“ abschneidet als Compiz. Jedoch
wäre nun interessant zu wissen, wie sich die Zahlen ändern, wenn
man die Option in Compiz ein- und in KWin ausschaltet. Phoronix
liefert diese Antwort jedoch nicht.
Man kann also davon ausgehen, dass Phoronix einen systematischen
Fehler begannen hat und im Endeffekt Äpfel mit Birnen vergleicht.
Dass der Nicht-Composited-Modus von KWin besser abschneidet als der
Composited-Modus von Compiz, ist nun wirklich nicht überraschend.
Dies hätte schon alleine dadurch auffallen müssen, dass KWin sogar
besser abschneidet als GNOME2 mit Metacity – einem Fenstermanager
ohne OpenGL-Compositing. Dies entspricht nicht Erwartung, dass
ein OpenGL-Compositor einen Leistungseinbruch für
jede hochfrequent zeichnende Anwendung mitbringt.
Bleibt zuletzt das „schlechte“ Abschneiden von Mutter bei diesem Benchmark zu betrachten.
Nach allem was soweit erläutert wurde, kann man davon ausgehen,
dass die Zahlen auch für Mutter schlicht und ergreifend nicht
interpretierbar sind. Von Messfehler bis korrektes Ergebnis ist
alles denkbar. Klar dürfte sein, dass Mutter die
Vollbild-Nicht-Umleitung noch nicht unterstützt (KWin in KDE 4.0
unterstützte diese auch noch nicht) und VSync aktiviert hat. Dies
ist eine logische Erklärung für das insgesamt deutlich schlechtere
Abschneiden von Mutter. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in
jedem Test Mutter ein Ergebnis erzielt hat, welches einer
Bildschirmfrequenz ähnelt oder sogar deutlich darüber liegt. Mutter
ist in diesem Punkt also genauso gut oder schlecht wie alle anderen
getesteten Fenstermanager.
Zuletzt sollte man sich fragen: Ist das überhaupt relevant? Selbst
wenn Mutter die FPS der Spiele reduziert, ist das von Bedeutung?
Braucht man Spiele, die mehr als die Bildschirmfrequenz an Frames
zeichnen? Heutzutage kann man Grafikkarten zur Physikberechnung
verwenden und somit die CPU entlasten. Eine Reduzierung der FPS
kann also sogar zu einer Verbesserung der Spielerfahrung führen. Es
kann also durchaus „Weniger ist Mehr“ gelten. Unter dieser Annahme
wäre somit KWin der Verlierer und Mutter der Sieger des Benchmarks.
Fazit
Benchmarks, wie sie regelmäßig auf Phoronix veröffentlicht werden,
sind ohne genauere Betrachtung nicht aussagekräftig und zum großen
Teil schlicht falsch. Sie folgen keiner wissenschaftlichen Methodik
und Phoronix ist sich dessen wohl sogar bewusst, da keine
Interpretation der Ergebnisse vorgestellt wird. Selbst die Zahlen
zu interpretieren, kann leicht zu falschen Ergebnissen führen. So
ist die Annahme, dass mehr gerenderte Frames einer besseren
Leistung entsprechen, im Allgemein nicht gültig. Mit sehr geringem
Aufwand lassen sich die Testbedingungen so verändern, dass komplett
gegensätzliche Ergebnisse entstehen. Im Endeffekt sind die
Benchmarks nur eine Aneinanderreihung nicht aussagekräftiger Zahlen.
Links
[1] http://www.phoronix.com
[2] http://www.phoronix-test-suite.com/
[3] http://www.kdedevelopers.org/node/4180
[4] http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Wieso-testet-heise-so-etwas-eigentlich-nicht-mehr-selber-heise-baut-echt-ab/forum-175858/msg-18210172/read/
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Methodik#Forschung
[6] http://wiki.cchtml.com/index.php/Glxgears_is_not_a_Benchmark
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/VSync
[8] http://www.phoronix.com/vr.php?view=16073
[9] http://de.wikipedia.org/wiki/Composition-Manager
[10] http://games.slashdot.org/story/11/06/02/0416219/GNOME-Shell-Hurts-Gaming-Performance
[11] http://smspillaz.wordpress.com/2010/05/21/beware-the-benchmarks/
[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Pixmap
[13] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/05/plasma-compositor-and-window-manager-in-4-7
[14] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/04/turning-compositing-off-in-the-right-way/
[15] http://wiki.compiz.org/GeneralOptions
| Autoreninformation |
| Martin Gräßlin (Webseite)
wird als KWin-Maintainer immer wieder mit fehlerhaften Benchmarks
konfrontiert und muss Nutzern oft erklären, warum Benchmarks nicht
hilfreich sind.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.
So ruhig, wie der aktuelle Entwicklungszyklus angefangen hatte, ging es erst einmal auch weiter. Linux 3.0-rc2 [1] war für einen -rc2 recht klein geraten, sodass Torvalds an die Freigabe-Mail gleich das Shortlog anfügte, eine Zusammenfassung der enthaltenen Patches, die er normalerweise erst bei späteren Vorabversionen dazu schreibt. Dessen Highlights bestanden in einer größeren Menge an Updates für btrfs und Korrekturen an Intels Speicherschnittstelle intel-iommu. Auch an virtio, einer Netzwerkimplementierung für virtuelle Maschinen, wurde gearbeitet. Aber ein bisschen Bewegung kam dann doch mit der nächsten Runde ins Spiel: Denn der -rc3 [2] hatte etwas mehr zu bieten, da nach dem Ende der LinuxCon in Japan die Entwickler wieder fleißig Patches einbrachten. So gab es einige Updates für den Radeon-Treiber, der sich nun auch mit AMDs Llano-Plattform, die Prozessor und Grafikkern auf einem Chip vereint, versteht. Der freie Nvidia-Treiber nouveau erhielt auch etwas Aufmerksamkeit, hier wurden ein paar Speicherfehler behoben. Daneben wurde die Unterstützung für LEON überarbeitet, der ersten unter einer freien Lizenz verfügbaren Mikroprozessorarchitektur [3]. LEON basiert dabei auf der SPARC-Architektur und wird aufgrund der Familienähnlichkeit innerhalb des Linux-Kernels auch im SPARC-Bereich gepflegt. RCU (Read-Copy-Update), eine Methode zur Synchronisation von Schreib- und Lesezugriffen auf den Speicher, konnte in 3.0-rc4 [4] ein Performance-Problem ausgetrieben werden, das in bestimmten Situationen auftrat. Dies ist auch schon ein guter Teil der Änderungen in der vierten Entwicklerversion, ein weiterer Batzen entfiel noch auf den neu hinzugekommenen Treiber für den LED-Hintgrundbeleuchtungs-Controller ADP8870. Viele weitere kleinere Korrekturen betrafen vor allem die Grafiktreiber nouveau und radeon sowie die meisten Dateisysteme, allem voran btrfs. Fiel -rc4 etwas kleiner aus als der Vorgänger, so schrumpfte -rc5 [5] fast schon auf ein handliches Maß. Das Microsoft-Netzwerk-Dateisystem CIFS sticht hier hervor, dem einige Fehler ausgetrieben wurden und auch an btrfs wurde weiter verbessert.
Müssen sich Linux-Nutzer noch an die neue Versionsnummer „3.0“ gewöhnen, geht es den Werkzeugen rund um den Kernel nicht anders. Bereits in 3.0-rc1 zogen die ersten Änderungen ein, die notwendig waren, damit das Prüfen und Einbinden von Kernel-Modulen auch mit der zweistelligen Nummer klappt oder make einen Kompilierungsvorgang überhaupt erst erfolgreich übersteht [6]. Solche Dinge sind essentiell, da ohne Möglichkeit, den Kernel zu kompilieren, auch kein Testen und keine Fehlersuche möglich ist. Auf kernel.org [7] jedoch klafft nach wie vor noch eine Lücke, wo normalerweise eine komfortable Liste der Änderungen im Vergleich zum vorangegangenen -rc hinter dem Link [View Inc.] verborgen wäre – ein kleines Zeichen dafür, dass die rein kosmetische Änderung des Nummernschemas einen für Außenstehende nicht so einfach nachvollziehbaren Schwanz an Änderungen mit sich bringt.
Links
[1] https://lkml.org/lkml/2011/6/6/118
[2] https://lkml.org/lkml/2011/6/13/375
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/LEON
[4] https://lkml.org/lkml/2011/6/21/2
[5] https://lkml.org/lkml/2011/6/27/396
[6] https://lkml.org/lkml/2011/5/30/212
[7] http://www.kernel.org
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels. Dafür erfährt er frühzeitig Details über neue Treiber und interessante Funktionen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Daniel Nögel
Im vorherigen Teil des Python-Tutorials (siehe freiesMagazin
05/2011 [1])
wurde das Iterator-Protokoll vorgestellt. Damit lassen sich eigene
Klassen leicht so erweitern, dass über sie iteriert werden kann. In
diesem Teil sollen nun mit Generator-Funktionen, List
Comprehensions und Generator Expressions drei Techniken vorgestellt
werden, mit denen sich iterierbare Objekte deutlich leichter
erstellen lassen.
Generator-Funktionen
Generatoren sind ein nützliches Werkzeug, um Iteratoren zu erzeugen.
Nicht immer muss also ein Iterator umständlich über __iter__()
und next() implementiert werden. Statt durch Klassen können
Generatoren durch einfache Funktionen umgesetzt werden.
Folgendes Beispiel zeigt, wie das RangeIterator-Beispiel aus dem
vorherigen Teil mit einer Generator-Funktion aussieht:
def range_generator(start, stop, step=1):
i = start
while i <= stop:
yield i
i += step
Diesen Generator unterscheidet zunächst nichts von einer
gewöhnlichen Funktion. Bei näherer Betrachtung fällt aber das
Schlüsselwort yield ins Auge: Es findet sich in
Generator-Funktionen an Stelle des Schlüsselwortes return und
macht aus einer gewöhnlichen Funktion eine Generator-Funktion.
Diese Generator-Funktion kann nun wie ein Iterator genutzt werden:
>>> for i in range_generator(0, 10, 2):
... print i
...
0
2
4
6
8
10
Wie funktioniert das? Beim Aufruf der Generator-Funktion wird
zunächst automatisch ein Generator-Iterator erstellt. Dieser
implementiert die Funktionen __iter__() und next() des
Iterator-Protokolls. Beim Aufruf von next() wird nun der Rumpf der
Generator-Funktion ausgeführt. Beim Auftreten des Schlüsselwortes
yield wird der Zustand des Generators eingefroren und der
jeweilige Wert an diejenige Instanz zurückgegeben, die die
next()-Methode des Generators aufgerufen hat. Beim nächsten Aufruf
von next() wird der Zustand des Generators wieder geladen und
dort fortgesetzt [2].
Das erscheint auf den ersten Blick komplizierter, als es ist. Beim
Schreiben einer Generator-Funktion kann man yield vielleicht
vereinfachend als ein „return mit Wiederkehr“ verstehen. Der
Programmfluss wird also so lange nach dem yield fortgesetzt, bis
die Generator-Funktion durchlaufen oder die aufrufende Schleife
abgebrochen wurde. Entsprechend finden sich in Generator-Funktionen
in aller Regel entweder mehrere aufeinander folgende
yield-Schlüsselworte oder ein yield-Schlüsselwort in einer for-
oder while-Schleife.
Hier erneut ein Beispiel zu Verdeutlichung:
>>> r = range_generator(0,10,3)
>>> r.next()
0
>>> r.next()
3
>>> r.next()
6
>>> r.next()
9
>>> r.next()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
StopIteration
In Zeile 1 wird ein Generator-Iterator erstellt und an den Namen r
gebunden. Durch den Aufruf der Funktion next() dieses
Generator-Iterators wird der Rumpf der Generator-Funktion zum
ersten Mal durchlaufen. Beim Schlüsselwort yield wird der
Programmfluss unterbrochen und 0 als Rückgabewert von next()
ausgegeben. Beim nächsten Aufruf von next() in Zeile 4 wird die
Generator-Funktion nach dem yield-Schlüsselwort fortgesetzt. Der
interne Zähler i wird um step erhöht und der nächste
Schleifendurchlauf der while-Schleife eingeleitet. Durch die
yield-Anweisung wird diesmal 3 als Rückgabewert der
next()-Funktion ausgegeben. Das Ganze kann einige Male wiederholt
werden.
Im letzten Teil wurde bereits darauf hingewiesen, dass das
Iterator-Protokoll die StopIteration-Exception vorsieht, um
anzuzeigen, dass ein Iterator keine weiteren Werte mehr bereit
hält. Das gilt auch für Generator-Funktionen. Im Fall der Funktion
range_generator wird die Exception automatisch geworfen, wenn der
Generator durchgelaufen ist und keine weiteren yield-Anweisungen
mehr folgen. Natürlich kann die Exception auch „manuell“ geworfen
werden, wenn gewünscht.
List Comprehensions
Bevor nun mit Generator Expressions eine noch kompaktere Form von
Generatoren vorgestellt wird, werden zunächst die sogenannten List
Comprehensions (LCs) besprochen. Dieses Sprachkonstrukt kann sicher
zu den zentralen Programmiertechniken in Python gezählt werden. So
sind LCs nicht nur in vielen Fällen deutlich effizienter als andere
Ansätze [3],
wenn es um das Durchlaufen und Filtern von Listen geht, sie sind
auch leicht zu verstehen und zu lesen.
LCs kommen immer da zum Einsatz, wo Elemente bestehender Iteratoren
nach bestimmten Kriterien gefiltert oder bearbeitet werden sollen.
Es sei etwa eine Liste numbers mit den Zahlen von 1 bis 10 gegeben.
Aufgabe ist es nun, eine Liste even zu erstellen, welche nur noch
diejenigen Zahlen aus numbers enthält, die ohne Rest durch 2
teilbar sind. Natürlich gibt es eine Vielzahl von
Sprachkonstrukten, mit denen sich diese Aufgabe lösen ließe – etwa
mit lambda-Funktionen [4].
Sehr häufig finden sich in der Praxis aber Konstrukte wie dieses:
numbers = range(1, 11)
even = []
for number in numbers:
if number % 2 == 0:
even.append(number)
Hier wird also schlicht über die Ausgangsliste iteriert und alle
Einträge, auf die ein bestimmtes Kriterium passt, in eine
Ergebnisliste eingefügt. Mit LCs lässt sich dies deutlich verkürzen:
even = [number for number in numbers if number % 2 == 0]
oder gleich:
even = [number for number in range(1, 11) if number % 2 == 0]
Natürlich sind noch deutlich komplexere Ausdrücke möglich. In diesem
Beispiel wurde die Ausgangsliste numbers nach einem bestimmten
Kriterium gefiltert. Es ist auch möglich, nach mehreren Kriterien
zu filtern und komplexere Ausdrücke zu nutzen:
another_list = [number**2 for number in numbers if number % 2 == 0 or number % 3 == 0]
Hier wird eine Liste mit dem Quadrat aller durch 2 oder 3 teilbaren
Zahl aus der Liste numbers erstellt. Zum besseren Verständnis
könnte diese LC auch wie folgt gegliedert werden:
another_list = [
number**2
for number in numbers
if number % 2 == 0 or number % 3 == 0
]
Die Reihenfolge der Anweisungen erscheint dabei zunächst nicht
intuitiv. So ist ja der Name number aus Zeile 2 erst einmal
unbekannt. Erst in Zeile 3 wird deutlich, dass number der Name
ist, an den die einzelnen Elemente von numbers gebunden wurde.
Weiterhin kommt der Ausdruck aus Zeile 2 nur zur Geltung, wenn die
Bedingung in Zeile 4 wahr ist.
Anders als vielleicht erwartet, ist eine LC also nicht nach dem
Schema „Schleife – Bedingung – Ausdruck“ aufgebaut, sondern folgt
dem Schema „Ausdruck – Schleife – optional: Bedingung oder weitere
Schleifen“. Werden mehrere Schleifen angegeben, verhalten sich
diese wie verschachtelte Schleifen.
Allgemein lässt sich die Syntax von List Comprehensions wie folgt
beschreiben:
- List Comprehensions werden in eckige Klammern gefasst.
- Das erste Element ist immer ein Ausdruck (etwa number**2).
- Darauf folgt immer ein for/in-Ausdruck (bspw. for number
in numbers).
- Darauf können weitere for/in- oder if-Ausdrücke folgen.
Das Ergebnis einer LC ist dann eine Liste der Ausdrücke aus (2),
nach Auswertung der Schleifen und Bedingungen in (3) und (4).
Weitere Beispiele und Vertiefungen finden sich in der
Python-Dokumentation [5].
Generator Expressions
Wie schon erwähnt sind List Comprehensions ein sehr vielseitiges
Werkzeug, das nicht nur häufig zur Anwendung kommt, sondern darüber
hinaus noch deutlich schneller ist als vergleichbare
for-Schleifen. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass auch
diese effizienten LCs letztlich Listen erstellen, die im
Arbeitsspeicher gehalten werden.
Wer beispielsweise die Summe der Quadrate aller Zahlen von 1 bis 100
berechnen möchte, könnte mit einer LC wie folgt
verfahren [6]:
>>> sum([i*i for i in range(101)])
338350
Durch die LC wir dabei zunächst eine Liste mit den entsprechenden
Quadraten angelegt. Die Funktion sum() gibt die Summe dieser
Zahlen aus. Nur für das einmalige Zusammenzählen der Zahlen wird
also eine Liste mit 100 Elementen im Speicher abgelegt. Im
vorherigen Teil wurde bereits darauf hingewiesen, dass in solchen
Situationen sehr häufig Iterator-Objekte die bessere Wahl sind.
Mit den sogenannten Generator Expressions gibt es parallel zu LCs
eine Syntax, um sehr komfortabel Generatoren zu erzeugen. Im
Unterschied zu LCs werden Generator Expressions nicht mit eckigen
Klammern, sondern mit runden Klammern erzeugt:
g = (i*i for i in range(101))
Wenn die Generator Expressions im jeweiligen Kontext ohnehin schon
geklammert werden – etwa als Parameter eines Funktionsaufrufe –
wird auf die runden Klammern verzichtet:
>>> sum(i*i for i in range(101))
338350
Ansonsten ist die Syntax von LCs und Generator Expressions
identisch, sodass eine LC durch das bloße Ersetzen der eckigen
Klammern durch runde in eine Generator Expression umgewandelt
werden kann (und umgekehrt). Das bedeutet aber auf keinen Fall,
dass die Unterscheidung zwischen LCs und Generator Expressions
hinfällig wäre. Zwar wird jeweils ein Objekt erzeugt, über das
iteriert werden kann, im Fall der LC werden aber erst alle Daten
berechnet und im Speicher abgelegt, während die Daten bei einer
Generator Expression sequentiell abgearbeitet werden.
Überblick
In diesem und den vorherigen Teil wurden verschiedene neue Techniken
im Zusammenhang mit iterierbaren Objekten vorgestellt. Ein kurzer
Überblick soll die vorgestellten Techniken erneut ins Gedächtnis
rufen:
- Das Iterator-Protokoll ermöglicht es, eigene Klassen durch die
Implementierung der Methoden next() und __iter__() zu
iterierbaren Objekten zu machen.
- Alternativ kann durch die Methode __getitem__() das
Iterator-Protokoll implementiert werden.
- Mit Generator-Funktionen können ebenfalls Iteratoren umgesetzt
werden. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich besonders durch
das Schlüsselwort yield von gewöhnlichen Funktionen.
- Mit List Comprehensions lassen sich effektiv und bequem Listen
erzeugen.
- Generator Expressions ähneln in ihrer Syntax LCs, erstellen
jedoch Generator-Iteratoren.
Übungen
Zur Vertiefung der hier angesprochenen Techniken kann man eine
Generator-Funktion schreiben, mit der über jedes Zeichen einer
gegebenen Textdatei iteriert werden kann (Hilfestellung [7]).
Als weitere Übung kann man mit Hilfe einer LC eine Liste erstellen,
die für alle Zahlen von 1 bis 100 Tuple der jeweiligen Zahlen und
ihrer Quadratwurzeln enthält. Die Ergebnisliste sollte also wie
folgt aussehen:
[(1, 1.0), (2, 1.4142135623730951), (3, 1.7320508075688772), (4, 2.0), ... ]
Als Erweiterung könnte die vorherige LC auf jene Zahlen beschränkt
werden, deren jeweilige Quadratwurzel natürlich ist.
Mögliche Lösungsansätze zu den oben beschriebenen Übungen sollen dann im
nächsten Teil dieser Reihe besprochen werden.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-05
[2] http://www.python-kurs.eu/generatoren.php
[3] http://blog.cdleary.com/2010/04/efficiency-of-list-comprehensions/
[4] http://www.secnetix.de/olli/Python/lambda_functions.hawk
[5] http://docs.python.org/tutorial/datastructures.html#list-comprehensions
[6] http://www.python.org/dev/peps/pep-0289/
[7] http://diveintopython3.org/files.html#for
| Autoreninformation |
| Daniel Nögel (Webseite)
beschäftigt sich seit drei Jahren mit Python. Ihn überzeugt
besonders die intuitive Syntax und die Vielzahl der unterstützten
Bibliotheken, die Python auf dem Linux-Desktop zu einem wahren
Multitalent machen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Herbert Breunung
Die am 14. Mai erschienene Version 5.14 [1]
wäre ein guter Vorwand, sich mit der Sprache zu beschäftigen, die so
viele emotionale Reaktionen provoziert. Ein besserer Grund sind
aber die Funktionalitäten, Module, Werkzeuge und Webseiten, welche
die Programmierlandschaft namens Perl in den letzten Jahren stark
verändert haben.
Weil kein auf Deutsch erhältliches Tutorial im Netz so recht darauf
eingeht, entschieden sich einige Mitglieder der Perl-Gemeinschaft
ein neues zu schreiben, welches auch in den nächsten Ausgaben von
freiesMagazin erscheinen soll. Es darf im Wiki der
Perl-Community [2]
von Jedem mit verbessert werden.
Dieses Tutorial richtet sich nicht an völlige Programmierneulinge.
Konzepte wie Schleifen, Variablen und Subroutinen (Funktionen)
werden als bekannt vorausgesetzt. Dafür wird der Einsatz
empfehlenswerter Module geübt und auf Probleme jenseits der heilen
„Hallo Welt“ eingegangen. Doch zuvor soll es um die Geschichte,
Philosophie und Gemeinschaft von und um Perl gehen, bevor das
nächste Mal der Praxisteil beginnt.
Wie alles begann
Perl ist ein Kind der quelloffenen Unix-Hackerkultur. Damals gab es
weder das Web, Python, Ruby noch Linux. Der stolze Vater (Larry
Wall) hatte sich bereits durch den E-Mailclient rn und das Werkzeug
metaconfig einen Namen erworben und seine Erfindung patch ist heute
eine Vokabel, welche die meisten Programmierer verstehen. Deshalb
schenkte man ihm auch im Dezember 1987 Beachtung, als er eine neue
Sprache veröffentlichte, die nach einer sehr mächtigen Shell
aussah. Sie vereinte grundlegende C-Syntax (Schlüsselworte,
Operatoren und geschweifte Klammern), Dateitestbefehle,
Spezialvariablen und Kommentare der Shell, die Unix-Kommandos
(chown bis unlink) und verstand sogar die aus sed, awk oder grep
bekannten regulären Ausdrücke. Das erleichterte nicht nur das
Erlernen, sondern auch die Entwicklung kleiner Programme, die
bisher zu komplex für Shellskripte waren, mit C aber um ein
vielfaches aufwändiger zu schreiben wären. Und so wurde Perl zu
einem wichtigen Werkzeug für Administratoren um Dateien
auszuwerten, andere Rechner zu überwachen oder an Sockets zu
lauschen und darüber übersichtliche Berichte zu verfassen. Und es
blieb bis heute dieses wichtige Werkzeug. Das nachträglich
gefundene Akronym „Practical Extraction and Report Language“
beschreibt genau dieses Anwendungsgebiet.
Perl 5 – der große Sprung
Wesentlich mehr Felder erschloss sich die Sprache 1994, mit der von
Grund auf neu entwickelten Version 5. Erweitert um eine
Schnittstelle für das Einbinden von Perl-fremden Programmteilen
(XS), Referenzen für komplexe Datenstrukturen, jederzeit ladbare
Pakete, Namensräume, lexikalisch lokale Variablen und eine sehr
lässige Objektorientierung war Perl bereit für größere Vorhaben.
Dann kam auch schon das WWW und Perlskripte waren ganz vorne mit
dabei, per CGI [3]
Webseiten mit Inhalten aus Datenbanken zu versorgen. Dank der
einheitlichen Datenbankschnittstelle DBI war das nicht allzu schwer.
Selbst heute, da wegen des einfacheren Verteilungsmechanismus PHP
hier sehr weit verbreitet ist, verwenden bekannte Firmen und
Institutionen wie Amazon, IMDb, Slashdot, Booking.com, die BBC, New
York Times, ORF und viele mehr Perl für ihren Internetauftritt.
Sogar Online-Spiele wie Lacuna Expanse [4]
nutzen es. Allerdings wird hier kaum noch CGI für die Schnittstelle
direkt eingesetzt. Neue Projekte werden heute mit komplexen
Webframeworks gebaut, welche die meiste Arbeit abnehmen. Perl hat
hierfür Catalyst [5],
Mojolicious [6] oder
Dancer [7], die auf Augenhöhe mit Pendants
wie Rails [8],
Django [9] oder
Sinatra [10] stehen. Auch im Bank- und
Nachrichtenwesen sowie in der Bioinformatik fand und findet Perl
weite Verbreitung.
Jede Linux-Distribution enthält neben Perl eine Reihe von Programmen
wie Frozen Bubble [11],
Shutter [12] oder
gmusicbrowser [13], welche in Perl
verfasst sind. Programmierer und Administratoren freuen sich eher
über ack [14], einer intelligenten
grep-Alternative. Des Weiteren läuft es oft an von außen nicht
sichtbaren Stellen. Es ist in git [15]
enthalten, in den Quellen von „Libre Office“ gibt es kleine
Perlskripte für Konvertierungen und selbst Google beschäftigt
Perl-Spezialisten, um nur drei Beispiele zu nennen, warum manche Perl
als das Klebeband bezeichnen, welches das Internet zusammenhält.
Ende der 1990er Jahre wurde Perl auf Mac und Windows portiert und
heute gibt es nur eine Handvoll sehr seltener Betriebssysteme, für
die es Perl nicht gibt.
Perl 5 und Perl 6
2000 kündigte Larry Wall schließlich Perl 6 an, um der etwas
eingeschlafenen Gemeinschaft wieder ein großes begeisterndes Ziel
zu geben. Aus diesem anfangs ungenauen Vorhaben entstand mit der
Hilfe mehrerer hundert Vorschläge eine sich immer weiter
verfeinernde Spezifikation (Synopsen genannt). Mehrere Interpreter
und Compiler, darunter besonders Rakudo [16]
und Niecza [17], erfüllen bereits
große Teile dieser Spezifikation, laufen auch relativ stabil, aber
sehr langsam. Sie werden regelmäßig veröffentlicht und bereits für
kleinere unkritische Aufgaben eingesetzt.
Rakudo ist ein Aufsatz für Parrot [18], einer
quellfreien virtuellen Maschine, ähnlich der JavaVM oder der CLR
von Microsoft. Sie ist besonders für dynamische Sprachen wie Perl,
Python oder Ruby ausgelegt und wird auch mit dem Ziel entwickelt,
dass in einer Sprache geschriebene Bibliotheken ebenfalls in allen
anderen Sprachen nutzbar sind.

Camelia-Logo. © Larry Wall (Artistic License 2.0)
Perl 6 [19], ist eine vollständig neue, klar
strukturierte Sprache, die wesentlich umfangreicher und auch
mächtiger ist als Perl 5, der sie nur oberflächlich und in ihrer
Philosophie ähnelt. Sie besitzt optionale Datentypen und vollständig
überarbeitete reguläre Ausdrücke, die zu Klassen (Grammatiken)
zusammengefasst werden dürfen. Das kann genutzt werden, die Syntax
sauber zur Laufzeit zu verändern. Somit könnte es zum
wirkungsvollen Gegenmittel der um sich greifenden Komplexität in
der Softwarewelt werden. Eine vollständige Liste der Fähigkeiten
ist kaum möglich, 19 von 20 Fragen „Hat Perl 6 eine Syntax für …?“
können mit Ja beantwortet werden.
Deshalb wird Perl 6 in absehbarer Zeit weder Perl 5 ersetzen noch
endgültig fertiggestellt werden. Aber viele Ideen daraus wurden in
Module gepackt (diese beginnen meist mit Perl6::), und können in
Perl 5 genutzt werden. Das bekannteste dieser Module ist
Moose [20], welches mit seinen
vielen Erweiterungen nicht nur ein modernes System zur
Objektorientierung [21]
in Perl 5 bereitstellt, sondern auch Teilklassen, Typisierung von
Parametern, eigene Subtypen und sehr, sehr vieles mehr. Ein Teil
der neuen OOP-Syntax könnte in den nächste Jahren in den Sprachkern
wandern.
Seit Version 5.10 sind bereits einige der nützlichsten und
portabelsten Ideen aus Perl 6 diesen Weg gegangen. Sie müssen aber
mit use v5.10; zugeschaltet werden, da sie das Funktionieren
älterer Programme stören könnten.
Die „Renaissance of Perl“
Moose, Catalyst sowie die meisten hier genannten Pakete sind
Beispiele für eine neue Generation Module und auch einen neuen
Geist, der seit etwa drei bis vier Jahren einzog. Enthusiasten
gründeten sogar die EPO [22], die
„enlightened perl organisation“ , um diese Entwicklung zu fördern
und zu steuern. Lange ausstehende Probleme wie die umständliche
Kompilierung von XS-Modulen unter Windows wurden
gelöst [23] und fast sämtliche wichtigen
Webseiten wurden neu gestaltet oder ersetzt. Sogar eigene
Entwicklungsumgebungen und Editoren werden in Perl verfasst. Dazu
gehörte auch, die Quellen von Perl in ein git-Archiv zu portieren
und der Wechsel zu vorhersehbaren Zyklen, in denen neue Haupt- und
Nebenversionen erscheinen.
Das große Archiv
Doch was ist es, das Menschen Perl wählen lässt? Dafür gibt es einen
praktischen Grund und einen emotionalen. Der praktische heißt kurz
und trocken CPAN [24]. Für fast jedes Problem
gibt es dort eine vorgefertigte Lösung in Form eines Moduls
(Bibliothek). Neben dem Umfang (beinah 100.000 Module) ist es aber
auch die umgebende Infrastruktur, die in der Welt der Freien
Software ihresgleichen sucht. Sie beginnt bei
einer (meist
eingehaltenen) Kultur, genügend Dokumentation zu schreiben. Für
umfassende Softwaretests gibt es wiederum viele Module, welche fast
immer gut zusammenarbeiten und ein Grund sind, warum Perl in
manchen Firmen nur eingesetzt wird, um andere Software oder Hardware
zu überprüfen. Das dafür entworfene Protokoll (TAP) entwickelte
sich aus der Testsuite für Perl 1.0 und ist heute ein Standard auch
für PHP, Java, Ruby, Python und andere Sprachen.
Jeder, der CPAN-Module verwenden will, sieht TAP-Ausgaben, weil ohne
bestandene Tests die Installation abgebrochen wird. Viele
Perl-Enthusiasten lassen nur diese Tests automatisiert laufen. Die
zurückgesandten Ergebnisse werden zu Tabellen gebündelt, in denen
die Entwickler schnell sehen können, welche Probleme das Modul mit
einer Plattform und Perlversion hat. So können die
Wahrscheinlichkeiten angezeigt
werden, mit welcher ein Modul mitsamt
Abhängigkeiten unter der heimischen Plattform installierbar
ist.
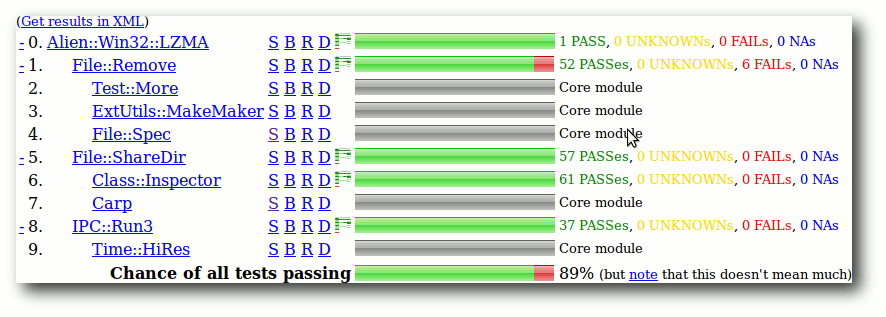
Installationswahrscheinlichkeit der Abhängigkeiten eines Moduls im CPAN.
Auch Bugtracker, Foren und mehrere Kommentar-, Bewertungs- und
Verlinkungsmöglichkeiten unterstützen Autoren und Nutzer. Jede
veraltete Version ist im BackPAN [25]
gespeichert. Auf cpan.org werden sogar die Unterschiede von
Versionen in farbig markierten diffs angezeigt. Neue CPAN-Clients
wie cpanminus bieten
eine noch einfachere Installation. Lediglich
die möglichen Konflikte mit der Paketverwaltung der Distribution
sind noch ein offenes Problem, das sich aber bereits mit
perlbrew [26] umgehen
lässt.
Auch bei fehlenden Schreibrechten können hiermit parallel
zum Perl des Systems Testumgebungen mit anderen Perl- oder
Modulversion erstellt werden.
Die Perl-Philosophie
Der emotionale Grund für Perl ist seine Syntax, welche besonders
viele unterschiedliche Formulierungen eines Sachverhaltes erlaubt.
Dadurch wird die subjektiv befriedigendste Alternative wählbar,
egal nach welchem Ideal man sich richtet. Diese Idee verkürzte
Larry Wall zur Parole
TIMTOWTDI [27]
(„There is more than one way to do it.“ – „Es gibt mehr als einen
Weg, es zu tun.“). Menschen wie Guido van Rossum, dessen Python
im Sprachdesign dazu einen Gegenpol bildet („Es gibt nur einen Weg.“),
sehen darin eher ein Grundübel und Hauptursache unlesbarer und
unwartbarer Programme. Ihr Argument ist, eine „saubere“ Sprache
müsse einfach erlernbar sein und dürfe daher nur wenig Regeln
haben, da Code wesentlich öfter gelesen als geschrieben werde.
Larry Walls Gegenargument dazu ist, dass der praktische Nutzen
wichtiger sei, schließlich werde nur einmal gelernt, aber oft
angewendet.
Viele der Regeln, die Python vorschreibt, wie einheitliche
Einrückungen und „nur ein Befehl pro Zeile“, sind auch in der
Perlwelt so allgemein anerkannt, dass darüber praktisch nie
gestritten wird. Perlanhänger stören sich lediglich daran, keine
wohlbegründeten Ausnahmen machen zu können. Besonders in großen
Projekten, wo klare Regeln zum Gelingen eindeutig beitragen, können
Perl::Critic und Perl::Tidy helfen, die selbst gewählten Regeln
einzuhalten.
Eine natürliche Sprache
Doch Perl ist mehr als nur TIMTOWTDI, denn Larry Wall ist auch
bekennender Christ und entlehnte den Namen aus einem
Bibelzitat [28],
in dem es um das Erreichen des Paradieses, also des maximalen
Glücksgefühls geht. Und tatsächlich traf er viele
Designentscheidungen aus dem Bauch. Im Gegensatz zu anderen
Sprachentwicklern, denen es um logische Eleganz oder einen
effizienten Minimalismus geht, der auch wesentlich besser in ein
akademisches Umfeld passt, musste es sich für Larry stimmig
anfühlen. Er vergaß nie, daß vor dem Rechner Menschen mit Gefühlen
sitzen, deren Sprachempfinden täglich in einer Umgebung trainiert
wird, die meist nichts mit Computern zu tun hat. Viele der
Perlbefehle, die nicht C oder dem gängigen Sprachgebrauch der
Programmierer entlehnt wurden, gehören dem einfachen Englisch an
wie z. B. use, ISA (is a), tie und viele mehr. Der studierte
Linguist ließ aber auch sein Wissen über menschliche Lese- und
Sprachgewohnheiten einfließen, was noch deutlicher an Perl 6
erkennbar ist.
Dazu gehört, dass Sprachen niemanden aussperren, der bestimmte
Konzepte nicht verstanden hat, die nicht absolut notwendig sind.
Natürliche Sprachen erlauben auch das Kombinieren der Wörter zu
neuen Bedeutungen, was in Computersprachen oft weniger frei ist und
zu einer Überzahl spezialisierter Befehle führen kann. Das ist eine
Hauptursache warum PHP ca. 2500 Kernbefehle hat und Perl etwa 300.
Perls Eigenarten lassen sich aber an seinem
Maskottchen ablesen, dem Kamel: Es riecht nicht immer gut und
spuckt auch manchmal, ist aber robust und zuverlässig.
Perl in der Kritik
Dass Perl dennoch von einigen als besonders furchtbar empfunden
wird, hat vielfältige Gründe. Manche Menschen mögen nicht so viele
Sonderzeichen auf dem Bildschirm, was aber eher Gewohnheit oder
ästhetisches Empfinden und nicht debattierbar ist.
Sonderzeichen in regulären Ausdrücken haben sich als nützlich
erwiesen und sind in fast jeder Sprache zu finden. Am
Variablenanfang können sie wertvolle Orientierung bieten. Als Name
von Sondervariablen sind sie wirklich eher verschleiernd als
nützlich. Dies und Ähnliches hat zu Zeiten von Perl 3 einige
Tastaturanschläge gespart, wird aber heute von kaum jemand in der
Perlgemeinde verteidigt. Veraltete Konstrukte wie diese wurden über
Gebühr beibehalten, da Perl immer eine Politik verfolgte, wenn
möglich keine Kompatibilität zu brechen. Viele Uralt-Programme
laufen selbst mit aktuellen Versionen. Deshalb kann heute sowohl
sehr „moderner“ Code geschrieben werden, als auch mit veralteten
Idiomen gespickter.

Parrot-Logo. © Perl Foundation (Artistic License 2.0)
Als wirklich problematisch wird von den Entwicklern vor allem das
altertümlich wirkende Fehlen von
Signaturen [29]
und die Objektorientierung anerkannt, die mit einem Regal zum
Selbstzusammenschrauben vergleichbar ist. Sie bietet kein
Hindernis, Ideen zu verwirklichen, aber stellt Neulinge vor unnötig
große Herausforderungen. Für beides gibt es zwar Module (Moose und
viele andere), aber es ist geplant, mit den nächsten beiden
Versionen (5.16, 5.18) das mit neuen Schlüsselwörtern zu beheben.
Was die Leute so treiben
Ebenfalls ein starkes Argument für Perl sind die Menschen, die sich
damit befassen. Ein kurzer Blick auf diese Seite Perl
Mongers [30] reicht, um welche in einer
naheliegenden Stadt treffen zu können. Die Frankfurter gehören ohne
Zweifel zu den aktivsten, denn nicht zufällig findet der nun schon
dreizehnte deutsche Perl-Workshop [31] im
Oktober diesen Jahres auch dort statt. Jeder mit ernsthaftem
Interesse ist dort herzlich eingeladen. Der deutsche war zwar der
erste, aber mittlerweile finden solche Workshops überall auf der
Welt statt. Dem unaufhaltsamen Andrew Shitow gelang es sogar
zwischen Minsk und Wladivostok fast 10 Workshops in nur einem Jahr
zu organisieren. Dafür überließ man dieses Jahr auch ihm die
Ausführung der YAPC::EU [32] vom
15. bis 17. August 2011 in Riga.
Diese Treffen von ca. 300 bis 400 Menschen auf kontinentaler Ebene
sind ebenfalls reine Begegnungen der sich selbst organisierenden
Gemeinschaft. Dahingegen ist die OSCON [33]
in den USA, die einst aus der Perl-Conference entstand, eine eher
kommerzielle Veranstaltung mit wesentlich mehr Besuchern. Dort
reden regelmäßig Perl-Größen wie Damian Conway, für den immer schon
ein Raum für einen ganzen Tag eingeplant ist, oder Larry Wall, der dort
seine jährliche „State of the Onion“-Rede hält, in der er den
derzeitigen Zustand von Perl zu beschreiben versucht.
Daraus leitet sich auch das Zwiebel-Logo der
Perl-Foundation [34] ab, welche die
meisten rechtlichen und finanziellen Dinge für Perl regelt. Sie
treibt vor allem Spenden ein und fördert damit besonders wichtige
Vorhaben und betreibt die Server, auf denen die wichtigen Seiten
laufen, wie perl.org [35],
Dokumentation [36], das CPAN, das zentrale
Diskussionsforum [37],
Blogs [38] und die Homepage vieler der
großen Projekte.
Die URL de.perl.org leitet auf das größte deutsche
Forum [39] um, das auch ein Wiki und die
deutsche Perldokumentation umfasst. Dort tummeln sich unter anderem
die Macher des Perl-Magazins $foo [40]
und der eher auf Anfänger ausgerichteten
Perlzeitung [41]. Es gibt aber auch andere
Foren wie perlunity [42] und andere
Zeitschriften wie das Linux-Magazin [43],
das in jeder Ausgabe eine Perl-Kolumne hat. Auch
heise [44] hat ab und an einen Perl-Artikel, aber
um wirklich auf dem laufenden zu bleiben, empfehlen sich die
deutschen Perl-Nachrichten [45]. Wer
englisch lesen kann, sollte die spärlichen
Perl News [46] meiden und gleich auf
Perlsphere [47] oder den Perl-Blogs sich
das Passende suchen, ganz gut gefiltert auch auf
Perlbuzz [48].
Auch wenn die offizielle Einsteigerseite [49]
und auch die Perl Beginners' Site [50] nicht
schlecht sind, so bietet das Buch „Einführung in Perl“ von Randal L.
Schwartz und Brian D. Foy immer noch den besten und auch
aktuellsten Anfang. Dem sollte man unbedingt
„Modern Perl“ [51]
folgen lassen oder man wartet bequem die nächste Ausgabe von
freiesMagazin ab, in der zu ersten kleinen aber praktischen
Skripten angeleitet wird.
Links
[1] http://news.perlfoundation.org/2011/05/perl-514.html
[2] http://wiki.perl-community.de/foswiki/bin/view/Wissensbasis/Perl5Tutorial
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
[4] http://www.lacunaexpanse.com/
[5] http://www.catalystframework.org/
[6] http://www.mojolicious.org/
[7] http://perldancer.org/
[8] http://rubyonrails.org/
[9] http://www.djangoproject.com/
[10] http://www.sinatrarb.com/
[11] http://www.frozen-bubble.org/
[12] http://shutter-project.org/
[13] http://gmusicbrowser.org/
[14] http://betterthangrep.com/
[15] http://git-scm.com/
[16] http://www.rakudo.org
[17] http://github.com/sorear/niecza
[18] http://parrot.org/
[19] http://www.perl6.org/
[20] http://www.iinteractive.com/moose/
[21] http://de.wikipedia.org/wiki/Objektorientierte_Programmierung
[22] http://www.enlightenedperl.org/
[23] http://win32.perl.org/
[24] http://www.cpan.org/
[25] http://backpan.perl.org/
[26] http://search.cpan.org/dist/App-perlbrew/
[27] http://oreilly.com/catalog/opensources/book/larry.html
[28] http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Mt13%2C46
[29] http://de.wikipedia.org/wiki/Signatur_(Programmierung)
[30] http://www.perlmongers.de/
[31] http://www.perl-workshop.de/
[32] http://yapceurope.lv/ye2011/
[33] http://www.oscon.com/
[34] http://www.perlfoundation.org/
[35] http://www.perl.org/
[36] http://perldoc.perl.org/
[37] http://www.perlmonks.org/
[38] http://blogs.perl.org/
[39] http://www.perl-community.de/
[40] http://www.perl-magazin.de/
[41] http://perl-zeitung.at/
[42] http://www.perlunity.de/
[43] http://www.linux-magazin.de/
[44] http://www.heise.de/
[45] http://perl-nachrichten.de/
[46] http://perlnews.org/
[47] http://perlsphere.net/
[48] http://perlbuzz.com/
[49] http://learn.perl.org/
[50] http://perl-begin.org/
[51] http://www.heise.de/developer/artikel/Modern-Perl-1171973.html
| Autoreninformation |
| Herbert Breunung (Webseite)
ist seit sieben Jahren mit Antworten, Vorträgen, Wiki- und
Zeitungsartikeln in der Perlgemeinschaft aktiv. Dies begann mit dem
von ihm entworfenen Editor Kephra,
den er leidenschaftlich gerne pflegt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Markus Mangold
Viele denken, es sei aufwändig kleinere Spiele zu programmieren.
Dabei kann es mit EGSL so einfach sein. Der Artikel zeigt auf, was
es mit dem Interpreter auf sich hat und wie EGSL entstand. In einem
ersten Beispiel wird gezeigt, wie man prinzipiell mit EGSL
zweidimensionale Spiele programmieren kann.
Was ist EGSL?
EGSL [1] steht für „Easy Game
Scripting mit Lua“ und ist ein
Lua-Interpreter [2],
mit dem zweidimensionale Spiele programmiert werden können. Der
Interpreter ist in FreePascal [3]
implementiert und benutzt zur Grafik- und Soundausgabe SDL, SDL_gfx
und SDL_mixer. Weitere Informationen dazu
findet man
auf der SDL-Seite [4].
Das Besondere an EGSL ist, dass der Interpreter zum einen mit einem
einfachen Editor geliefert wird (ebenfalls in Pascal programmiert)
und zum anderen die Funktionen an „klassische“ BASIC-Dialekte
angelehnt sind. Im Gegensatz zum bekannten Lua-Interpreter können
mit EGSL eigenständige Programme erstellt werden. Dazu wird das
Script an den EGSL-Interpreter gebunden und später nicht von der
Festplatte nachgeladen, sondern direkt im Speicher ausgeführt. Wenn
ein EGSL-Spiel weitergegeben wird, wird also immer der gesamte
Interpreter mitgeliefert. Aufgrund der äußerst liberalen
zlib-Lizenz [5]
stellt dies – auch für eine eventuelle kommerzielle Nutzung – kein
Problem dar.
Auf der EGSL-Seite [1] steht
der komplette Quellcode zum Herunterladen zur Verfügung (und
natürlich komplette Installationsarchive). Die reine EGSL-Engine –
zuständig für Grafik, Sound und Eingabe – ist im Archiv vorhanden,
d. h. Pascal-Programmierer können damit, ganz ohne Lua lernen zu
müssen, ein Spiel programmieren. Dabei ist Lua eigentlich sehr einfach
zu erlernen, weswegen die Sprache auch gewählt wurde. Zum anderen
ist der Interpreter aber auch sehr schnell und wird ebenfalls in
kommerziellen Spielen (wie z. B. World of Warcraft) für Scripts
eingesetzt.
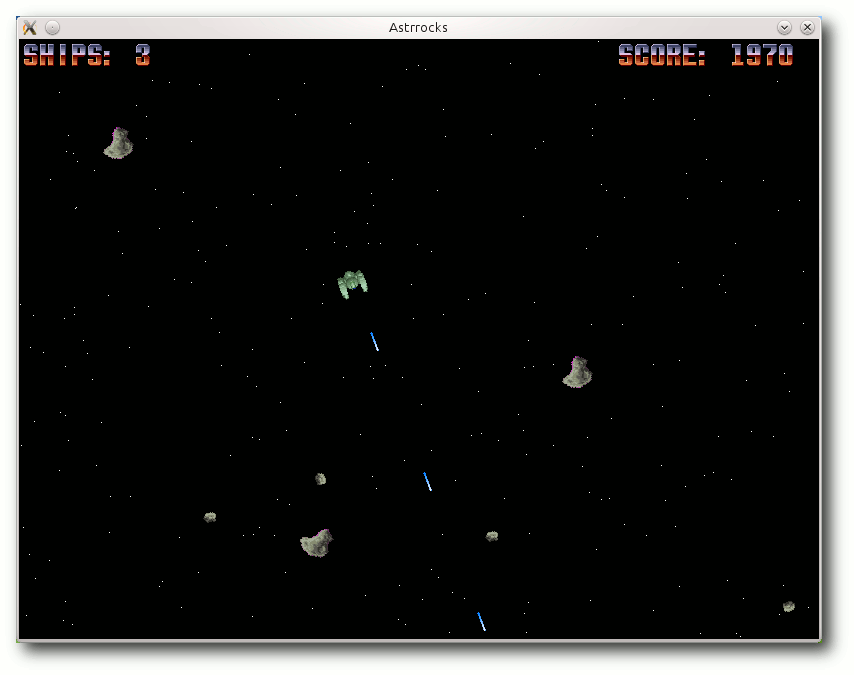
Ein in EGSL programmiertes Spiel.
Wie entstand EGSL?
EGSL entstand teilweise aus der Not heraus. Mir wollte keine der
bekannten BASIC-Sprachen zur Spieleprogrammierung gefallen. Sei es,
dass die Entwicklung nicht mehr weitergeführt wurde, die
Interpreter zu langsam oder schlichtweg zu teuer waren oder keine
Unterstützung für Linux angeboten wurde. Denn es war klar: Die
Software musste auf Windows und Linux gleichermaßen und – da dies
die Hauptentwicklungsplattform ist – auch auf einem 64-Bit-Linux
funktionieren. Aktuell kommt für die Entwicklung Kubuntu 10.10
zum
Einsatz. Und EGSL bietet genau diese Möglichkeiten: Ein Lua-Script
ist ohne Änderung auf allen Plattformen lauffähig.
Installation von EGSL
Die Installation von EGSL gestaltet sich recht einfach, da auf der
Internetseite fertige DEB-Pakete vorhanden sind. Diese installiert
man am besten mit dem Paketmanager. Alternativ existieren auch zwei
tar.gz-Archive, die in ein beliebiges Verzeichnis entpackt werden
können. Dabei ist zu beachten, dass alle Dateien in dasselbe
Verzeichnis entpackt werden, damit EGSL einwandfrei funktioniert.
Die EGSL-Entwicklungsplattform
Die EGSL-IDE ist ein minimalistischer Texteditor mit
Syntax-Hervorhebung für Lua und die EGSL-Funktionen. Die Menüpunkte
(in Englisch) dürften alle selbsterklärend sein. Mit der rechten
Maustaste kann ein Popup-Menü aktiviert werden, das die gleichen
Punkte enthält wie das Menü „Edit“, also Ausschneiden, Kopieren,
Einfügen und Suchen. Die Suche funktioniert bisher nur vorwärts in
dem jeweiligen Dokument.
Mit der Taste „F5“ kann ein Programm direkt ausgeführt werden, mit
der Taste „F7“ wird die
aktuelle Datei in ein ausführbares Programm
„umgewandelt“.
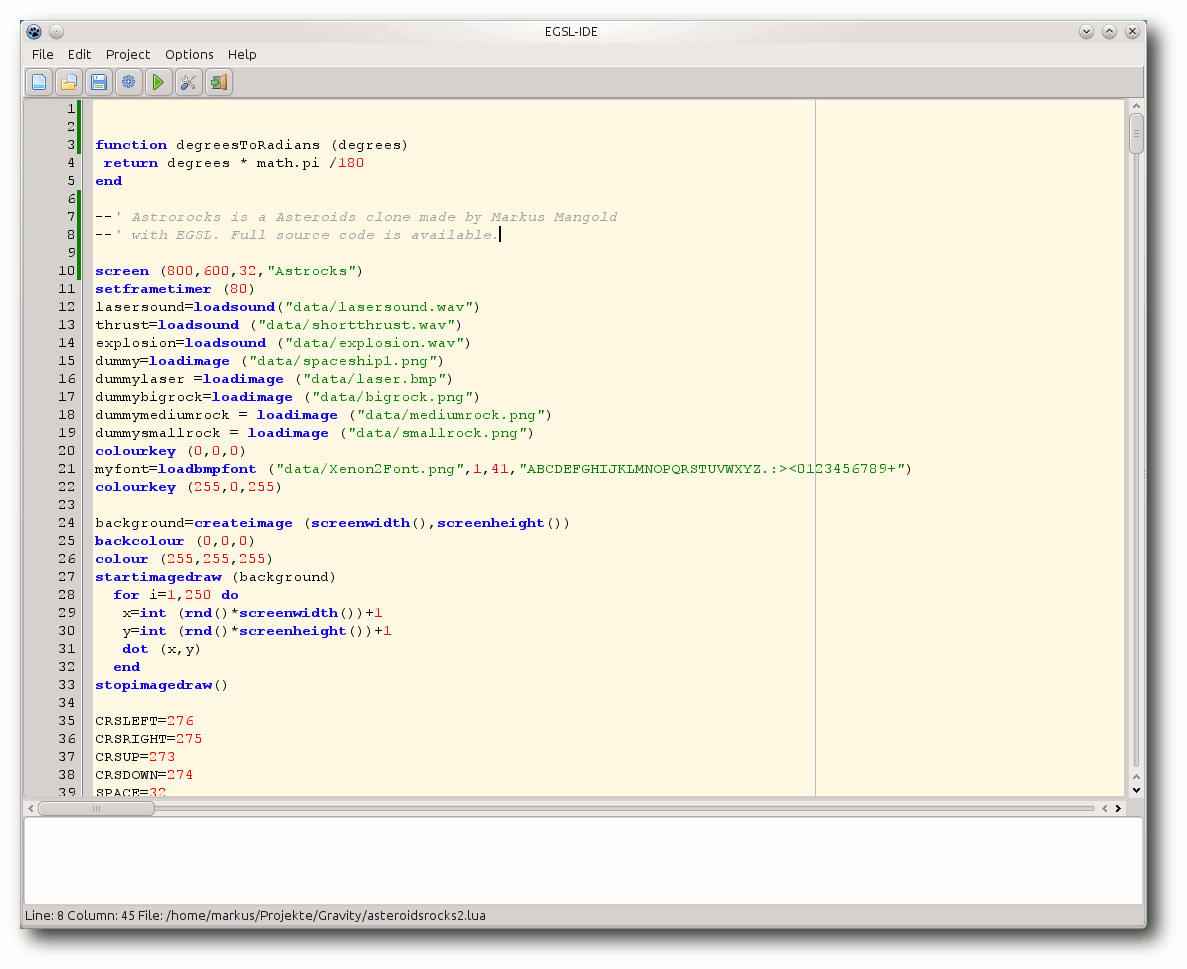
Die mitgelieferte IDE.
Einführendes Beispiel
Ein einführendes Beispiel soll zeigen, wie man mit EGSL eine Grafik
mittels der Pfeiltasten auf dem Bildschirm bewegen kann. Um alles
recht einfach zu halten, wird als Grafik ein ausgefüllter Kreis
(fillcircle) verwendet. Um das Ganze übersichtlicher zu
gestalten, wird eine
Lua-Tabelle mit dem Namen sprite verwendet,
die in dem Beispiel als Struktur fungiert.
Zuerst wird ein Fenster geöffnet:
openwindow (640,480,32,"Hello World")
Dies sollte übrigens immer der erste Befehl sein, da damit das
gesamte System von EGSL initialisiert wird. Geöffnet wird hier ein
Fenster mit einer Auflösung von 640x480 Punkten, 32-Bit Farbtiefe
und dem Titel „Hello World“.
Als nächstes wird der Timer eingestellt, damit auf allen Rechnern
ein etwa gleich schneller Spielfluss abläuft:
setframetimer (80)
Der Frametimer gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde maximal laufen
dürfen. Im Gegensatz zu einem 3-D-Spiel will man nicht das maximal
Mögliche aus dem System herausholen, sondern gibt eine Beschränkung
an. Sonst könnte es sein, dass auf einem sehr schnellen Rechner das
Spiel unspielbar wird, da die Logik zu schnell abläuft.
Damit das Sprite später „durchsichtig“ wird, wird ein Colourkey
gesetzt:
colourkey (0,0,0)
In dem Fall die Farbe Schwarz, d. h. der Rot-, Grün- und Blau-Anteil
ist jeweils 0.
Das Sprite wird mit der Größe 32x32 angelegt und der X- und Y-Position
320 und 240 positioniert:
sprite={}
sprite.image = createimage (32,32)
sprite.x=320
sprite.y=240
Als nächstes wird das Bild gezeichnet. Es soll ein gelber ausgefüllter Kreis werden:
startimagedraw (sprite.image)
colour (255,255,0)
fillcircle (16,16,15)
stopimagedraw()
Mit startimagedraw() beginnt man, auf einem zuvor erstellten Bild
zu zeichnen; in diesem Fall sprite.image. Die Zeichenfarbe wird
auf Gelb gesetzt, d. h. ein Rot- und Grünanteil von je 255 und ein
Blauanteil von 0. Der Kreis wird mittels fillcircle() auf das
sprite.image gesetzt an der X- und Y-Position 16. Der Radius
beträgt 15 Bildpunkte.
Danach kann man die eigentlich Spielschleife beginnen lassen, wobei
als erstes der Fensterinhalt gelöscht wird:
repeat
cls()
Die Löschung geschieht übrigens bei jedem Durchlaufen, also mehrmals
pro Sekunde. (In vorliegenden Fall 80 Mal, da der Frametimer auf 80
eingestellt wurde.)
Mittels
key=getkey()
wird der Variablen key der ASCII-Wert der Funktion getkey()
zugewiesen. Wenn keine Taste gedrückt wird, passiert natürlich
nichts. Die Taste „Escape“ beendet das Programm (siehe Ende der
Repeat-Schleife weiter unten).
Für die Bewegung des gelben Kreises muss man die Pfeiltasten abfragen:
if keystate (274) then
sprite.y=sprite.y+1
end
if keystate (273) then
sprite.y=sprite.y-1
end
if keystate (275) then
sprite.x=sprite.x+1
end
if keystate (276) then
sprite.x=sprite.x-1
end
Man sollte beachten, dass die Funktion keystate nichts mit der
Funktion getkey() zu tun hat. keystate gibt vielmehr einen
Booleschen Wert (wahr oder falsch) zurück, was es ermöglicht, mehrere
Tasten gleichzeitig abzufragen. Ausführlich könnte die
Tastenabfrage so aussehen:
if keystate (274) == true then
Danach wird das Sprite an der X- und Y-Position sprite.x und
sprite.y gezeichnet:
putimage (sprite.x, sprite.y, sprite.image)
Mittels
wait (timeleft())
wird dafür gesorgt, dass das Limit des Frametimers eingehalten wird.
Der nächste Befehl
redraw()
muss etwas genauer erklärt werden. In EGSL wird alles zunächst in
den Doppelbuffer [6]
gezeichnet. Erst wenn redraw() aufgerufen wurde, ist der aktuelle
Zustand sichtbar, d. h. ohne redraw() bleibt der Fensterinhalt
schwarz. (Alternativ kann ab Version 1.4.0 die Funktion sync()
benutzt werden – sie fasst die zwei Funktionen wait() und redraw()
zusammen.)
Das Ende der Repeat-Schleife bildet
until key==27
Solange nicht die Taste „Escape“ (entspricht Keycode 27) gedrückt
wurde, läuft die Schleife weiter.
Der letzte Befehl im Programm sollte immer
closewindow()
sein, da hiermit der belegte Speicher wieder
freigegeben und das
SDL-System beendet wird. Danach kann wieder ein openwindow()
folgen, das aber wiederum mit einem closewindow() beendet werden
muss.
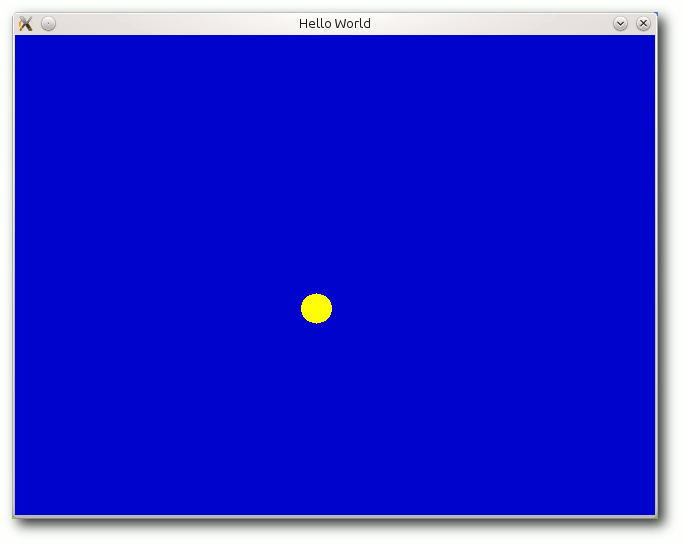
Das einführende Beispielprogramm.
Dies war nur ein kleiner Einblick in das, was mit EGSL alles möglich
ist. Wer schon einmal mit dem einen oder anderen BASIC-Dialekt
gearbeitet hat, wird sich bei EGSL sicher schnell zurecht finden.
Das Programm wird kontinuierlich
verbessert, es lohnt sich also,
öfter mal auf der Internetseite vorbei zu schauen. Leider ist die
Dokumentation noch nicht ganz fertig, aber auch daran wird ständig
gearbeitet.
Fazit
Wer gerne ein Computerspiel nach Retro-Art programmieren möchte, das
eventuell auch multiplattformfähig sein soll, sollte einen Blick
auf EGSL werfen. Aufgrund der Einfachheit der Lua-Programmiersprache
liegen schnell erste Ergebnisse vor. Dabei eignet sich EGSL nicht
nur für Spiele allein: Sogenannte Old-School-Demos mit Laufschrift
sind ebenfalls im Nu programmiert.

Eine klassische Demo mit 50 bewegten, sich drehenden Bällen und Alphablending.
Hilfe zu EGSL erhält man im (englischsprachigen)
Forum [7]. Bei
entsprechendem
Interesse ist es durchaus vorstellbar, dass ein deutschsprachiges
Unterforum eingeführt wird.
Links
[1] http://egsl.retrogamecoding.org/
[2] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Lua
[3] http://freepascal.org/
[4] http://www.libsdl.org/
[5] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Zlib-Lizenz
[6] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Doppelpufferung
[7] http://forum.retrogamecoding.org/
| Autoreninformation |
| Markus Mangold
ist der Entwickler von EGSL. Er begann
im Jahr 1984 mit dem Programmieren auf einem C64 und der Sprache
BASIC. Bis heute ist vor allem das Entwickeln von 2-D-Spielen sein
Hobby geblieben, am liebsten mit EGSL oder FreePascal.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Wolfgang Wagner
Mit Python Webcambilder einlesen und bearbeiten, das ist einfacher
als man denkt. Wer die Python-Kurse in den vergangenen Ausgaben von
freiesMagazin verfolgt hat, dem wird es leicht fallen, die
nachfolgend gezeigten Beispiele nachzuvollziehen und für die
eigenen Bedürfnisse anzupassen und zu verbessern. Zunächst soll
gezeigt werden, wie man ein Livebild am Bildschirm ausgibt.
Anschließend folgt dann ein kleines Programm für die
Videoüberwachung, das immer dann den Videostream abspeichert, wenn
im Bild eine Bewegung festgestellt wird.
Genutzt wird bei beiden Beispielen eine Programmbibliothek, mit der
man viel mehr tun kann, als nur Webcambilder aufzeichnen: OpenCV.
Einleitung
OpenCV (Open Source Computer Vision) [1]
ist eine von Intel ins Leben gerufene Programmbibliothek, die
Funktionen zum Einlesen von Kamerabildern für die
Livebild-Manipulation, sowie für Objekterkennung und
Objektverfolgung enthält. Über 2000 verschiedene, optimierte
Algorithmen sind inzwischen verfügbar. Geschrieben wurde OpenCV in C
und C++, aber es gibt auch eine Schnittstelle zu Python, welche die
Programmierung besonders einfach und übersichtlich macht. Ein
Abstecher auf die OpenCV-Projektseite lohnt sich auf jeden Fall.
Auch auf YouTube findet man Beispielvideos, welche die
Möglichkeiten von OpenCV eindrucksvoll demonstrieren [2].
Vorbereitung
Zunächst muss man das Peket python-opencv über die Paketverwaltung installieren.
Eigene Versuche haben gezeigt, dass es bei Version 2.0 des
OpenCV-Moduls, das noch in den Paketquellen von Ubuntu 10.04 LTS
enthalten ist, zu einem Fehler beim Import des cv-Moduls kommt
(„ImportError: No module named cv“). Eine Lösung des Problems ist in
der OpenCV-Installationsanleitung beschrieben [3].
Ab Ubuntu 10.10 gibt es keine Probleme mehr.
Livebild am Bildschirm anzeigen
Das folgende kleine Programm öffnet ein Fenster am Bildschirm und
gibt das aktuelle Livebild aus. Durch Drücken der Taste „Q“ wird
das Programm wieder beendet.
#! /usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Livebild ausgeben
# Autor: Wolfgang Wagner
# Datum: 18.05.2011
import cv
KAMERA_NR = 0
cam = cv.CaptureFromCAM(KAMERA_NR)
taste = 0
while taste <> ord("q"):
bild = cv.QueryFrame(cam)
cv.ShowImage("Livebild", bild)
taste = cv.WaitKey(2)
Listing: webcam.py
Das Programm beginnt mit dem Import des OpenCV-Moduls in der Zeile
import cv. Danach erfolgt die Initialisierung der Webcam mit
cam = cv.CaptureFromCAM(KAMERA_NR). Als nächstes kommt eine Schleife,
die solange durchlaufen wird, bis die Variable taste den Code des
Zeichens q enthält. Mit bild = cv.QueryFrame(cam) holt man den
aktuellen Frame (das aktuelle Bild) aus dem Videostream und mit
cv.ShowImage("Livebild", bild) gibt man dieses Bild in einem
eigenen Fenster aus. Mit taste = cv.WaitKey(2) % 256 wird
zwei
Millisekunden gewartet und dann das untere Byte des zurückgegebenen
Codes an die Variable taste übergeben. Die zwei Millisekunden
Wartezeit sind notwendig, um eine Aktualisierung der
Bildschirmausgabe zu ermöglichen.
Videoüberwachung
Das erste Programmbeispiel soll nun zu einer einfachen
Videoüberwachung ausgebaut werden. Dazu wandert die Hauptroutine
des Programms in eine eigene Funktion. Hinzu kommen noch eine
Funktion für die Generierung eines Dateinamens (um das aufgenommene
Video abspeichern zu können) und eine Funktion für die Auswertung
von Parametern, die dem Programm beim Start eventuell mitgegeben
worden sind.
Imports
Am Programmanfang werden zusätzlich zum Modul cv noch die Funktion
localtime für die Abfrage von Datum und Uhrzeit und die Funktion
argv für das Auslesen der Programmparameter importiert:
import cv
from time import localtime
from sys import argv
Funktion Dateiname
Durch den Aufruf der Funktion localtime erhält man die aktuelle
Uhrzeit. Aus den ersten sechs Elementen des zurückgegebenen Tupels wird
dann der Ausgabestring zusammengesetzt:
- Jahr [4-stellig]
- Monat [1..12]
- Tag [1..31]
- Stunde [0..31]
- Minute [0..59]
- Sekunde [0..61]
- Wochentag [0..6, 0=Montag]
- Tag des Jahres [1..366]
- Status der Sommerzeit [0,1,-1]
def Dateiname():
'''Erstellt einen Dateinamen aus Datum und Uhrzeit'''
zeit = localtime()
s = "%04i-%02i-%02i-%02i-%02i-%02i.avi" % \
(zeit[0],zeit[1],zeit[2],zeit[3],zeit[4],zeit[5])
return s
Listing: dateiname.py
Funktion ParameterLesen
Die Funktion ParameterLesen wertet die beim Programmstart
mitgegebenen Parameter aus. Als Ergebnis gibt sie ein Dictionary
zurück, das die einzelnen Programmparameter enthält. Wurden keine
Parameter angegeben, enthält das Dictionary die voreingestellten
Werte. Bei einer Falscheingabe wird ein Infotext ausgegeben und die
Funktion liefert 0 zurück. Eine Prüfung der eingegebenen Werte
findet nicht statt. Man könnte beispielsweise einen ungültigen Pfad
eingeben oder auch einen Text, wenn eine Zahl erwartet wird und
würde damit das Programm zu Absturz bringen. Hier wäre also noch
Platz für Verbesserungen. Zum Testen des Programms dürfte diese
einfache Routine aber ausreichend sein.
def ParameterLesen():
'''Wertet die eingegebenen Parameter aus'''
INFOTEXT = """Falsche Parametereingabe
Aufruf: Videoueberwachung.py [OPTION] <WERT> [OPTION] <WERT>...
Moegliche Optionen:"
-p Ausgabepfad (Vorgabe: ./)
-knr Nummer der Kamera, die erste gefundene Kamera hat die Nummer 0
(Vorgabe: 0)
-ts Schwellwert der Threshold-Funktion (gueltig: 0 bis 255, Vorgabe: 50)
-tm Maximalwert der Threshold-Funktion (gueltig: 0 bis 255, Vorgabe: 255)
-start Durchschnittlicher Pixelwert, bei dem die Aufnahme startet
(gueltig: 0.0 bis 255.0, Vorgabe: 0.1
-stop Durchschnittlicher Pixelwert, bei dem die Aufnahme gestoppt wird
(gueltig: 0.0 bis 255.0, Vorgabe: 0.01
-bbs Bilder bis Stop: Wird bbs Bilder lang keine Bewegung mehr fest-
gestellt, stoppt die Aufnahme (gueltig: 1 bis n, Vorgabe: 40)
"""
VORGABE = {'-p' : "./", '-knr' : "0",'-ts' : "50", \
'-tm' : "255",'-start' : "0.1", '-stop' : "0.01", \
'-bbs' : "40"}
Parameter = VORGABE.copy()
if len(argv)>2:
for i in xrange(1,len(argv)-1,2):
if Parameter.has_key(argv[i]):
Parameter[argv[i]] = argv[i+1]
else:
print INFOTEXT
return 0
return Parameter
else:
return VORGABE
Listing: parameterlesen.py
Zu erwähnen wäre hier der Aufruf Parameter = VORGABE.copy(), mit
dem vom Vorgabe-Dictionary eine Kopie erstellt wird. Die einfache
Zuweisung Parameter = VORGABE ist hier nicht möglich, denn sie
erzeugt nur eine Kopie des Zeigers auf die Daten und nicht eine
Kopie der Daten selbst. Änderungen an der Kopie hätten auch eine
Änderung am Original zur Folge.
Ausgewertet wird die Variable argv, in der nach dem Programmstart
alle Eingabeparameter
aufgelistet sind. Als erstes Element ist
immer der Programmname abgelegt, deshalb beginnt die Auswertung
erst beim zweiten Element.
Funktion Überwachung
Die eigentliche Aufnahme und Auswertung von Bildern der Kamera erfolgt
in der Datei ueberwachung.py.
Nach der Initialisierung der Kamera wird die Bildgröße des
empfangenen Videobildes ermittelt. Die erhaltene Bildgröße ist
notwendig, um die Ziele für die im weiteren Programmverlauf
notwendigen Bilder zu erstellen. OpenCV-Bilder werden nämlich in
einer speziellen Datenstruktur (genannt IPL-Image) gespeichert, die
aus einem Datenkopf und einem Array für die Speicherung der
Bildpunkte besteht. Alle später verwendeten Variablen, die zum
Speichern von Bildern dienen, müssen zuerst mit dem Befehl
CreateImage erzeugt werden.
Im weiteren Verlauf des Programms werden drei Bilder gebraucht:
- bildneu: für die Speicherung des neuen Frames
- bildalt: für die Speicherung des vorhergehenden Frames
- diffbild: für die Speicherung des Differenzbildes
def Ueberwachung(Pfad,KameraNr,ThresholdSchwelle,ThresholdMax, \
PixSchnittStart,PixSchnittStop,BilderBisStop):
cam = cv.CaptureFromCAM(KameraNr)
size = (int(cv.GetCaptureProperty(cam, cv.CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH)), \
int(cv.GetCaptureProperty(cam, cv.CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)))
bildneu = cv.CreateImage(size, cv.IPL_DEPTH_8U, 3)
bildalt = cv.CreateImage(size, cv.IPL_DEPTH_8U, 3)
diffbild = cv.CreateImage(size, cv.IPL_DEPTH_8U, 3)
AufnahmeAktiv = False
taste = 0
while taste <> ord("q"):
bild = cv.QueryFrame(cam)
cv.Dilate(bild, bildneu, None, 1)
cv.AbsDiff(bildalt, bildneu, diffbild)
cv.Threshold(diffbild, diffbild, ThresholdSchwelle, \
ThresholdMax,cv.CV_THRESH_BINARY)
schnitt = 0.0
for s in cv.Avg(diffbild):
schnitt += s
if not AufnahmeAktiv:
if schnitt > PixSchnittStart:
AufnahmeAktiv = True
BildZahl = 0
writer = cv.CreateVideoWriter(Pfad+Dateiname(), \
cv.CV_FOURCC('P','I','M','1'),24,size)
cv.WriteFrame(writer, bild)
else:
cv.WriteFrame(writer, bild)
if schnitt < PixSchnittStop:
BildZahl += 1
if BildZahl > BilderBisStop:
AufnahmeAktiv = False
else:
BildZahl = 0
cv.ShowImage("Livebild", bild)
cv.Copy(bildneu, bildalt)
taste = cv.WaitKey(1) cv.DestroyAllWindows()
Listing: ueberwachung.py
Danach beginnt die Hauptschleife der Funktion, die, wie schon im
ersten Beispiel, solange durchlaufen wird, bis die Betätigung der
Taste „Q“ sie beendet.
Um festzustellen, ob sich etwas im Videobild geändert hat, muss der
aktuelle Frame vom vorhergehenden Frame abgezogen werden. Übrig
bleibt ein Differenzbild, auf dem nur die geänderten Bereiche zu
sehen sind. Die gleich gebliebenen Bereiche sind im Differenzbild
schwarz. Die Sache hat nur einen Haken: Das Videobild, das von der
Webcam kommt, rauscht. Auch, wenn sich im Bild absolut nichts
bewegt, zeigt das Differenzbild eine Veränderung an. Um das
Rauschen zu kompensieren, muss man deshalb das Videobild vor der
Weiterverarbeitung mit der Dilate-Funktion glätten. Das Ergebnis
zieht man anschließend mithilfe der AbsDiff-Funktion vom
vorhergehenden Bild ab und erhält dadurch ein Differenzbild. Die
Threshold-Funktion verstärkt den Kontrast im Differenzbild noch
zusätzlich. Entscheidenden Einfluss haben dabei der Schwellwert-
und der Maximalwertparameter. Diese können deshalb auch als
Programmparameter angegeben werden.
Als nächstes gilt es nun, einen Wert zu ermitteln, der die
Veränderung im Bild quantifiziert. Das geschieht, indem man einen
durchschnittlichen Pixelwert des gesamten Differenzbildes
berechnet. Ein hoher Durchschnittswert bedeutet viel Bewegung im
Bild, ein Durchschnittswert von 0 bedeutet keine Bewegung. Mit der
Schleife
for s in cv.Avg(diffbild):
schnitt += s
werden die Durchschnitte aller Farbkanäle in der Variablen schnitt
aufsummiert. Läuft die Aufnahme noch nicht und überschreitet der
Wert von schnitt die festgelegte Startschwelle
(PixSchnittStart), dann wird die Aufnahme gestartet.
Ist die Aufnahme bereits aktiv und der Wert von schnitt
unterschreitet die Stoppschwelle
(PixSchnittStop) eine bestimmte
Anzahl von Bildern lang (BilderBisStop), dann wird die Aufnahme
gestoppt. Der voreingestellte Wert für BilderBisStop ist 40, d. h.
wenn sich 40 Bilder lang nichts bewegt, wird die Aufnahme gestoppt.
Die Anzahl der Bilder, sowie die Start- und Stoppschwelle können
als Programmparameter eingegeben werden. Sollte die Aufnahme zu
früh starten oder gar nicht mehr stoppen, müssen die Werte etwas
angepasst werden.
Der Aufruf der Funktion CreateVideoWriter öffnet eine Datei
zum Schreiben der Video-Frames, die Funktion WriteFrame
dient zum Schreiben der einzelnen Frames in die Datei.
Hauptprogramm
Das Hauptprogramm besteht nur noch aus dem Aufruf der Funktion
ParameterLesen und, falls diese korrekt beendet wurde, dem Aufruf
der Überwachungsfunktion.
if __name__ == "__main__":
Parameter = ParameterLesen()
if Parameter != 0:
Ueberwachung(Parameter['-p'], \
int(Parameter['-knr']), \
int(Parameter['-ts']), \
int(Parameter['-tm']), \
float(Parameter['-start']), \
float(Parameter['-stop']), \
int(Parameter['-bbs']))
Listing: main.py
Das komplette Programm kann direkt heruntergeladen werden:
videoueberwachung.py.
Starten des Programms
Der Aufruf für das Skript lautet:
$ ./videoueberwachung.py [OPTION] <WERT> [OPTION] <WERT> ...
Das Skript muss vorher ggf. vorher noch ausführbar gemacht werden.
Nach dem Start wird das Livebild in einem Fenster angezeigt.
Interessant ist es auch, statt
dem Livebild das Differenzbild im
Ausgabefenster anzeigen zu lassen (oder auch beide Bilder). Man
kann dann gut beobachten, wie sich abgeänderte Funktionsparametern
der Threshold-Funktion auf das Differenzbild auswirken.
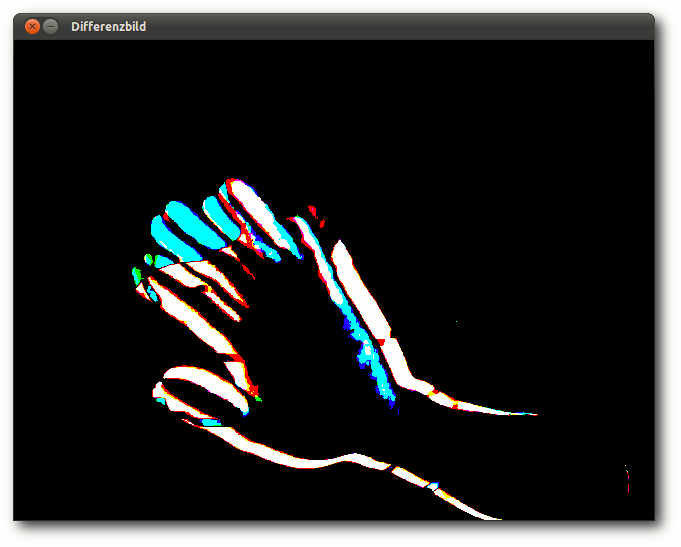
Differenzbild einer bewegten Hand.
Die Bildberechnungen der OpenCV-Funktionen laufen ziemlich schnell
ab. Trotzdem kann es vorkommen, dass langsamere Computer die
Abarbeitung der Programmschleife nicht 24 Mal
in der Sekunde
schaffen. Die aufgenommenen Videos laufen dann beim Abspielen etwas
zu schnell. Das sollte aber nicht weiter stören. Ziel ist ja das
Kennenlernen der OpenCV-Funktionen und nicht die Programmierung
einer professionellen Videoanwendung. Zum Entlarven eines
Süßigkeitendiebs in der heimischen Vorratskammer reicht das
Programm auf jeden Fall.
Alle benutzten OpenCV-Datenstrukturen und Funktionen kann man in diesem
OpenDocument nachlesen: OpenCVFunktionen.odt.
Links
[1] http://opencv.willowgarage.com/
[2] http://www.youtube.com/watch?v=V7UdYzCMKvw
[3] http://opencv.willowgarage.com/wiki/InstallGuide : Debian
| Autoreninformation |
| Wolfgang Wagner
ist Maschinenbauingenieur und Freizeitprogrammierer.
Er hat 2008 zum ersten Mal Ubuntu auf einem Computer installiert
und verwendet seitdem nur noch Freie Software. Mit Python
beschäftigt er sich seit zwei Jahren.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Es heißt, aller guten Dinge sind drei.
Und ob nun
die Dreifaltigkeit, die Heiligen Drei Könige oder die drei kleinen
Schweinchen, Drei kommt gut. Das hat sich wohl auch das
Entwicklerstudio Frozenbyte [1] gedacht, als sie
das Spiel Trine [2] (gesprochen wie „3n“)
entwickelten.
Charaktervorstellung
In Trine übernimmt man nicht eine, sondern gleich drei Rollen. Durch
einen Zauber werden die Diebin Zoya, der Zauberer Amadeus und der
Ritter Pontius zu einer Person verschmolzen, als sie den Stein namens
Trine zusammen anfassen. Erst wenn sie die anderen beiden Zaubersteine
im Königreich gefunden haben, können sie wieder getrennt existieren.
Natürlich ist dies nicht so einfach, wie es klingt, denn das Königreich
wird von einer dunklen Macht überschattet und überall treiben Skelette
ihr Unwesen. Nur mit vereinten Kräften aller drei Charaktere kann
man sich selbst heilen und das Königreich retten.
Zoya hat den Fernkampf auf ihrer Seite. Mit dem Bogen kann sie weit
entfernte Gegner angreifen, ohne sich selbst in direkte Gefahr zu
begeben. Anfangs fliegen die Pfeile noch sehr gemächlich durch die
Landschaft, später kann sich aber die Schussgeschwindigkeit erhöhen
und sogar Feuerpfeile sind dann mit im Programm. Als zweite Eigenschaft
besitzt Zoya einen Enterhaken, den sie in allem, was hölzern ist,
verankern kann, um dann über giftige Sümpfe oder tiefe Abgründe zu
schwingen. Mit etwas Übung ist es so auch möglich, auf Balken zu
springen, um höher gelegene Gebiete (und geheime Truhen) zu erreichen.
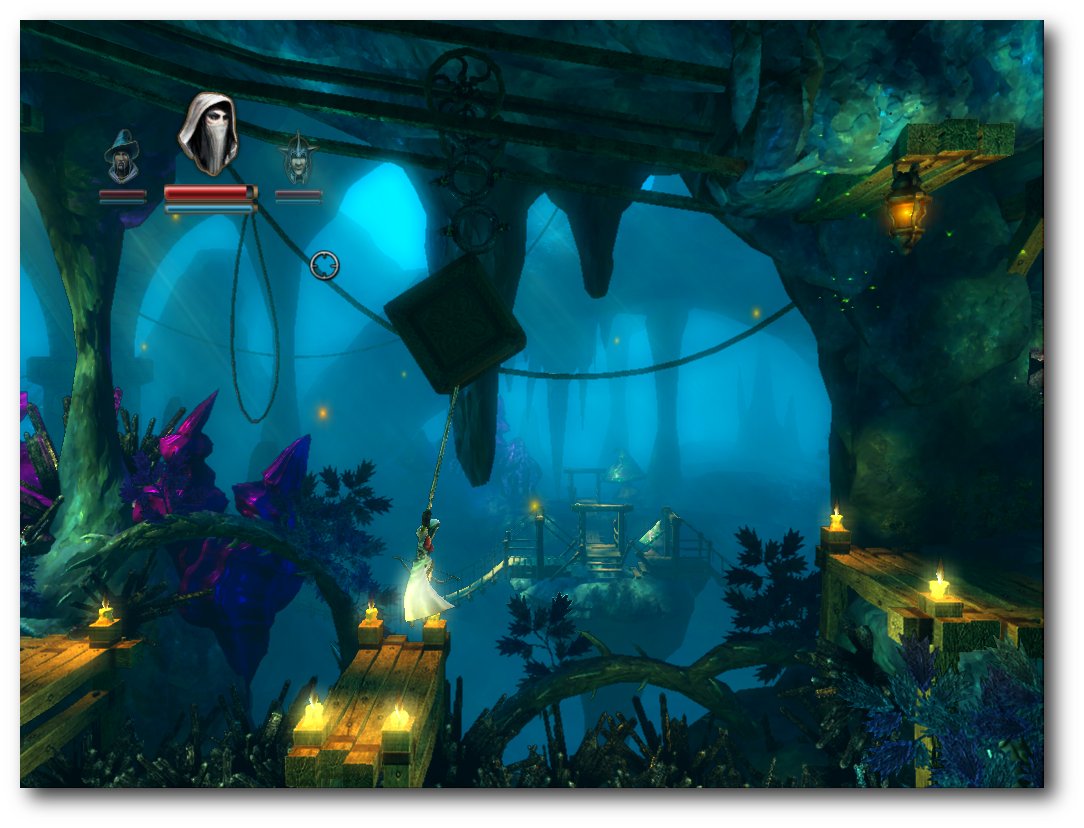
Einfach nur 'rumhängen.
Amadeus hat es ebenfalls nicht so mit Nahkampf bzw. mit Kämpfen im
Allgemeinen, da er keinerlei direkte Angriffsmöglichkeit besitzt.
Seine Stärke liegt dagegen in der Zauberei, sodass er Kisten und
Leitern/Brücken herbeizaubern kann. Deren Anzahl ist anfangs noch
reduziert, erhöht sich aber auch im Laufe des Spiels. Als Clou ist
es später sogar möglich, eine schwebende Plattform zu erzeugen.
Telekinese ist eine weitere Eigenschaft Amadeus', das heißt, er kann
Kisten, Steine und andere Gegenstände durch die Gegend schweben
lassen, so auch die selbsterstellten Kisten, Leitern/Brücken und
die schwebende Plattform. Wieso Amadeus aber nicht die Möglichkeit hat,
Gegner oder die wichtigen Gesundheits- oder Erfahrungsphiolen
schweben zu lassen, wird leider nicht erklärt. Zauberei halt!
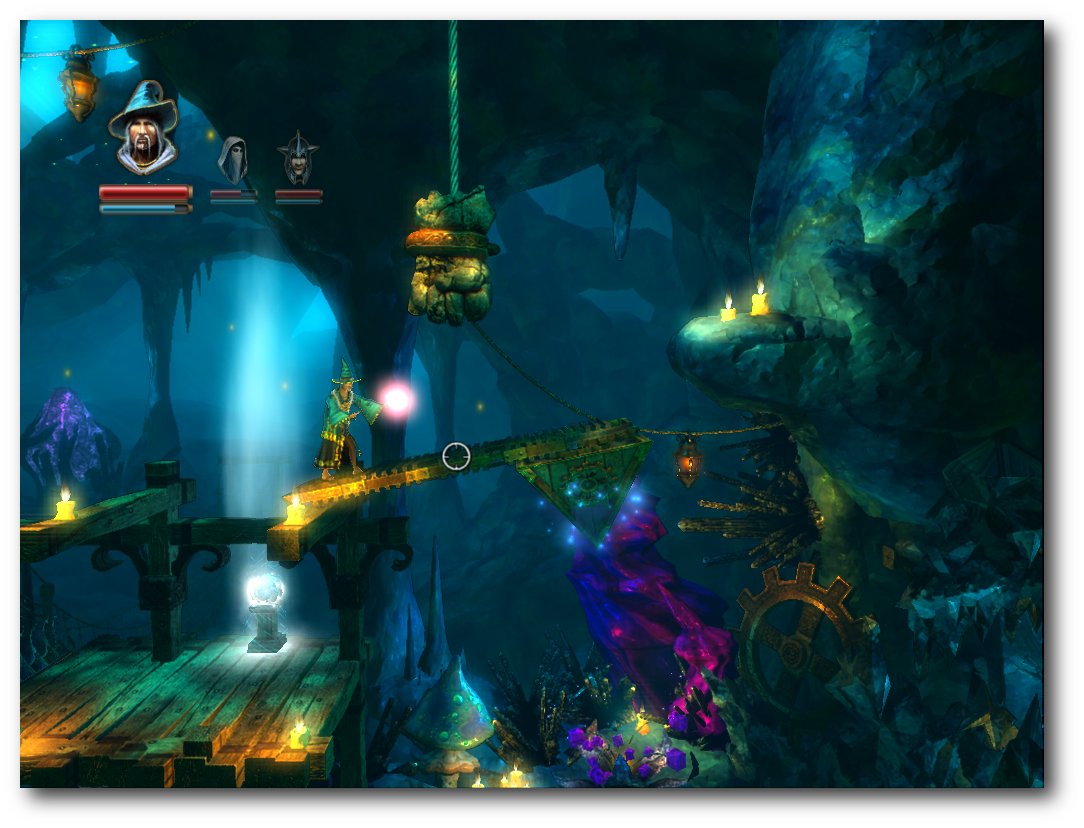
Der Zauberer kann Leitern herbeizaubern.
Zu guter Letzt findet sich noch der Ritter Pontius in dem Dreigespann,
der vor allem mit schlagkräftigen Argumenten überzeugen kann. Mit
(Flammen)Schwert oder Hammer ausgerüstet macht er jeden Gegner im
Nahkampf
platt. Sein Schild schützt darüber hinaus vor gegnerischen
Angriffen. Aber auch Pontius' Stärke ist an einigen Stellen wichtig,
um zum Ziel zu gelangen. So kann der Ritter Steine und Kisten aufheben
und diese entweder gegen die Umgebung oder Gegner schleudern.
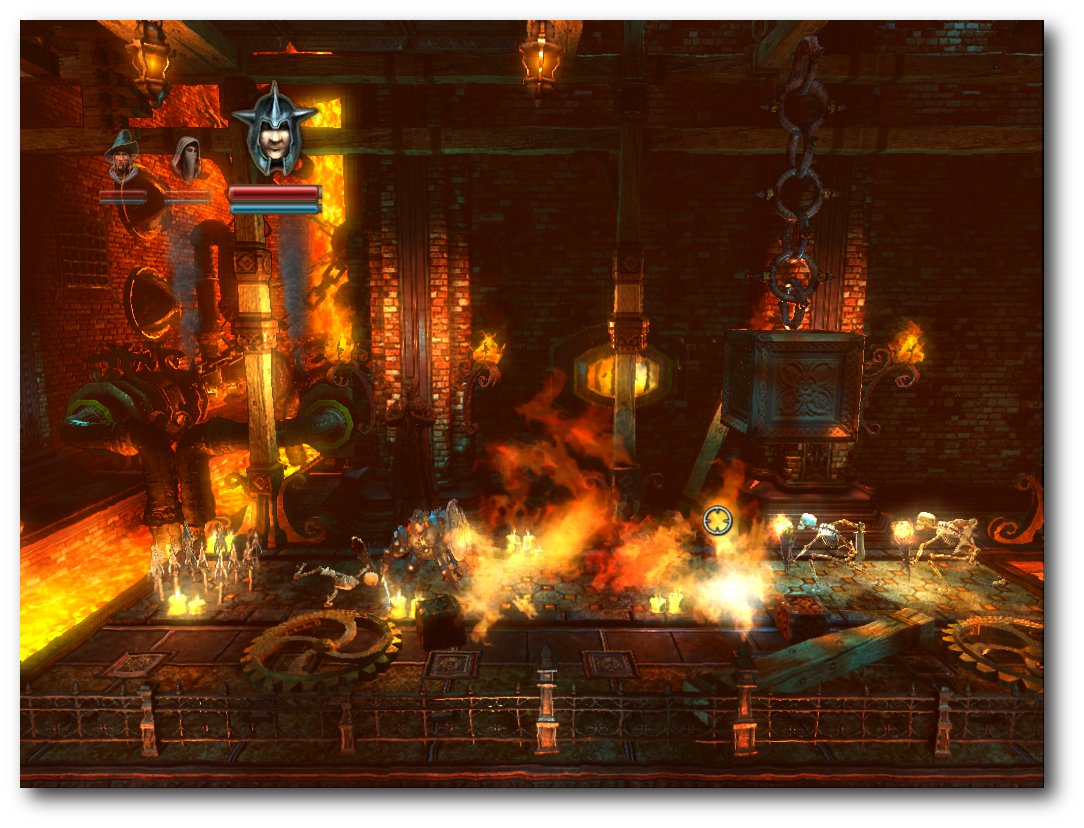
Feuer wird mit Feuer(schwert) bekämpft.
Spielerisch unterscheiden sich die drei Charaktere extrem, was den
Reiz von Trine ausmacht. Es ist zwar oft möglich, nur mit einer Person
im Alleingang zum Ende eines Levels zu gelangen, aber gerade das
Zusammenspiel ist wichtig, um versteckte Gebiete zu erreichen.
Einige Rätsel lassen sich dagegen tatsächlich nur in Zusammenarbeit
aller drei Charaktere lösen. Im Testspiel hat sich vor allem
die Diebin als wichtigster Charakter bewährt. Der Ritter kam
wirklich nur bei direkten Kämpfen zum Einsatz, der Zauberer nur
dann, wenn eine Kiste oder Leiter erforderlich war. Das ist aber
sicherlich Geschmackssache und wird nicht bei allen Spielern gleich
sein.
Der Tod ist nicht das Ende
Während man sich also auf der Landkarte durch das Königreich und
von Level zu Level spielt, wird man einige Male sterben. Ein
Gesundheitsbalken zeigt an, wie gut es mit der Gesundheit eines
Charakters steht. Durch das Einsammeln von roten Gesundheitsphiolen,
die besiegte Gegner hinterlassen, kann man den Balken wieder
auffrischen. Aber auch das Erreichen von Checkpoints in einem Level
frischt die Gesundheit wieder auf.
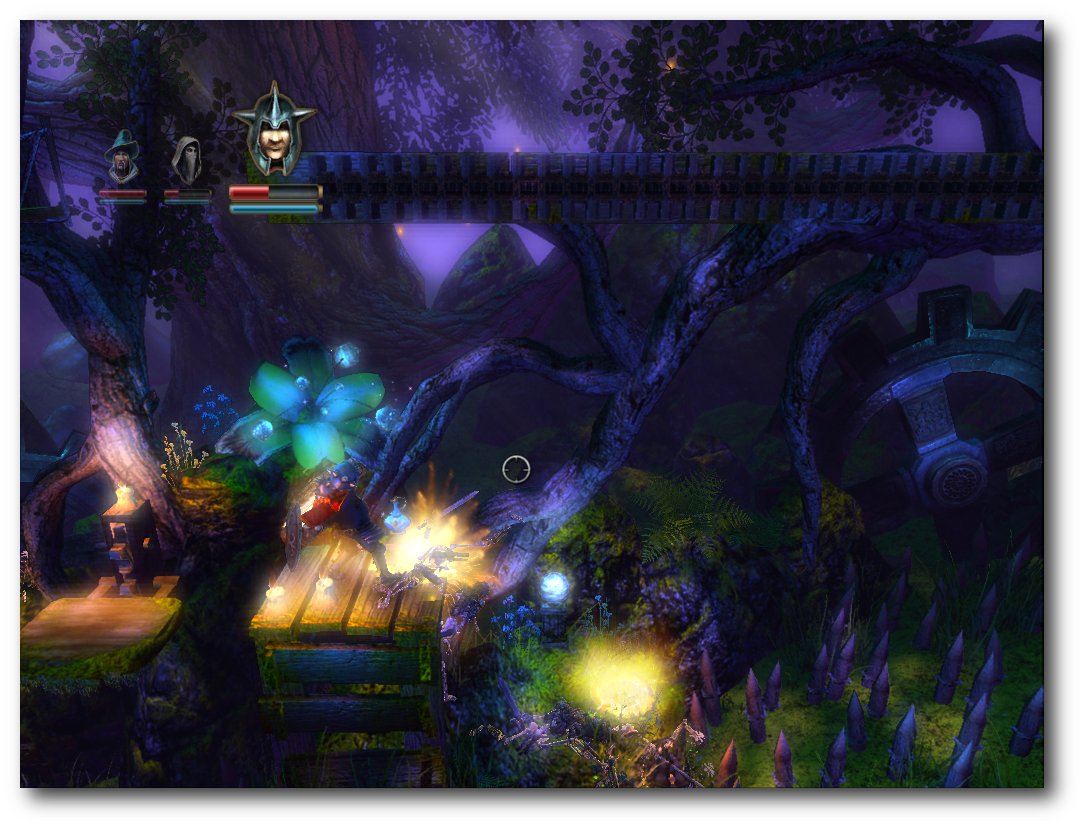
Auch Skelette machen den Wald unsicher.
Aber selbst wenn man einmal den Heldentod stirbt, ist dies nicht das
Ende, denn es „stirbt“ nur die eine Person, deren Gesundheit auf
Null gesunken ist. Das heißt, man hat immer noch zwei andere Charaktere
zur Verfügung. Selbst wenn alle drei Charaktere sterben, muss man
nur das Level von vorne beginnen bzw. vom letzten Checkpoint aus
starten. Da die Checkpoints (repräsentiert durch leuchtende Kugeln
auf einem Podest) meist recht zahlreich und fair im Level verteilt
sind, ist dies also kein Beinbruch und man ist nach einem Tod nicht
frustriert.
Neben dem Gesundheitsbalken gibt es auch noch eine Energieleiste,
welche für die Spezialfähigkeiten der Charaktere wichtig ist. Für
Amadeus bedeutet das, dass jeder Zauberspruch Energie kostet. Die
Diebin Zoya verliert Energie, wenn sie Feuerpfeile abschießt, und
Pontius' Balken sinkt ab, wenn er schwere Gegenstände durch die
Gegend schleppt und wirft. Ebenso wie die Gesundheit lässt sich der
Energiebalken durch von Gegner fallengelassene Energiephiolen wieder
auffrischen.
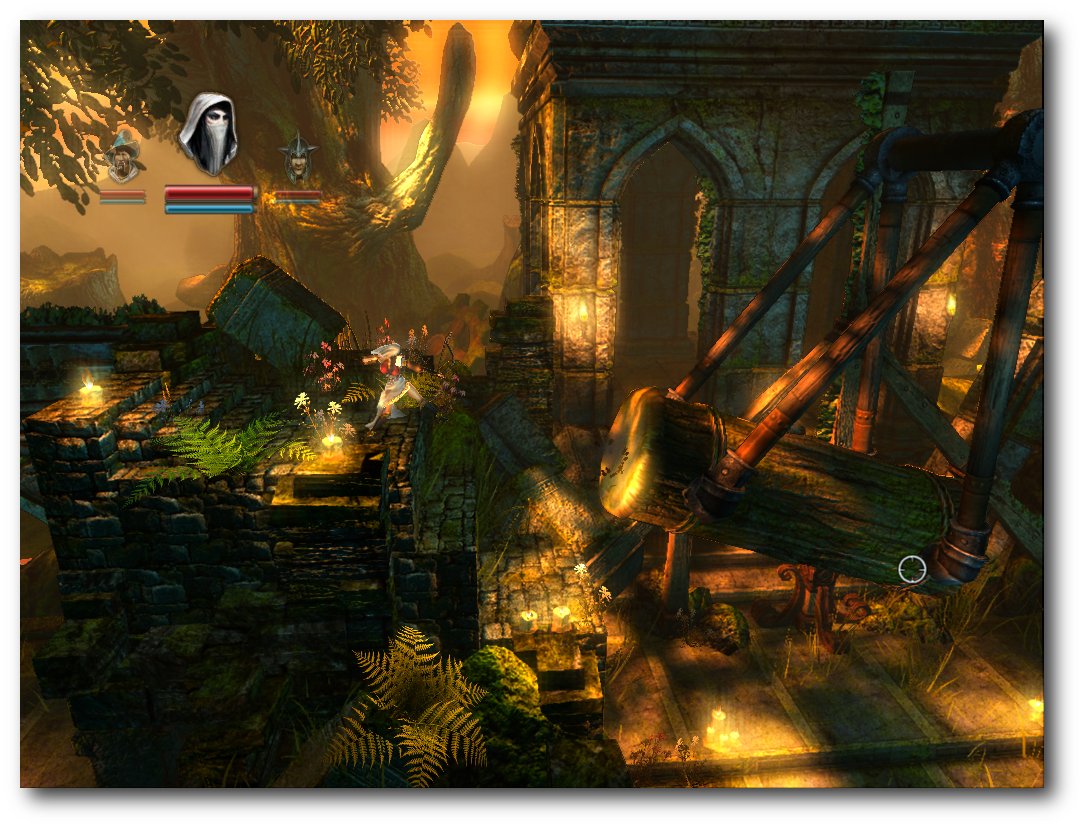
Mit Pfeilen kann man diese Schaukel in Bewegung versetzen.
Rollenspiel trifft Physikpuzzle
Es gibt noch eine weitere Art von Phiolen, die für die Erfahrung
der drei Charaktere wichtig ist. Zum einen lassen Gegner solche grünen
Erfahrungsphiolen fallen, zum anderen sind aber auch zahlreiche Fläschchen im Spiel
verstreut, die an mehr oder weniger zugänglichen Orten eingesammelt
werden können. Jede fünfzigste eingesammelte Phiole sorgt für einen
Stufenaufstieg. Über diesen kann man dann pro Charakter eine der
drei Fähigkeiten aufwerten. Beim Zauberer sind das z. B. die Anzahl
der Kisten und Leitern, die dieser erstellen kann, bei der Diebin
die Schussgeschwindigkeit und so weiter.
Aber nicht nur diese Funktionalität erinnert an ein Rollenspiel, nein,
in jedem Level gibt es auch versteckte Truhen, die besondere
Gegenstände enthalten. So findet man Schutzamulette, einen Hammer für
Pontius oder einen Taucheranzug, mit dem man ewig unter Wasser
bleiben kann. Die Truhen sind dabei nicht wirklich versteckt, es
erfordert aber manchmal einiges an Geschick, um sie zu erreichen.

In der Übersicht sieht man Fähigkeiten und Gegenstände der Charaktere.
Das war es aber auch schon, was Trine mit einem Rollenspiel gemeinsam
hat, im Vordergrund stehen natürlich die verschiedenen Puzzles und
Rätsel, um an das Ende eines Levels zu gelangen. Manchmal muss man
irgendwo einen oder
mehrere Knöpfe drücken oder Hebel umlegen, in
der Regel „kämpft“ man aber nur gegen die Spielumgebung. Das heißt,
der Weg ist das Ziel, denn es macht riesigen Spaß, Kisten durch die
Gegend schweben zu lassen, riesige Schaukeln zu bewegen oder sich
einfach nur mit dem Enterhaken von Plattform zu Plattform zu schwingen.
Dass Trine „nur“ ein (hübsch verpacktes) Physikspiel mit
Rollenspielelementen ist, merkt man aber auch an der erzählten
Geschichte. Auch wenn der Erzähler im Stile eines Geschichtenonkels
die Story während des Ladebildschirms vorantreibt, wirkt die
Geschichte um das zerfallene Königreich doch arg aufgesetzt. Vor
allem am Ende werden einige Story-Elemente nicht aufgeklärt. So fühlt
sich Zoya im Spiel bei den Leveln im Wald und den Ruinen zu diesen
irgendwie hingezogen und am Ende, nachdem das Königreich vom Bösen
befreit ist, erhält sie als Belohnung die Herrschaft über den
Wald. Aber das war's, was zu dem Thema gesagt wurde. Es gibt
keinerlei Begründung, die Zoyas Gefühle erklären könnte, doch gerade
das wäre spannend zu erfahren gewesen.

Einer der abwechslungsreicheren Zwischengegner.
Blasse Charaktere, aber schönes Design
Insgesamt bleiben die Charaktere leider ziemlich blass und das Spiel
verkauft dieses Element weit unter Wert. Selbst die Namen kommen im
Spiel nicht direkt vor (soweit ich mich erinnere), sondern es wird
immer nur von der Diebin, dem Zauberer und dem Ritter gesprochen.
Die obigen Namen sind dem Frozenbyte-Forum [3]
entnommen.
Was auch störend ist, ist die (nicht vorhandene) Interaktion
zwischen den drei Personen. Da sind diese schon für einige Zeit in
einem Körper gefangen und können irgendwie auch miteinander
kommunizieren, aber leider schweigen sich die drei einen Großteil
des Spiels nur an. Einzig am Anfang eines Levels verliert der ein
oder andere Charakter mal einen Satz zur aktuellen Situation und
erhält mit viel Glück sogar eine Antwort. Hier verspielt Frozenbyte
sehr viel Potential, denn die Situation, dass drei höchst
unterschiedliche Charaktere in einem Körper gefangen sind, hätte
für sehr lustige oder spannende Dialoge sorgen können.
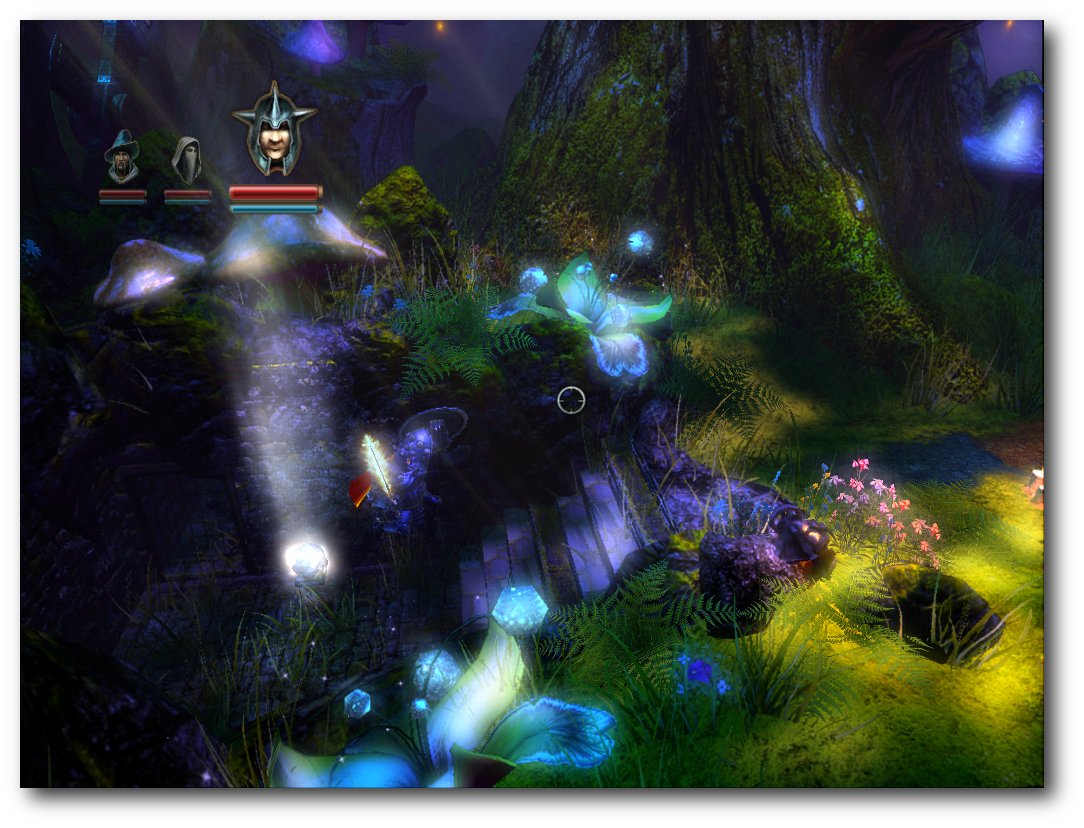
Der Fangore-Wald ist sehr idyllisch – anfangs.
Viel Potential wird auch bei der Gestaltung der Welt verschenkt.
Wobei dies nicht ganz korrekt ist, da das Design und der Stil jedes
Levels extrem detailreich und wunderschön anzusehen ist. Trine
zeigt, dass 3D in der heutigen Zeit nicht alles ist und kann so
mit einer sehr phantasievoll gestalteten Welt einigen der „tollen“
First-Person-Shooter von heute locker den Rang ablaufen.
Leider haben die Designer aber vergessen, die Welt mit Leben zu
füllen. NPCs (nicht spielbare Charaktere) gibt es gar nicht und
auch die Variation der Gegner hält sich doch arg in Grenzen. Im
Grunde gibt es nur Skelette zu bekämpfen. Klar haben diese mal ein
Schwert oder einen Bogen in der Hand oder können an anderer Stelle
Feuer spucken, aber es bleiben nun einmal nur Skelette. Zu den
weiteren Standardgegnern gehören noch kleine Fledermäuse und
Spinnen. Das war's! Es verwundert nicht, dass sich so nach einiger
Zeit etwas Monotonie bei den Kämpfen einstellt, die
glücklicherweise durch die Level-Gestaltung wieder herausgerissen
wird. Die Kämpfe wirken also nur wie eine lästige Mücke,
die bei einer tollen Gartenparty ständig um einen herumschwirrt.

Dieser nette Bursche wartet am Ende auf den Spieler.
Vor allem bei dem sehr bunten Wald-Leveln hätte man eine größere
Gegnervielfalt anbringen können. Da es sich um ein Phantasiespiel
handelt, wären auch blutrünstige Schmetterlinge oder giftspuckende,
hüpfende Pilze akzeptabel.
Noch etwas Technik
Trine wurde bereits 2009 für Windows und das PlayStation-Network
veröffentlicht und heimste
reihenweise gute Bewertungen
ein. Im April 2011 kam das Spiel noch einmal durch das Humble
Frozenbyte Bundle [4] ins Gespräch, bei
der u. a. die Frozenbyte-Spiele Trine, Shadowgrounds und (das bald erhältliche) Splot zum
selbstgewählten Preis erstanden werden konnten.
Leider gibt es derzeit (Mitte Mai 2011) keine Möglichkeit, das Spiel
eigenständig für Linux zu kaufen, da Frozenbyte erst noch die richtigen
Vertriebswege in Erfahrungen bringen will [5].
Da das Humble Frozenbyte Bundle auch schon länger beendet ist, muss
sich also jeder Linux- und Mac-Nutzer noch etwas gedulden oder auf
die Windows-Version zurückgreifen.

Die schwebende Plattform ist hilfreich.
Fazit
Trine ist ein sehr kurzweiliges Physikspiel mit Rollenspielelementen.
Die phantasievolle Welt ist extrem schön gestaltet, leidet aber an
der fehlenden Gegnervielfalt. Da das Spiel aber auch nicht als
Actionspiel verkauft wird, wird dies von der Zielgruppe sicher zu
verschmerzen sein. Ein Kauf lohnt sich definitiv – auch für Casual
Gamer. Für den Preis erhält man circa sechs bis zehn Stunden Spielspaß.
Trine 2 [6] soll im übrigen noch dieses Jahr
erscheinen.
Links
[1] http://frozenbyte.com/
[2] http://trine-thegame.com/
[3] http://frozenbyte.com/board/
[4] http://www.humblebundle.com/
[5] http://frozenbyte.com/board/viewtopic.php?f=15&t=2484&start=25#p13710
[6] http://trine2.com/
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
spielt gerne und freut sich über jedes Spiel,
welches nativ unter Linux läuft.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
Der Buchtitel „Sieben Sprachen in sieben Wochen“ hört sich erst
einmal nach der kleinen Sprachfibel für den polyglotten
Weltreisenden an. Nach dem Lesen des Untertitels „A Pragmatic Guide
to Learn Programming Languages“ (Übersetzt: „Eine pragmatische
Einführung zum Erlernen von Programmiersprachen“) wird jedoch klar,
dass es sich um IT-Literatur zum Thema Programmierung bzw.
Programmiersprachen handelt.
Lerne zu lernen
Es ist schlichtweg nicht möglich, sieben Programmiersprachen in nur
sieben Wochen zu lernen. Das ist aber auch gar nicht das Anliegen
des Buchs. Der Titel hat vielmehr den Charakter eines Aufmachers,
um Interesse zu wecken. Denn: Interessant ist das Buch, das Konzept
des Aufbaus und die Didaktik. Ziel des Buches ist es nämlich, dem
Leser einen Einblick in verschiedene Programmierparadigmen zu
geben. Dies geschieht anhand von Ruby (objektorientiert), Io
(prototypen-basiert), Prolog (Logik-basiert), Haskell (funktional)
sowie Scala, Erlang und Clojure (Mischformen aus mindestens zwei
der zuvor genannten Paradigmen).
Das wird auch relativ schnell beim Lesen des ersten Kapitels klar.
Hier stellt der Autor, Bru ce A. Tate, selber erfahrener
Programmierer und aktiver Softwareentwickler, vor, was das Anliegen
des Buchs ist, warum gerade diese sieben Programmiersprachen
gewählt wurden, für wen das Buch interessant sein könnte und –
recht unüblich – wer das Buch auf keinen Fall kaufen sollte. Den
Abschluss des ersten Kapitels bilden die aufmunternden Worte „Have
fun!“
Sieben Sprachen in sieben Kapiteln
Die folgenden sieben Kapitel widmen sich dann jeweils einer der
zuvor genannten Programmiersprachen. Die Kapitel sind alle gleich
aufgebaut: Es wird eine kurze Einführung die Geschichte der
Programmiersprache gegeben, bevor dann die drei eigentlichen
Unterkapitel zur Programmierung folgen. Am Ende jedes Kapitels gibt
der Autor Tipps für das Selbststudium und macht auch Vorschläge für
Aufgaben, die der Leser selbstständig lösen kann. Eine Lösung
liefert der Autor selber nicht, aber es wird verschiedentlich
darauf hingewiesen, dass man die Lösung mit Hilfe des Internets und
einer Suchmaschine seiner Wahl durchaus finden kann, sofern man die
Aufgabe nicht selber lösen möchte. Den Abschluss eines jeden
Kapitels bildet immer eine Zusammenfassung, welche nochmals
die jeweiligen Stärken aber auch Schwächen der Sprache
zusammenfasst. Jedes der Programmiersprachenkapitel ist rund 40
Seiten lang.
Das neunte und letzte Kapitel liefert eine Zusammenfassung bzw.
einen komprimierten Überblick über alle behandelten Sprachen und
Programmierparadigmen. Auch hier werden die individuellen Stärken,
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale und Schwächen
aufgeführt. Und es wird nochmals auf das Kernanliegen des Buchs
bzw. des Autors eingegangen: Dem Leser verschiedene
Programmierparadigmen näher zu bringen und ihn zu ermuntern, beim
Programmieren über den Tellerrand zu schauen und zu prüfen, ob es
nicht eine Programmiersprache (oder auch ein Programmierparadigma)
gibt, mit dem sich Probleme besser lösen lassen. Ein populäres
Beispiel aus dem Buch wäre z. B. der in Prolog geschriebene
Sudoko-Löser, welcher nur 24 Zeilen Code umfasst.
Mehr als ein Kern
Beim Lesen des Buchs tauchen zwei Worte immer wieder auf, nämlich
funktionale Programmierung und „Concurrency“, auf Deutsch
„Nebenläufigkeit“. Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, sind vier
der sieben Sprachen funktionale Sprachen bzw. enthalten Elemente
der funktionalen Programmierung. Zwar sagt der Autor des Buchs
nicht, dass funktionale Programmierung das kommende
Programmierparadigma ist, aber es wird klar, dass er dies durchaus
für wahrscheinlich hält. Nebenläufigkeit wird nach Ansicht des
Autors immer wichtiger, da Mehrkernprozessoren heutzutage den Stand
der Prozessortechnik in allen Bereichen darstellen und somit der
parallele Zugriff auf Daten immer häufiger vorkommt. Von daher ist
es auch nicht weiter verwunderlich, dass es bei Io, Scala, Erlang,
Clojure und Haskell Beispiele in den jeweiligen Kapiteln gibt, wie
diese Programmiersprachen mit Nebenläufigkeit umgehen und welche
Lösungen sie bieten, um frei von Nebeneffekten zu sein.
Eins wird beim Lesen schnell klar: Es ist kein Lehrbuch. Man bekommt
zwar einen Einblick in sieben verschiedene Programmiersprachen, der
aber keinesfalls umfassend ist. Daraus macht der Autor auch keinen
Hehl. Es werden sehr gut und verständlich die
Stärken der jeweiligen Sprache gezeigt, sodass man für sich selber
entscheiden kann, ob man die Sprache weiter verfolgt bzw. verfolgen
will. Alle Kapitel sind so angelegt, dass man diese einfach nur
lesen kann, ohne die Notwendigkeit, eine oder mehrere der
enthaltenen Aufgaben zu lösen, um die folgenden Unterkapitel zu
verstehen. Interessanterweise ist das Buch aber hierarchisch
aufgebaut, d. h. man sollte die Kapitel zu den verschiedenen
Sprachen schon in der vorgegebenen Reihenfolge lesen, da es immer
wieder Querverweise zu vorhergehenden Kapiteln gibt. Zwar sind diese
nicht essentiell, erleichtern aber das Verständnis deutlich.
Locker, aber nicht für Anfänger
Die Geschwindigkeit, mit der in die Sprachen eingeführt wird, kann
man ohne weiteres als „Renntempo“ bezeichnen. Zwar ist die Kurve
des Anspruchs (Lernkurve wäre hier das falsche Wort) zu Beginn
eines jeden Kapitels noch halbwegs flach, steigt dann aber rasant
und steil an. Wer keinerlei Erfahrung mit Programmierung hat – egal
in welcher Sprache – und vielleicht nur Anfängerkenntnisse besitzt,
der wird dem Inhalt wahrscheinlich schwerlich folgen können.
Der Schreibstil des Buchs ist frisch und locker. Oft spricht der Autor den Leser direkt an und berichtet von
seinen persönlichen Erfahrungen, während er das Buch schrieb.
Dabei ist das Buch aber durchweg objektiv, es werden immer beide
Seiten, positiv und negativ, betrachtet. Dem Lesespaß kommt zu
Gute, dass die Wortwahl sehr umgangssprachlich ist. Dadurch bedingt
ist aber auch, dass der Leser gute Englischkenntnisse haben sollte,
da man mit reinem Schulenglisch an der ein oder anderen Stelle an
die Verständnisgrenze stoßen wird.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „Seven Languages in Seven
Weeks“ eine andere Art von IT-Literatur ist, mit einem frischen
Ansatz. Der Autor erhebt keinen Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit, trotzdem geht das Buch in gewisser Hinsicht weiter als
viele andere Bücher zu Programmiersprachen. Wer sich für
Programmiersprachen und -paradigmen interessiert, für den ist das
Buch eine unbedingte Empfehlung.
| Buchinformationen |
| Titel | Seven Languages in Seven Weeks |
| Autor | Bruce A. Tate |
| Verlag | Pragmatic Bookshelf |
| Umfang | 300 Seiten |
| ISBN | 978-1-93435-659-3 |
| Preis | ca. 25,- Euro |
| |
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle
interessiert sich für Programmierung und
Programmiersprachen im Allgemeinen. Das Buch hat ihm maßgeblich
dabei geholfen, einen Einblick in weitere Sprachen und funktionale
Programmierung zu erhalten.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Niedermair
Die Referenz „Vi and Vim Editors“ beschäftigt sich mit dem Editor vi
und seinen Klonen vim, vile, elvis und nvi. Dabei wird ein Überblick
über Optionen und Befehle von vi, Befehlszeilen-Optionen, Shortcuts
im Eingabemodus, reguläre Ausdrücke, Tags und Erweiterungen
gegeben. Das Buch möchte damit den Einstieg in die Textverarbeitung
mit vi erleichtern und dem erfahrenen Anwender die Möglichkeit
geben, mit dem Editor effizienter zu arbeiten.
Was steht drin?
Nach der Einleitung geht es sofort an die Befehlszeilenoptionen und
die vi-Befehle. Diese werden in tabellarischer Form kurz
aufgelistet (acht Seiten). Im Anschluss folgen die Shortcuts für den
Eingabemodus, wie zum Beispiel das Ausführen eines Buffers oder das
automatische Einrücken (drei Seiten). Im nächsten Schritt geht es um
reguläre Ausrücke und Ersetzungen (sechs Seiten). Dann folgen die
ex-Befehle wie zum Beispiel Kopieren, Verschieben, Löschen, Markieren usw.
(vier Seiten) sowie die Initialisierung und Wiederherstellung
(eine Seite) und die vi-Optionen (zwei Seiten). Die nächsten beiden Seiten
beschäftigen sich mit Tags und dem Tags-Stack. Dabei wird Exuberant
ctags verwendet. Danach folgt vim (vi improved) mit seinen
Erweiterungen und Ergänzungen wie dem Programmassistenten, dem
Skripting, den Userfunktionen und vielem mehr (33 Seiten). Der
nächste Abschnitt behandelt den Klone nvi (new vi) mit vier Seiten,
gefolgt vom Klone elvis mit neun Seiten und vile (vi like emacs)
mit acht Seiten.
Zum Schluss folgen noch zwei Seiten mit Bezugsquellen aus dem Internet
und Kontaktinformationen. Der Index mit drei Seiten schließt das
Buch ab.
Wie liest es sich?
Das Buch stellt eine reine Referenz, meist in tabellarischer Form,
dar. Dabei wird das Tastenkürzel oder der Befehl aufgeführt,
gefolgt von einer kurzen Beschreibung. Bei aufwändigeren Befehlen
findet sich auch ein längerer Text, der den Sachverhalt beschreibt und
auch komplexere Anwendungsfälle ausreichend genug beschreibt. Beispiele
findet man hier so gut wie nicht. Das Buch eignet sich sehr gut, um
Kommandos oder Optionen nachzuschlagen. Das englische Buch lässt
sich auch mit weniger Englischkenntnissen gut lesen.
Kritik
Das Buch muss als gut bewertet werden, um mal schnell Dinge zu vi
und seinen Klonen nachzuschlagen. Der Buchindex mit drei Seiten
ermöglicht meist nicht, das Richtige zu finden. Hier hilft das
Inhaltsverzeichnis und ein wenig Blättern, um schneller ans Ziel zu
kommen.
Gegenüber der Vorgängerversion hat sich nur wenig geändert, daher
lohnt die Neuanschaffung nicht für jeden, vor allem da der Preis
von 8 auf 12 Euro angestiegen ist. Der schon erfahrenere
vi-Anwender wird eher zu einer der vielen vi reference cards
greifen, die man kostenlos im Internet finden, doppelseitig
ausdrucken und laminieren kann, um als Unterlage auf dem
Schreibtisch zu dienen.
| Buchinformationen |
| Titel | Vi and Vim Editors |
| Autor | Arnold Robbins |
| Verlag | O'Reilly |
| Umfang | 85 Seiten |
| ISBN | 978-1-4493-9217-8 |
| Preis | 12 € |
| |
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair
ist Lehrer an der Münchener IT-Schule
und unterrichtet hauptsächlich
Programmierung, Datenbanken und IT-Technik. Er beschäftigt sich
seit Jahren mit Unix und unterrichtet Linux für die
LPI-Zertifizierung.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Sie kennen eine Linux-Messe, welche noch nicht auf der Liste zu
finden ist? Dann schreiben Sie eine E-Mail mit den Informationen zu
Datum und Ort an .
Zum Index
.
Zum Index
freiesMagazin erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats. Die August-Ausgabe wird voraussichtlich am 7. August unter anderem mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Webzugriff
- Variable Argumente in LaTeX nutzen
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
|
| Erscheinungsdatum: 3. Juli 2011 |
|
|
| Redaktion |
| Frank Brungräber | Thorsten Schmidt |
| Dominik Wagenführ (Verantwortlicher Redakteur) |
| |
| Satz und Layout |
| Ralf Damaschke | Nico Maikowski |
| Matthias Sitte | |
| |
| Korrektur |
| Daniel Braun | Stefan Fangmeier |
| Mathias Menzer | Karsten Schuldt |
| Stephan Walter | |
| |
| Veranstaltungen |
| Ronny Fischer |
| |
| Logo-Design |
| Arne Weinberg (GNU FDL) |
| |
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie
freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor.
freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren. Das
freiesMagazin-Logo
wurde von Arne Weinberg erstellt und unterliegt der
GFDL.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei
Randall Munroe.
Zum Index
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 3 Jul 2011, 13:16.