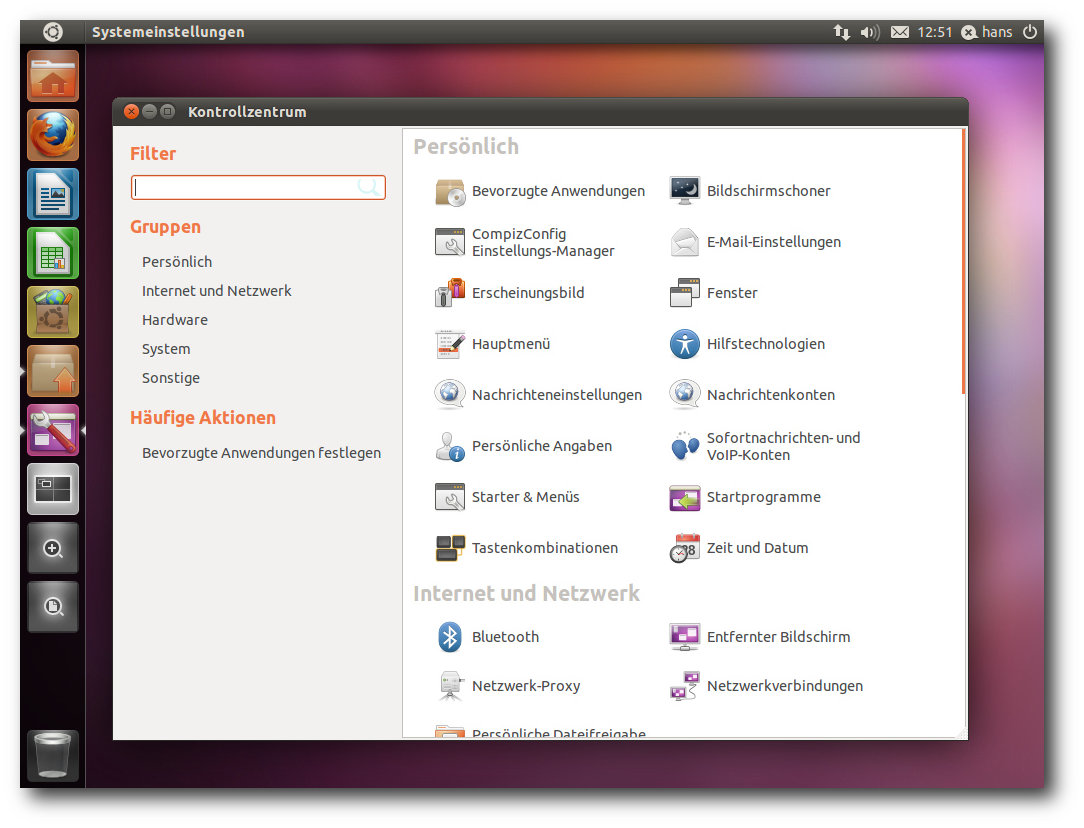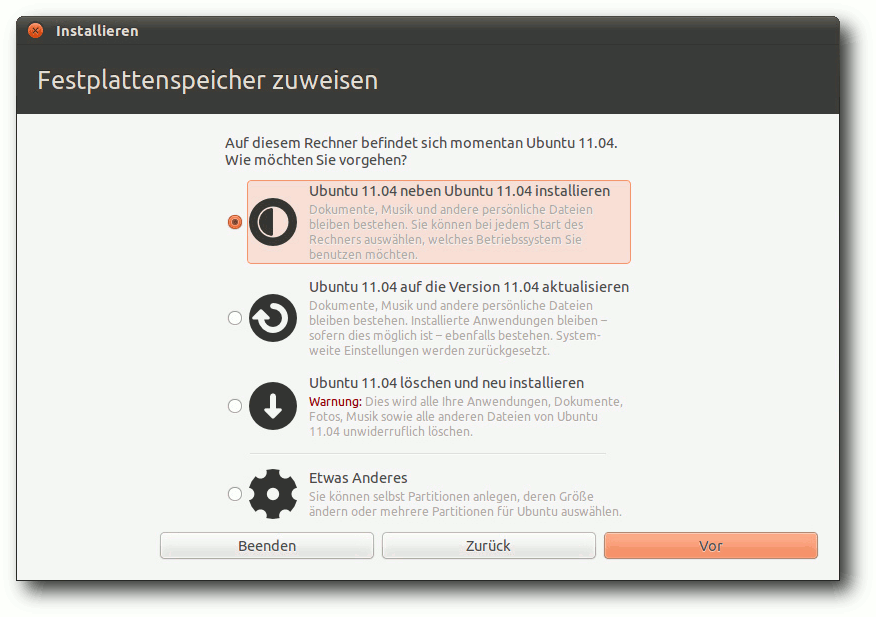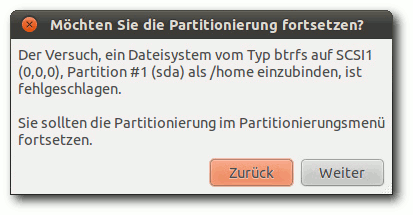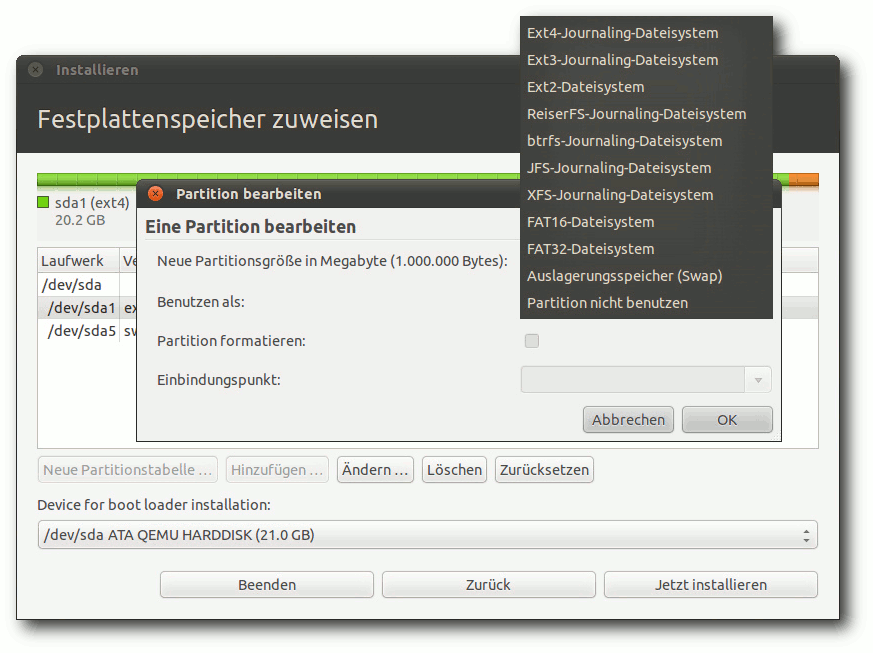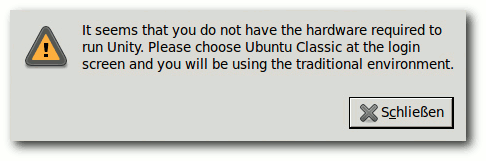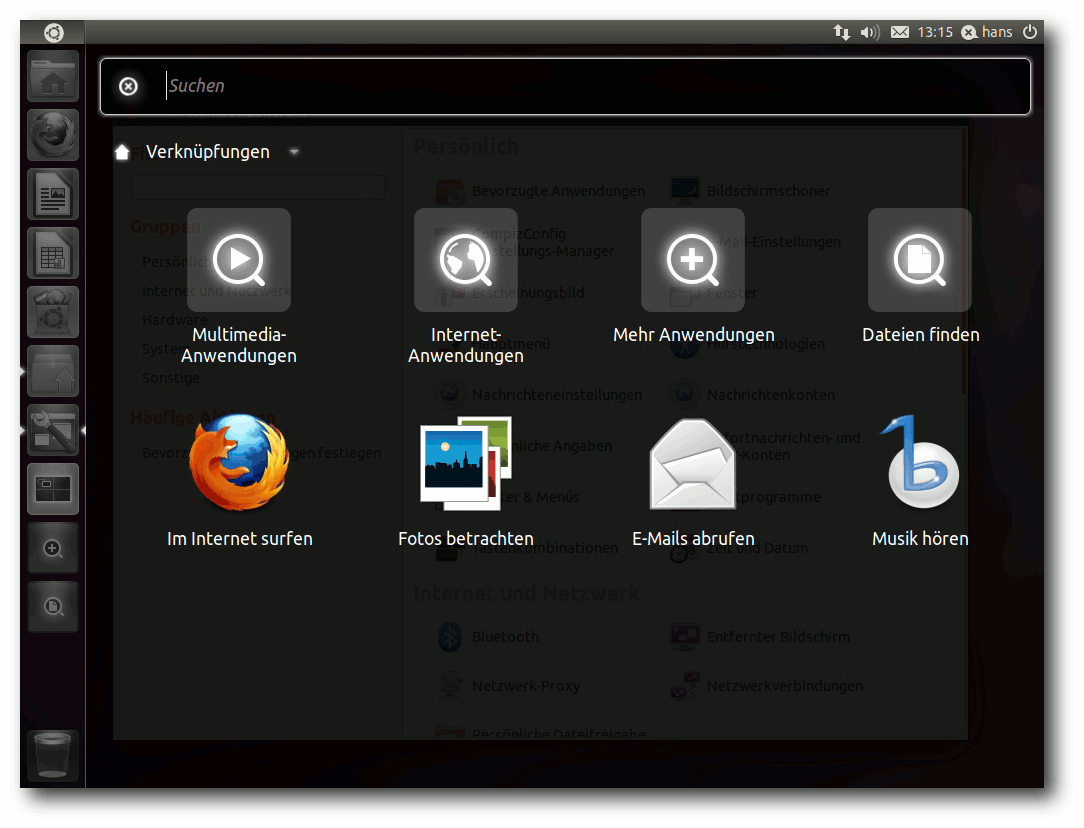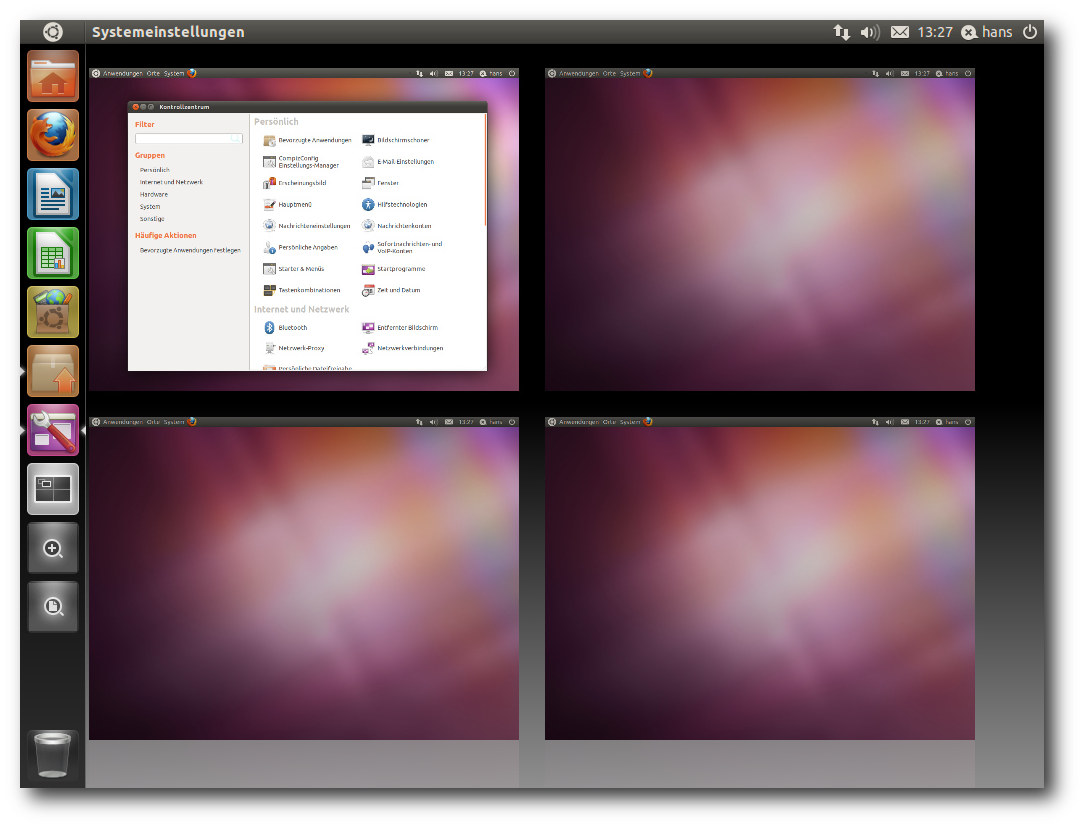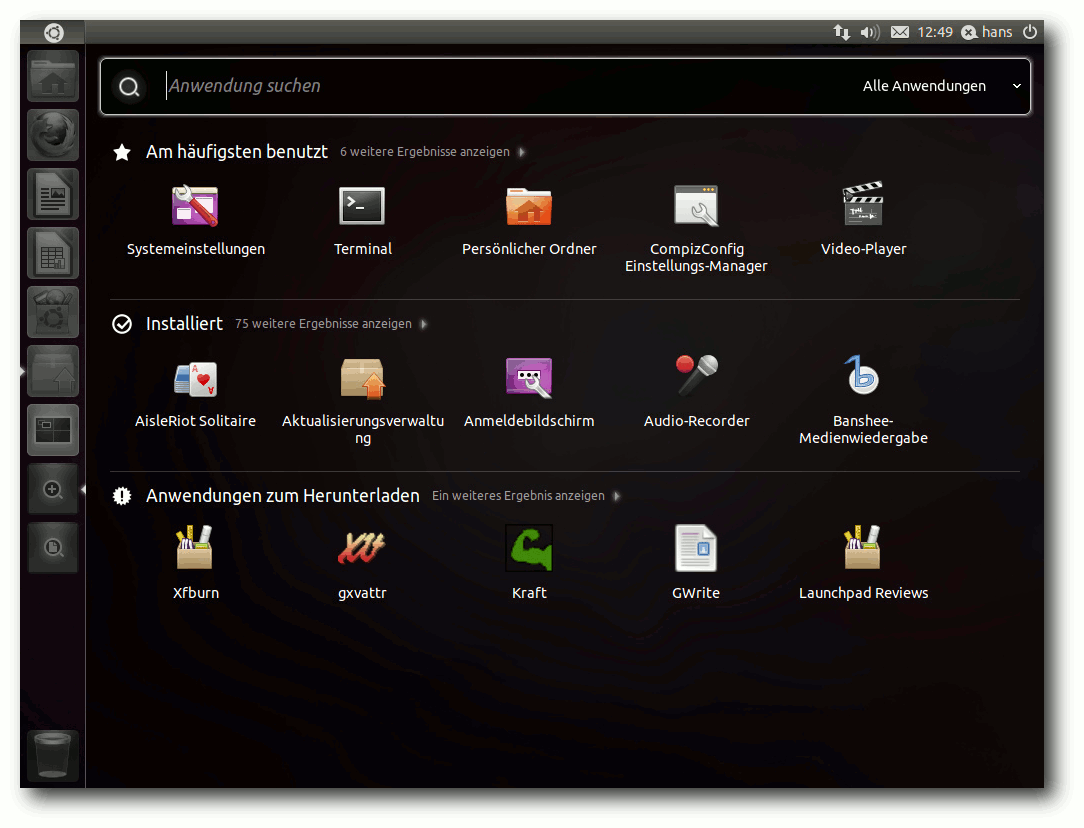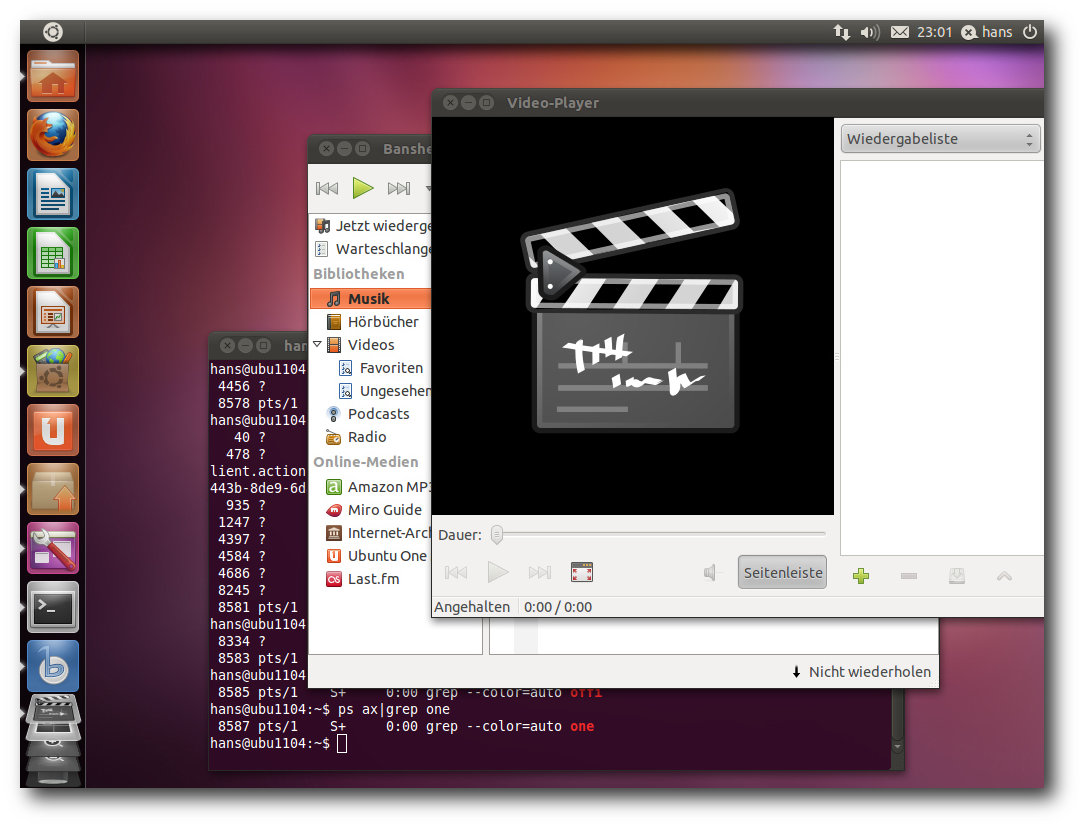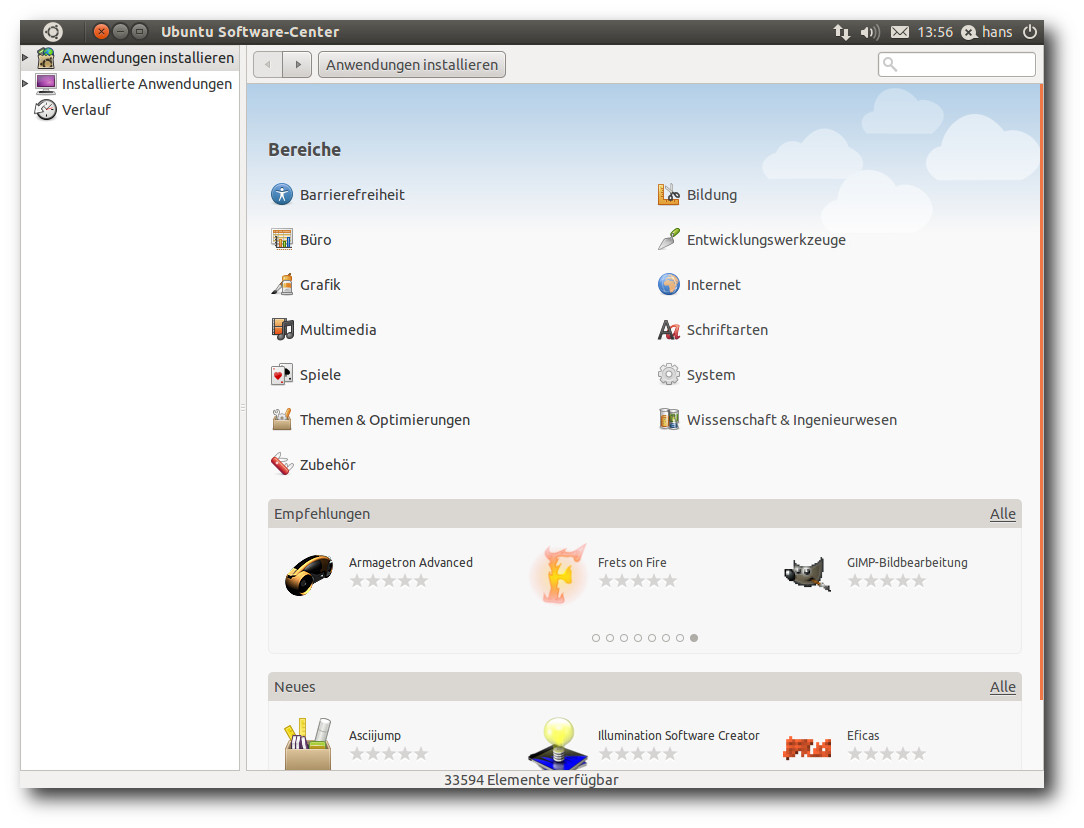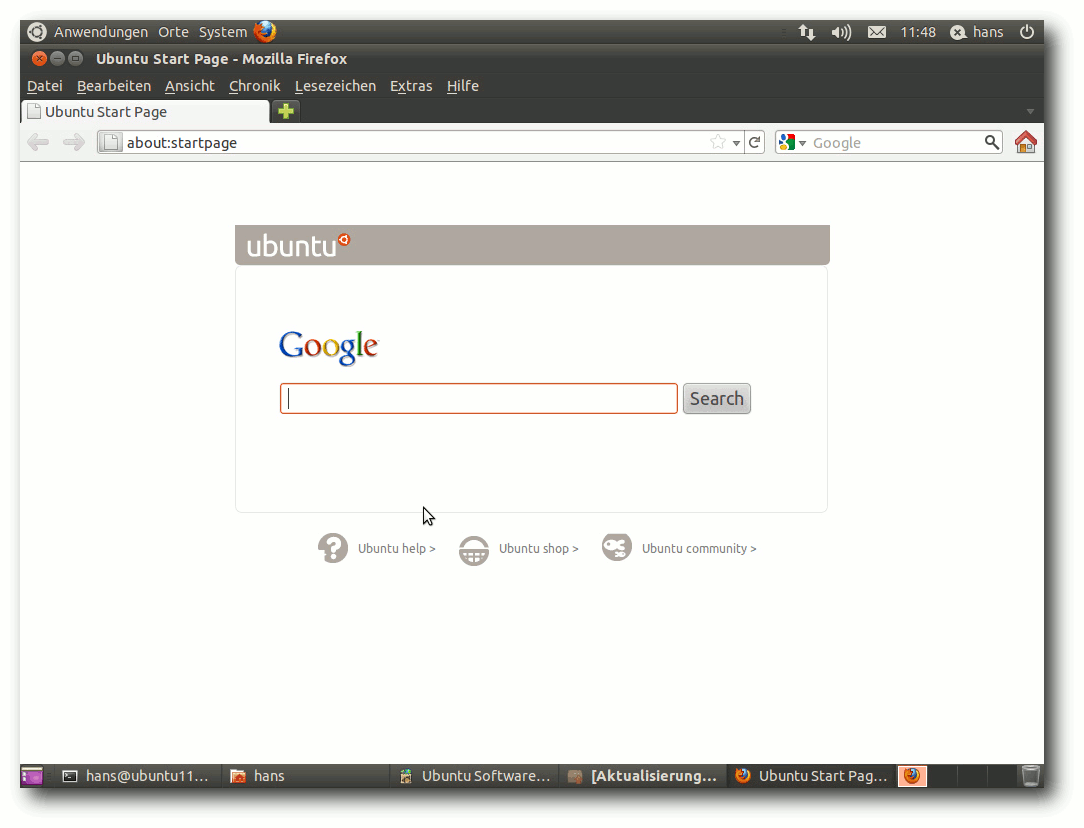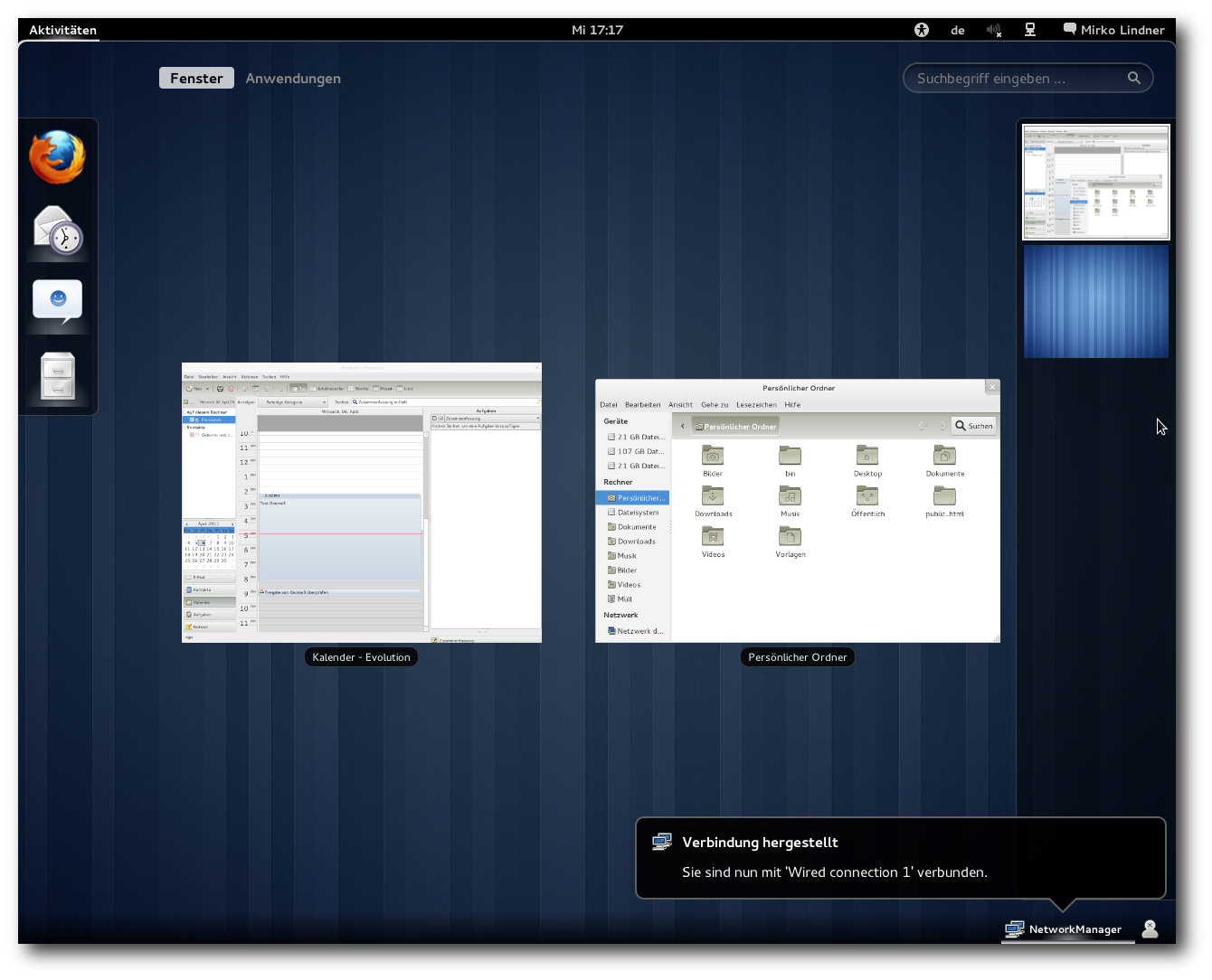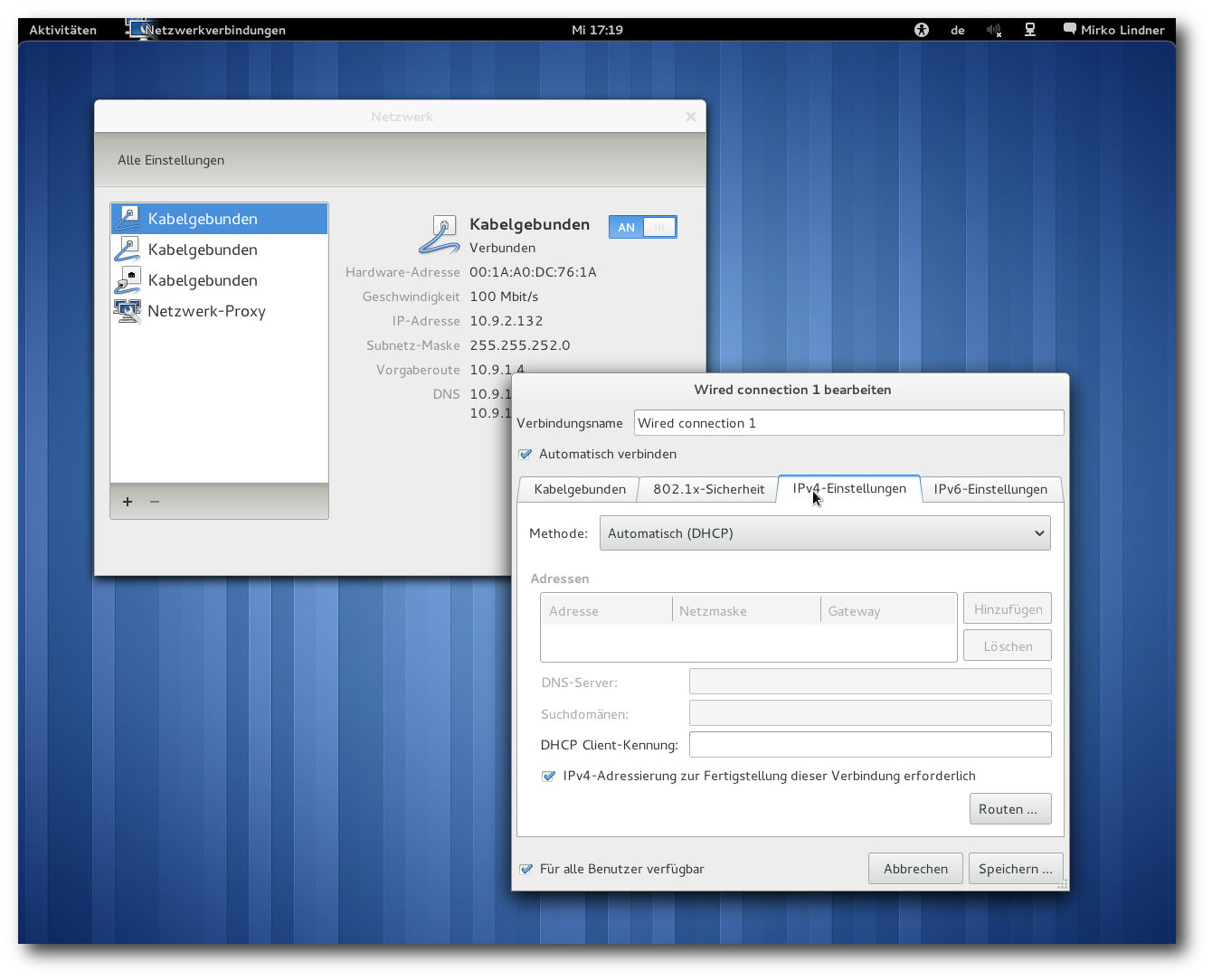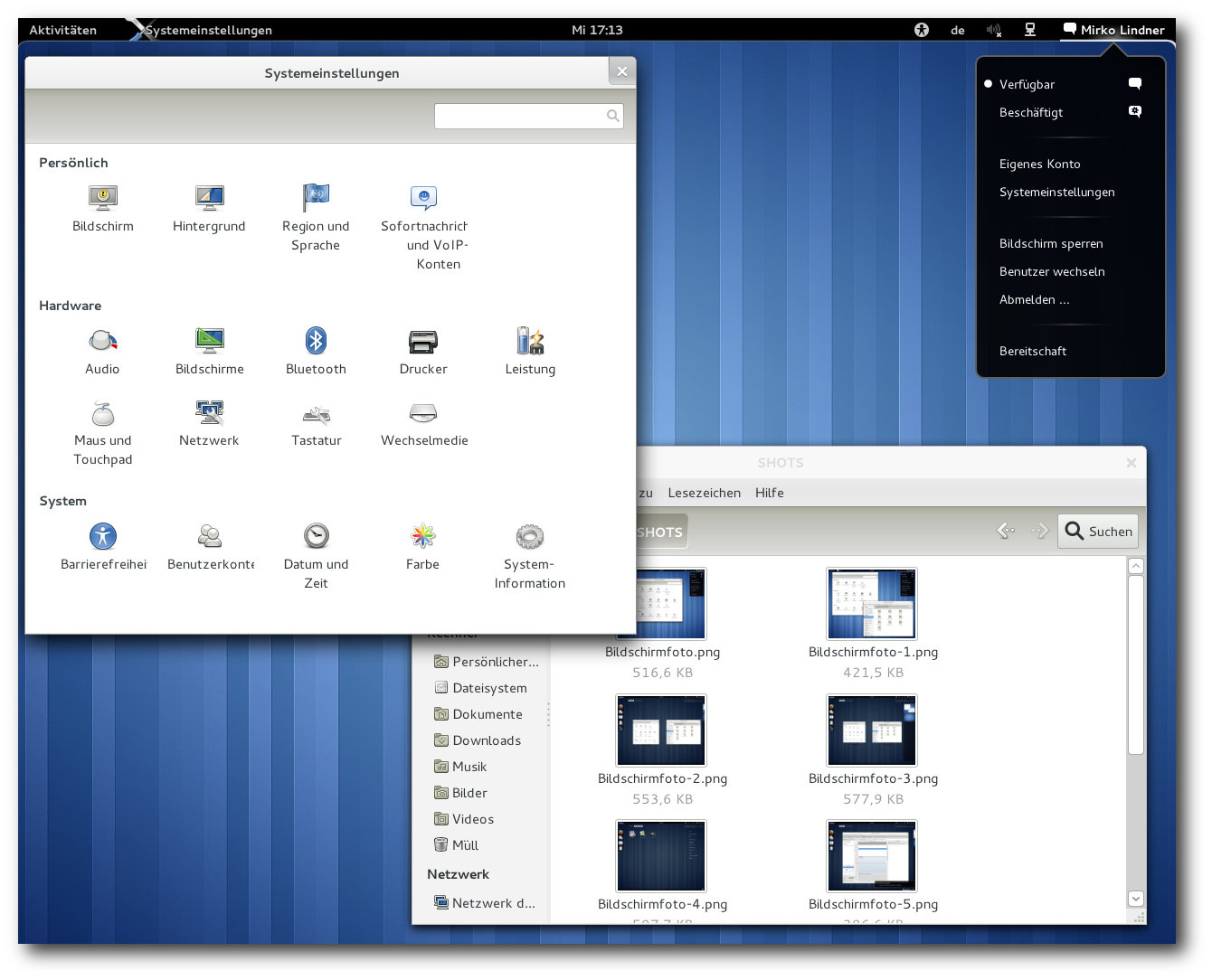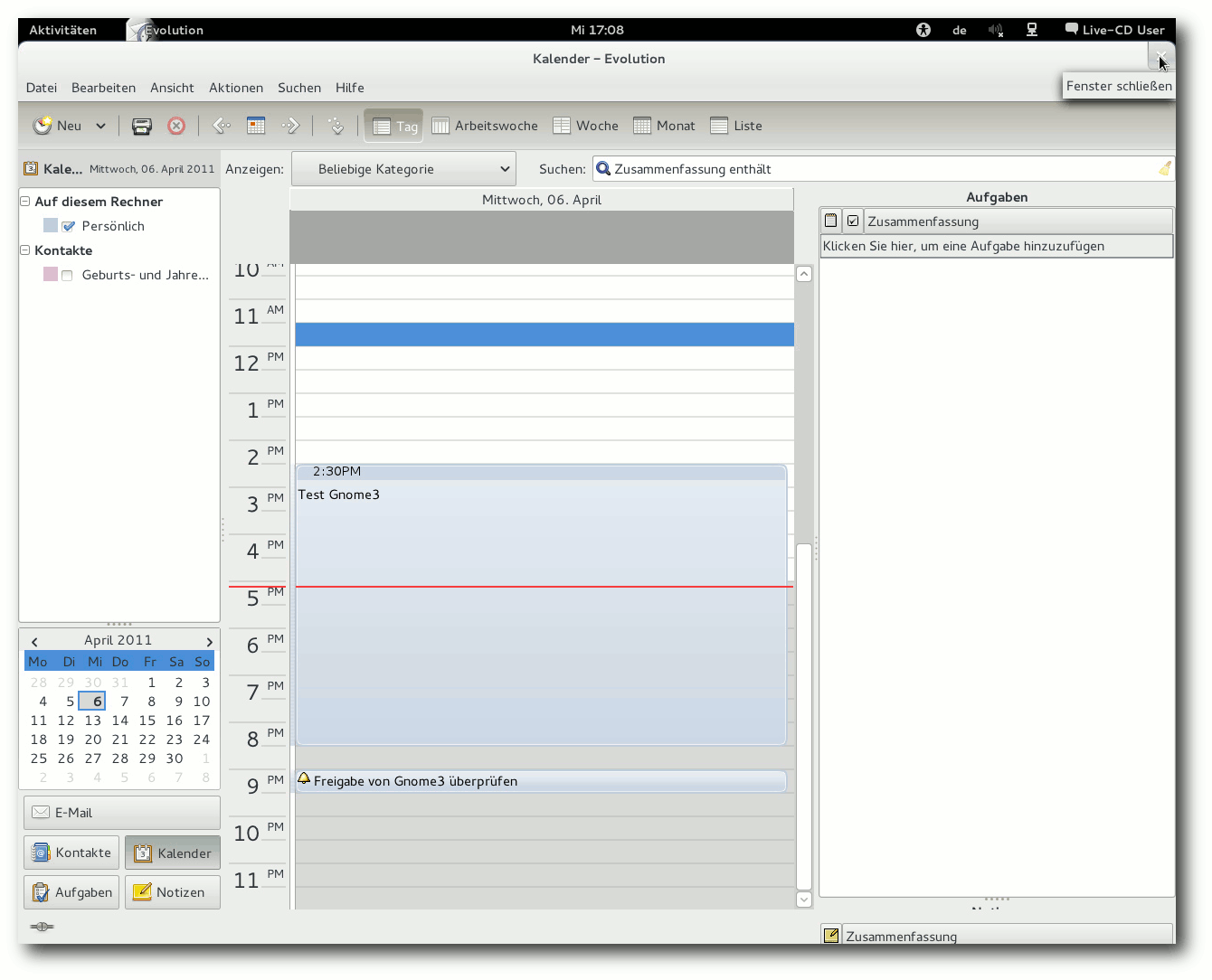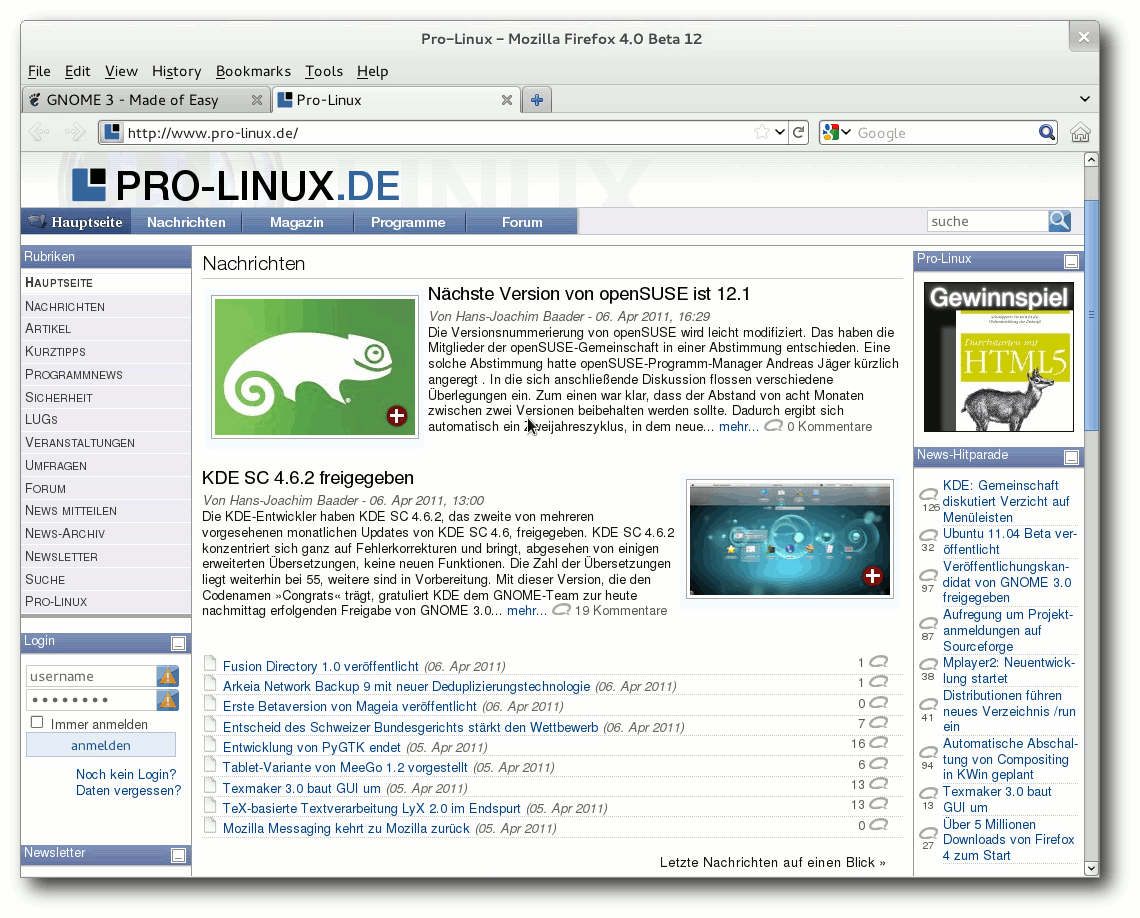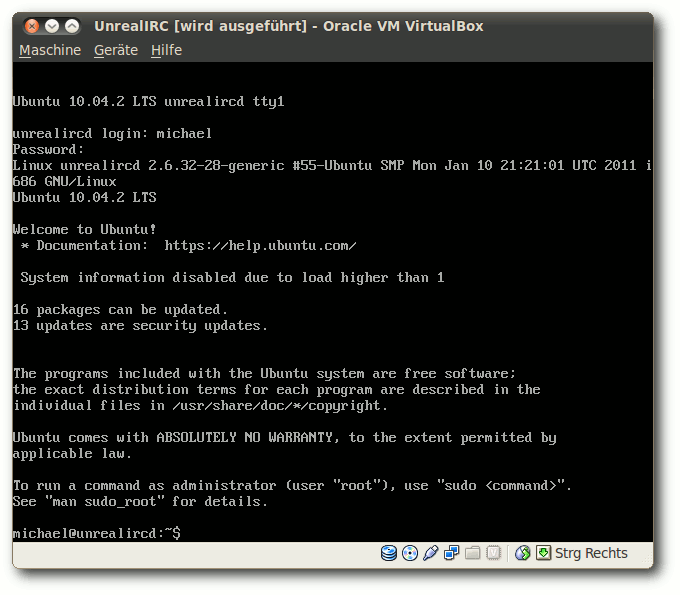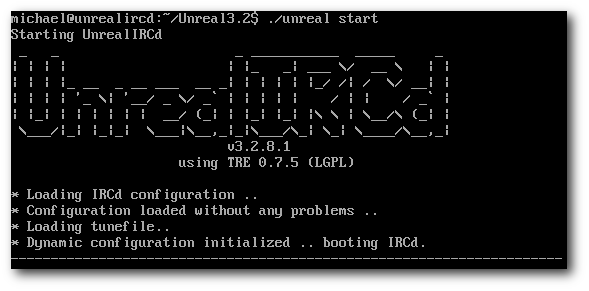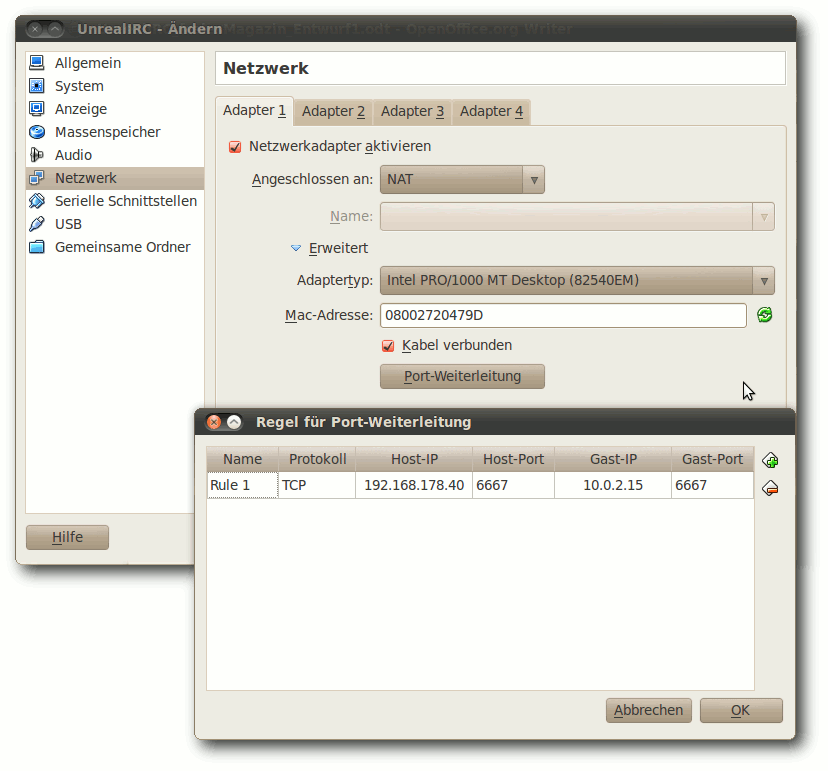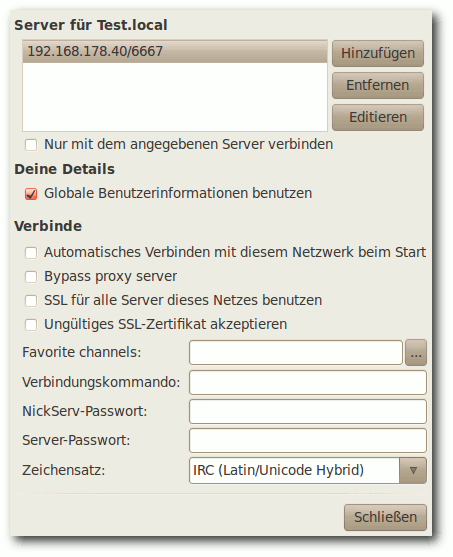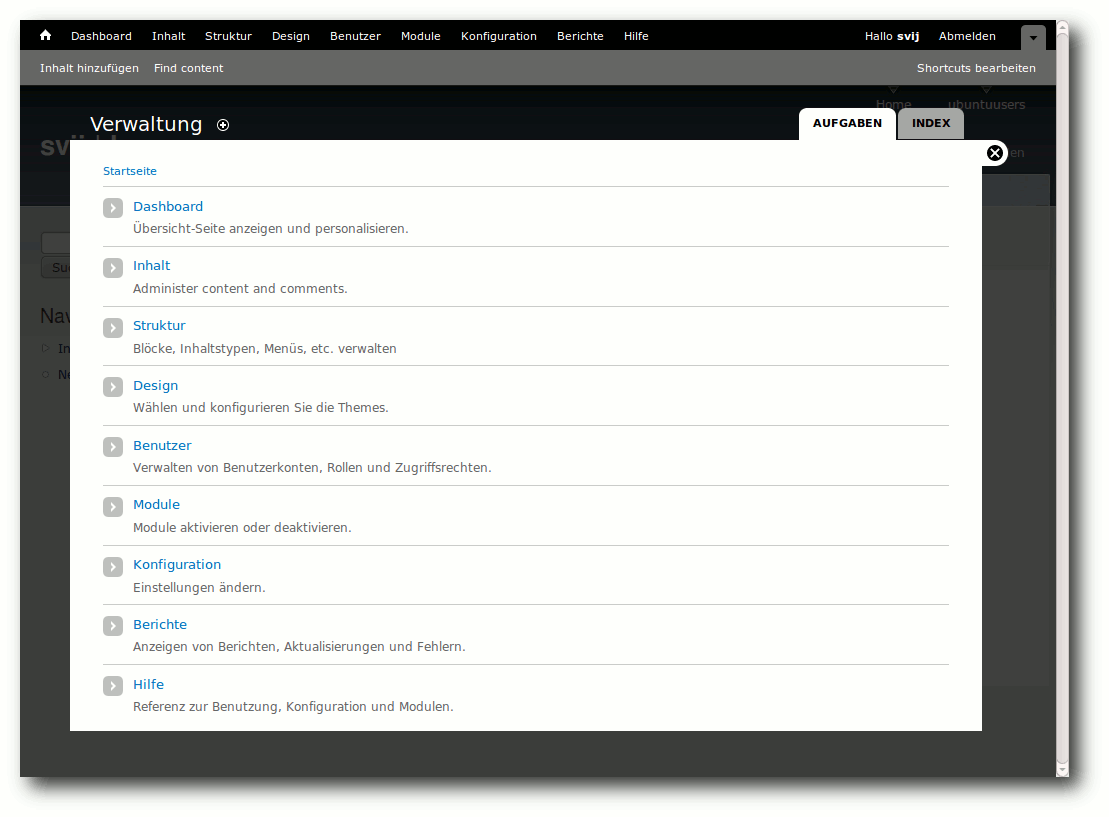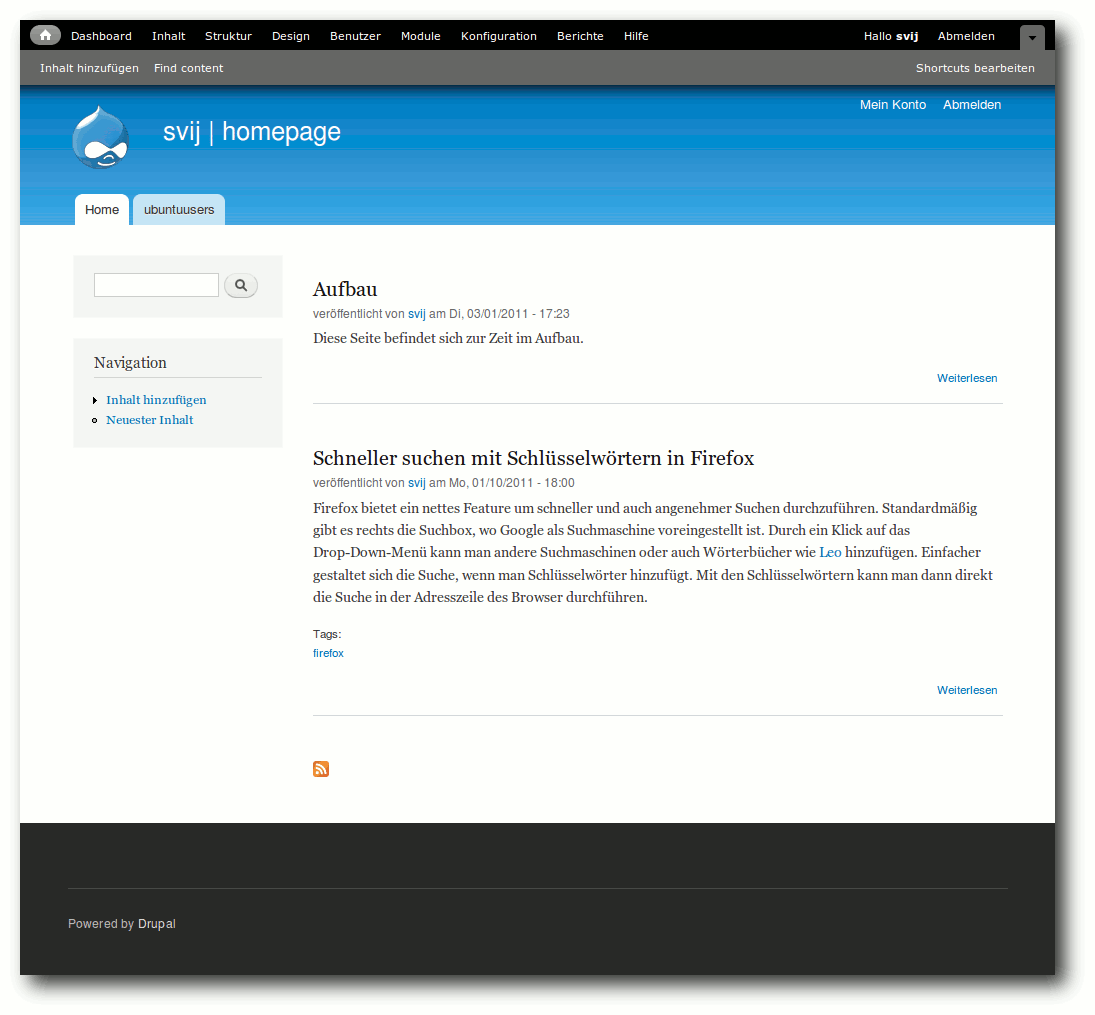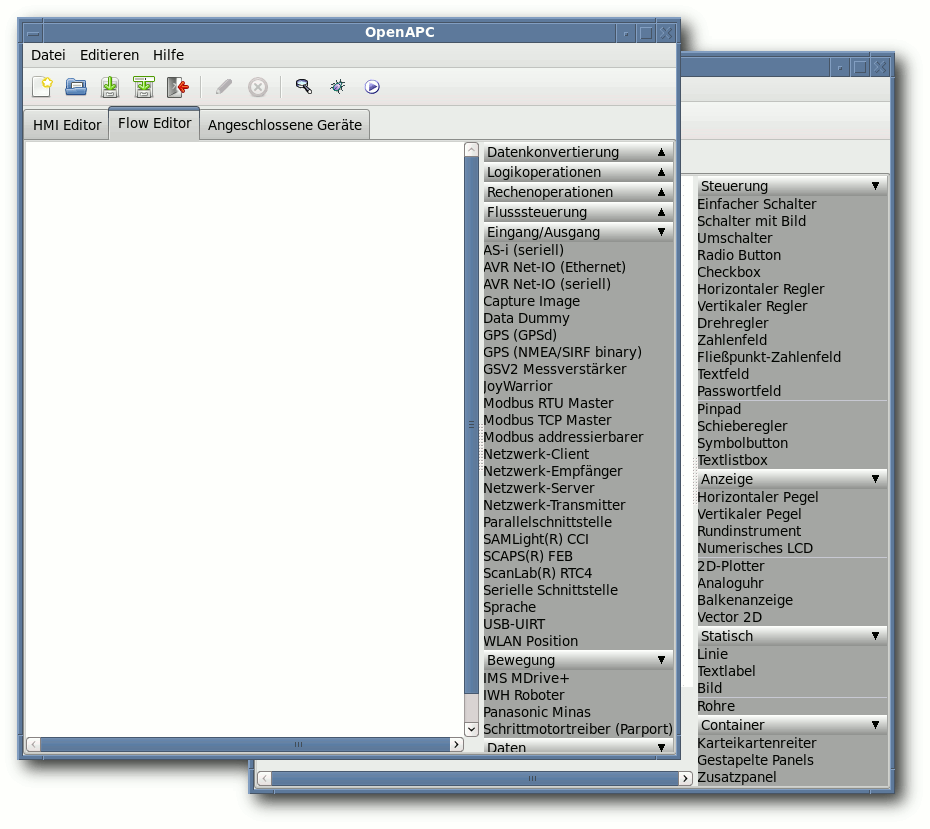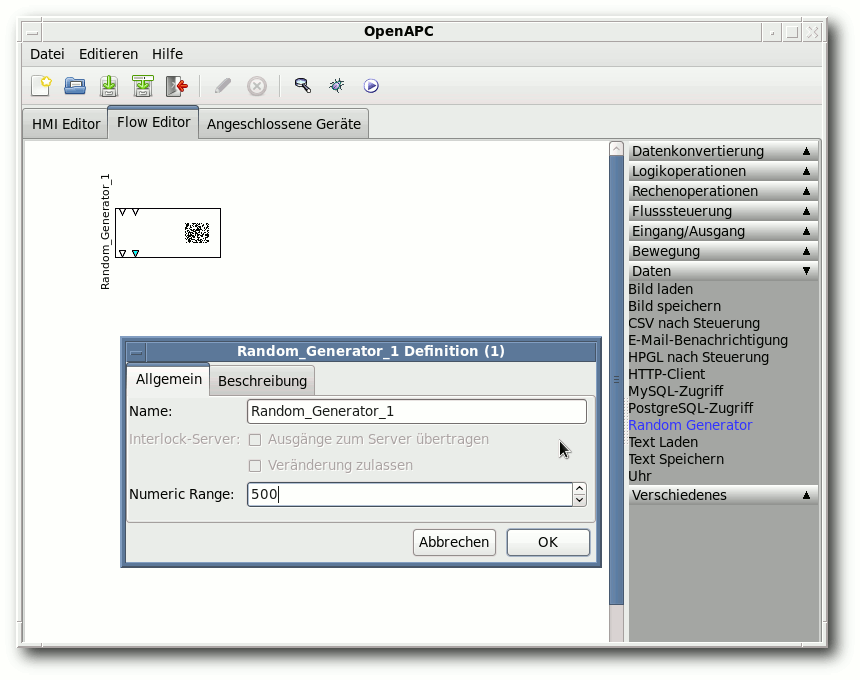Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin Juni 2011 (ISSN 1867-7991)
Topthemen dieser Ausgabe
Ubuntu 11.04 – Vorstellung des Natty Narwhal
Am 28. April 2011 wurde Ubuntu 11.04 freigegeben. Der Artikel gibt einen Überblick über die Neuerungen der Distribution mit besonderem Augenmerk auf das neue Desktop-System „Unity“, welches im Vorfeld bereits für viel Furore sorgte. (weiterlesen)
GNOME 3.0: Bruch mit Paradigmen
Mit der Freigabe von GNOME 3 bricht der Entwicklerkreis rund um die Desktopumgebung mit vielen gängigen Paradigmen der Benutzerführung und präsentiert ein weitgehend überarbeitetes Produkt, das zahlreiche Neuerungen mit sich bringt. Drei wesentliche Punkte sind in die neue Generation der Umgebung eingegangen: eine Erneuerung der Oberfläche, Entfernung von unnötigen Komponenten und eine bessere Außendarstellung. (weiterlesen)
UnrealIRC – gestern „Flurfunk“, heute „Chat“
Ungern brüllt man Anweisungen von Büro zu Büro. Damit Angestellte miteinander kommunizieren können, wird vielerorts zum Telefon gegriffen. Wird bereits telefoniert, muss die dienstliche E-Mail herhalten, um Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen. Was aber, wenn die Leitung belegt und das Senden einer E-Mail derzeit nicht möglich ist? Ein Chat ist die Lösung für das Problem. (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Ubuntu 11.04 – Vorstellung von Natty
GNOME 3.0: Bruch mit Paradigmen
Der Mai im Kernelrückblick
Anleitungen
UnrealIRC – gestern „Flurfunk“, heute „Chat“
Software
Einblicke in Drupal
Hardware
Heimautomatisierung für Hardwarebastler (Teil 3)
Community
Rezension: Praxiskurs Unix-Shell
Rezension: Computergeschichte(n) – nicht nur für Geeks
Magazin
Editorial
Leserbriefe
Veranstaltungen
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Traut Euch und macht mit
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Die Reaktionen auf unsere These im Editorial des letzten Monats [1] waren recht gut.
Zur Erinnerung: Wir fragten, ob – nach der bescheidenen Teilnehmerzahl
am Grafikwettbewerb [2] –
auch die Linux-Community zu einer reinen Konsumgesellschaft verkommt.
Wie in den Leserbriefen nachzulesen ist,
gab es einige Zustimmungen, aber auch kritische Gegenstimmen.
Was uns aber sehr gewundert hat, waren sehr häufige Bemerkungen der
Art „Ich habe mir eh keine Chancen ausgerechnet bei der Masse an
professionellen Einsendungen“. Wie jetzt jeder weiß, haben wohl sehr
viele Leser so gedacht, was die geringe Teilnahme am Wettbewerb
erklären könnte.
Achtung, jetzt wird es politisch: Das obige Beispiel zeigt sehr schön,
wieso man wählen sollte. Wenn jeder potenzielle Wähler einer „normalen“
Partei (was auch immer das ist) sich denkt, dass die Wahl eh nichts
bringt und andere schon wählen gehen werden, kann es am Ende passieren,
dass irgendeine extreme Partei mit ganz wenig Stimmen die Wahl gewinnt.
Als alternatives Beispiel: Wer bei einem Wettbewerb erst gar nicht
teilnimmt, hat automatisch verloren. Erst durch die Teilnahme gibt
es überhaupt eine Chance, etwas zu gewinnen – auch wenn diese Chance
vielleicht verschwindend gering ist.
Dies gilt im Übrigen für fast alles im Leben: sei es die Frage nach
einer Gehaltserhöhung, das erste zögerliche Gespräch mit seinem
Schwarm oder der Umzug ins Ausland, um eines neues Leben zu beginnen.
Wer diese Schritte nicht wagt, wird auf alle Fälle nicht enttäuscht,
das stimmt. Aber er wird auch nie die positiven Konsequenzen seines
Handelns spüren, wenn er es nicht zumindest versucht. (Es erfolgt hier
explizit der Hinweis, dass das nicht für alles gilt. Der Sprung aus
einem Fenster im zehnten Stock eines Hochhauses, nur um zu wissen,
wie sich das anfühlt, ist eine blöde Idee.)
Call for Papers zur Ubucon 2011
Einige Leser werden es vielleicht schon gesehen haben: Vom 14. bis
16. Oktober 2011 soll in Leipzig die fünfte Ubucon stattfinden [3].
Wieso erwähnen wir das hier explizit und verlinken es nicht nur im
Veranstaltungskalender wie
gewohnt? Zum einen, weil wir die Wurzeln von freiesMagazin nicht vergessen
haben, die ganz klar bei Ubuntu und beim Portal
ubuntuusers.de [4] liegen. Die Ubucon wird zu einem großen
Teil genau von den Leuten hinter diesem Portal getragen. Zum
anderen aber auch, weil die Veranstaltung die letzten Jahre einen
sehr guten Anlaufpunkt für alle Neueinsteiger und Anfänger gebildet
hat. Die Vorträge beschäftigten sich nur selten mit extrem
speziellen
Problemen, sondern zeigten das, was den Normalanwender
auch interessiert.
Sollte also ein freiesMagazin-Leser bzw. -Autor Lust haben, Leipzig im Oktober
einen Besuch abzustatten, kann er auf der Ubucon vorbei schauen und
dabei auch gleich einen Vortrag halten. Wer meint, dass sich das nicht lohnt, weil ganz viele andere,
viel bessere Vorschläge bei der Ubucon-Organsation eingehen und der
eigene Vortrag dagegen „schlecht“ aussieht, sollte sich noch einmal
die ersten Absätze dieses Editorials durchlesen.
Serverumzug
Wie sicherlich einige unserer Webseiten-Besucher wissen, wird der
Server, auf denen die freiesMagazin-Dienste wie Webseite, FTP,
Versionsverwaltung, Wiki etc. laufen, von der Firma
x|encon [5] gesponsort. Da der
bisherige Server eine für die Zukunft ungenügende
Hardwareausstattung hat, haben wir (ohne unser Zutun) einen neuen
Server gestellt bekommen:
| Hardwarevergleich |
| Hardware | Alter Server | Neuer Server |
| RAM | 256MB | 1024MB |
| HDD | 20GB (nach Upgrade!) | 40GB |
| CPU | 1x | 2x |
| HVM | Nein | Ja |
| VNC | Nein | Ja |
| |
Da wir auf einen neuen Server migrierten, implementierten wir
natürlich auch IPv6, welches x|encon mittlerweile auch für (fast)
alle Produkte anbietet. Bei dieser Gelegenheit schwenkten wir auch
gleich von Ubuntu 6.06 „Dapper Drake“, dessen Support im Juni dieses
Jahres auch für die Serverversion ausläuft auf Debian 6.0 „Squeeze“.
Gleichzeitig konnten wir so alles, was bisher bereits läuft,
endlich einmal dokumentieren und bekommen eine einmalige Gelegenheit
klar Schiff zu machen, sodass wirklich nur noch das läuft, was
gebraucht wird. Die vorherigen Administratoren hatten hier
aber schon viel Vorarbeit geleistet und alle Dienste sinnvoll
konfiguriert.
Bei der Neuinstallation haben wir auch einige andere Sachen
mitbehoben, welche in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind.
So haben wir auf dem neuen Server jetzt ein LVM [6], welches es
ermöglicht, Snapshots vom System anzulegen oder die Volumes in der
Größe zu verändern. Zusätzlich bekommt jeder wichtige Dienst für
seine Daten ein eigenes Volume und kann so nicht das Root-Dateisystem
vollschreiben.
Die Migration der Daten startete am Freitag 27.05.2011 um 20:00
Uhr [7];
vorab hatten wir die Daten aber zu Testzwecken schon einmal
herüberkopiert. Durch rsync hatte dieser Teil nur circa
20 Minuten gedauert. Die komplette Migration dauerte in etwa zwei Stunden, da natürlich wie bei jeder großen Umstellung noch ein, zwei
Sachen im Vorfeld nicht ganz bekannt waren.
Nachdem alle Dienste auf dem neuen Server migriert waren, wurden
auch die DNS-Einträge geändert und IPv6 „scharfgeschaltet“.
Die Migration hat sich für uns gelohnt, da wir zum einen ein performanteres
System erhalten haben, aber auch das leidige Thema der Dokumentation
erschlagen konnten. In Zukunft wird es bestimmt noch die eine oder
andere Neuerung geben, die sich unter Umständen auch (positiv) auf
die Leser auswirkt.
Redaktioneller Hinweis: Obiger Abschnitt zur Serverumstellung stammt von unserem
Server-Administrator Stefan Betz.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-05
[2] http://www.freiesmagazin.de/20110430-gewinner-des-grafikwettbewerbs
[3] http://ikhaya.ubuntuusers.de/2011/05/12/ubucon-2011-call-for-papers-gestartet/
[4] http://ubuntuusers.de/
[5] http://www.xencon.net/
[6] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Logical_Volume_Manager
[7] http://www.freiesmagazin.de/20110527-serverumzug
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Hans-Joachim Baader
Am 28. April 2011 wurde Ubuntu 11.04 freigegeben. Dieser Artikel
gibt einen Überblick über die Neuerungen mit besonderem Augenmerk
auf das neue Desktop-System „Unity“.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Ubuntu 11.04“ erschien erstmals bei
Pro-Linux [1].
Vorwort
Planmäßig wie jedes halbe Jahr erschien die neue Version 11.04
„Natty Narwhal“ der Linux-Distribution Ubuntu. Unter den vielen
Neuerungen ragt wohl eine besonders heraus: der neue Desktop
„Unity“, der zuvor schon als Desktop für Netbook-Systeme im Einsatz
war und jetzt der Standard-Desktop auf allen Rechnern ist, die die
Hardware-Anforderungen erfüllen. Schon im Vorfeld wurde viel über
das Für und Wider von Unity diskutiert.
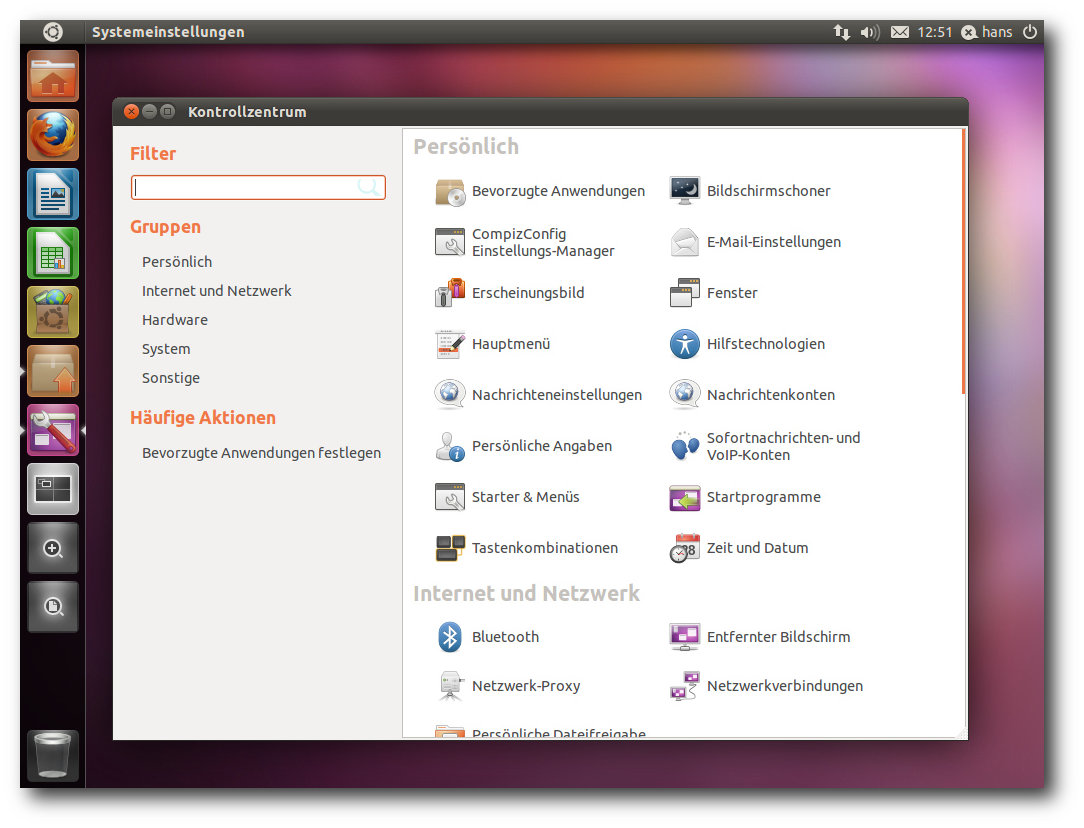
Unity mit Starter, Kontrollzentrum und schmalen Scrollbalken.
Wie ihr Vorgänger Ubuntu 10.10 (siehe „Ubuntu 10.10“, freiesMagazin
11/2010 [2]) ist
die neue Version keine Version mit längerfristigem Support. Sie
wird in allen Varianten 18 Monate mit Sicherheits- und anderen
wichtigen Updates versorgt. Ein Update ohne Neuinstallation von der
Version 10.10 wird offiziell unterstützt.
Ubuntu erscheint in mehreren Varianten, deren Hauptunterschied in
den Installationsmedien und dem Umfang der vorinstallierten Software
liegt. Die von Canonical hervorgehobenen Varianten sind jedoch die
Desktop-Edition mit Unity als
Oberfläche und die Server-Edition.
Die weiteren offiziell unterstützten Varianten sind Kubuntu,
Xubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio und Mythbuntu. Dieser Artikel wird
sich auf Ubuntu und Kubuntu beschränken. Aus praktischen Gründen
sind auch andere Einschränkungen nötig. So wurden natürlich
zahlreiche zur Distribution gehörende Softwarepakete geändert,
manche auch ersetzt. Mit wenigen Ausnahmen kann auf diese
Änderungen nicht eingegangen werden; man darf annehmen, dass die
meisten Pakete unter allen
aktuellen Distributionen nahezu gleich
sind und überall gleich gut funktionieren.
Es sei noch angemerkt, dass es sich bei diesem Artikel nicht um
einen Test der Hardwarekompatibilität handelt. Es ist bekannt, dass
Linux mehr Hardware unterstützt als jedes andere Betriebssystem
und das überwiegend bereits im Standard-Lieferumfang. Ein Test
spezifischer Hardware wäre zu viel Aufwand für wenig Nutzen. Dies
sei denen überlassen, die es für nötig halten. Die bekannten
Probleme von Ubuntu 11.04 mit Hardware sind in den Anmerkungen zur
Veröffentlichung [3]
aufgeführt.
Da eine Erprobung auf realer Hardware nicht das Ziel ist, werden
für den Artikel zwei identische virtuelle Maschinen, 64 Bit, unter
KVM mit jeweils 768 MB RAM verwendet. Weil KVM nicht die nötigen
Voraussetzungen für Unity bietet, wird eine weitere 64-Bit-VM unter
Virtualbox hinzugezogen.
Installation
Ubuntu wird meist von einem Live-System aus, das als CD und
umfangreichere DVD verfügbar ist, installiert. Ferner ist eine
Installation von der „Alternate-CD“ möglich, die im Textmodus
läuft, aber wesentlich mehr Flexibilität als die grafische
Installation besitzt.
Für Ubuntu 11.04 werden 384 MB RAM für den Unity-Desktop als
Mindestanforderung angegeben. Mit 512 MB und mehr läuft das System
allerdings wesentlich besser. Kubuntu ist aufgrund des größeren
Speicherbedarfs von KDE unter 512 MB RAM fast nicht zu benutzen –
aber wer den Rechner intensiv nutzt, sollte bei den heutigen
Speicherpreisen lieber gleich in 4 bis 8 GB RAM und ein
64-Bit-System investieren, so dass reichlich Platz für die
Anwendungen ist. Xubuntu und die Server-Edition sollten weiterhin
mit 128 MB auskommen.

Startbildschirm der Desktop-DVD.
Im Folgenden soll nur die Installation von der Desktop-DVD kurz
vorgestellt werden. Wer den Logical Volume Manager (LVM) verwenden
will, muss zur textbasierten Installation von der DVD oder der
Alternate-CD wechseln, da diese Möglichkeit im grafischen Installer
nach wie vor fehlt. Die Alternate-Installation läuft ansonsten fast
genauso ab wie die grafische Installation. Durch Boot-Optionen
steht aber eine erweiterte Installation zur Verfügung, mit der man
weitgehende Kontrolle über den ganzen Vorgang hat.
Die Installation unterlag nur wenigen Änderungen gegenüber der
letzten Version, die ja etwas umgestellt und verbessert wurde. Das
Einrichten der Festplatte ist nun noch einfacher und bietet einige
weitere Optionen. So kann ein bereits installiertes Ubuntu-System
vom Desktop-Installer aus aktualisiert oder neu installiert werden,
wenn eine Internet-Verbindung vorhanden ist. Ist die vorherige
Installation bereits Ubuntu 11.04, kann das allerdings zu kuriosen
Vorschlägen wie „Ubuntu 11.04 auf Ubuntu 11.04 aktualisieren“ führen.
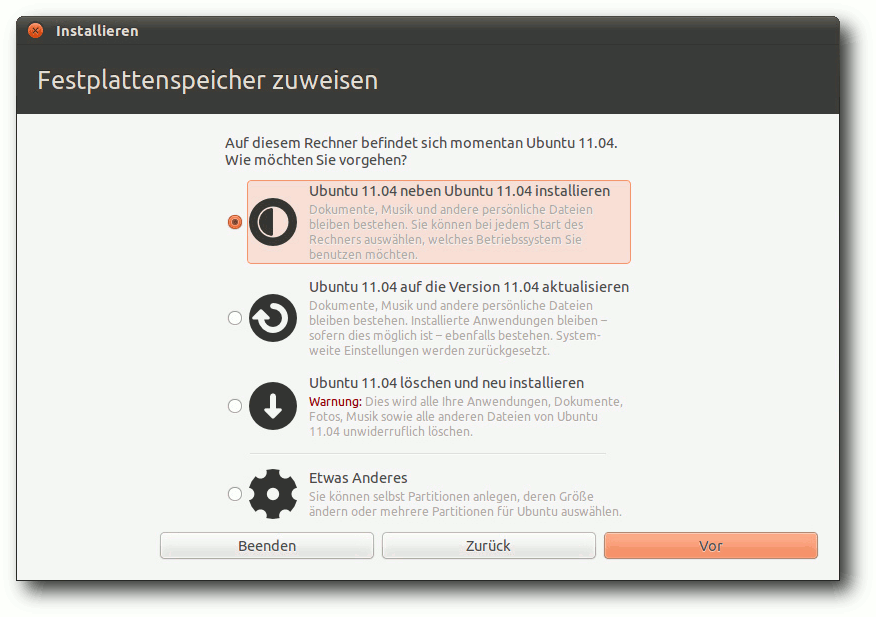
Merkwürdige Formatierungsoptionen.
Das Dateisystem Btrfs kann nun ausgewählt werden und das System
sollte dank eines GRUB-Moduls auch mit diesem booten können. Btrfs wird
in den Anmerkungen zur Veröffentlichung ausdrücklich noch als
experimentell gekennzeichnet, aber mit einigen kleinen
Einschränkungen sollte es nutzbar sein. Im Test kam es während der
Formatierung zu einem nicht in den Anmerkungen genannten Fehler,
sodass ext4 als Dateisystem gewählt werden musste. Auch bei einer
weiteren Testinstallation trat dieser Fehler auf.
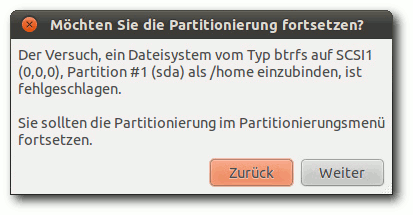
Fehler beim Anlegen von Btrfs.
Von diesen Makeln abgesehen funktioniert die Partitionierung
korrekt. An das Einrichten mindestens einer Swap-Partition wird man
gegebenenfalls erinnert und es wird gewarnt, wenn die
Root-Partition zu klein für die Installation ist. Hier hat das
Programm gegenüber der letzten Version hinzugelernt, denn es warnt
nun nicht mehr,
wenn man die Root-Partition klein macht und eine
separate, ausreichend große Partition für /usr anlegt. Der
Einbindungspunkt kann nun nicht mehr frei eingegeben werden,
sondern man ist auf die Auswahl beschränkt, die Ubuntu vorgibt.
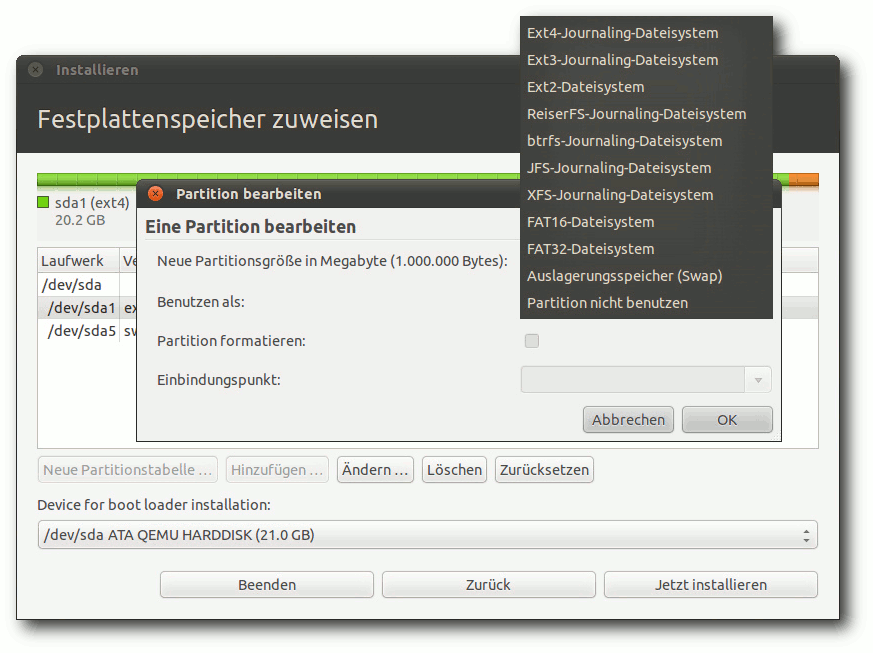
Dateisystemauswahl bei der Partitionierung.
Direkt nach der Definition der Partitionen beginnt der Installer mit
der Partitionierung und der Installation der Pakete im Hintergrund.
Ein Fortschrittsbalken zeigt von hier ab den Stand der Installation
an. Parallel dazu kann man die Zeitzone auswählen und danach das
gewünschte Tastatur-Layout einstellen.
Im letzten Schritt gibt man seinen Namen, Anmeldenamen, Passwort und
den Computernamen ein. Wenn zuvor bereits per DHCP ein Name
ermittelt werden konnte, wird dieser als Vorgabe angezeigt. Wenn
erkannt wird, dass die
Installation in einer virtuellen Maschine
läuft, wird
dagegen der Name benutzer-virtual-machine vorgegeben.
Optional können Daten im Home-Verzeichnis verschlüsselt werden.
Während man das Ende der Installation abwartet, kann man nun noch
einige Tipps zu Ubuntu ansehen.
Laufender Betrieb
Das System startet, gleichgültig ob Ubuntu oder Kubuntu, schnell.
Sofern kein automatisches Login konfiguriert wurde, muss man sich
anmelden, was unter Ubuntu mit gdm, unter Kubuntu mit kdm
geschieht. Danach wird der vollständige Desktop zügig aufgebaut.
Der Kernel wurde auf Linux 2.6.38.2 aktualisiert (siehe „Was Natty
antreibt: Ein Blick auf den Kernel von Ubuntu 11.04“, freiesMagazin
05/2011 [4]). Da
sich die folgenden Ausführungen ausschließlich auf den Desktop
beziehen, ist dies nur ein kleines Detail am Rande. Wie gewohnt hat
Root keinen direkten Zugang zum System. Zugang zum Root-Account ist
aber über das Kommando sudo vorhanden. Damit kann man jeden
beliebigen Befehl ausführen, nachdem man sein eigenes Passwort
eingegeben hat. Wenn man, nachdem man als Root eingeloggt ist, ein
Passwort vergibt, ist auch das direkte Einloggen als Root möglich.
Der GNOME-Desktop benötigt mit einem Terminalfenster ohne weitere
offene Programme etwa 350 MB, nachdem in der Vorversion noch 220 MB
gemessen wurden. Der Grund für diese Zunahme ist zum einen der
Daemon ubuntuone-syncd, der im Testsystem mehr Speicher frisst als
X11. Zum anderen ist auch
der zeitgeist-daemon hinzugekommen, der auf diesem System 21 MB
resident belegt. „Erschreckend“ ist, wie wenig dynamische
Bibliotheken dabei gemeinsam benutzt werden. So belegt
ubuntuone-syncd 45 MB resident, davon sind nur 11 MB dynamischen
Bibliotheken zuzuordnen. Hier wäre einmal ein Aufräumen überfällig.
Allerdings ist das Problem, von ubuntuone-syncd abgesehen, nicht
Ubuntu-spezifisch.
KDE benötigt etwa 430 MB, die Zunahme im Vergleich zum letzten Test
scheint aber auf Änderungen an der virtuellen Maschine zu beruhen,
wodurch X11 mehr Speicher belegt. Das zeigt wieder einmal, dass die
Angaben zum Speicherverbrauch nur Anhaltswerte darstellen, die sich
je nach Hardware erheblich unterscheiden können.
Unity
Die größte Neuerung im Desktop-Bereich ist zweifellos Unity, das
allerdings nicht als eigene Desktopumgebung gelten kann, sondern
lediglich als alternative Oberfläche für GNOME. Unity entstand als
Netbook-Oberfläche und feierte in der Netbook-Edition von Ubuntu
10.10 sein Debüt. Nach Differenzen zwischen Ubuntu und GNOME (GNOME 3
kam nach Ansicht von Ubuntu zu früh) wurde das Ziel ausgegeben,
Unity zur Standard-Oberfläche zu machen, und nach
zwischenzeitlichen Zweifeln [5]
auch erreicht. Aufgrund der Kontroversen, in die sich auch der
bekannte Buchautor Michael Kofler mit einer kritischen
Beurteilung einschaltete [6],
durfte man sehr gespannt sein, wie sich Unity mittlerweile anfühlt.
Unity beruht noch ganz auf GNOME 2 (2.32.1) und Compiz, aber ein
paar Komponenten von GNOME 3 sind enthalten: Die
Barrierefreiheitstechnologie gnome-orca, der Client für soziale
Netze Gwibber, das Online-Hilfeprogramm Yelp und interessanterweise
auch der Aktivitätsaufzeichnungsdienst Zeitgeist 0.7.1. Mit
Zeitgeist wird eine semantische Suche möglich; wo sie nutzbar ist,
bleibt aber unklar – in die normalen GNOME-Komponenten kann sie
noch nicht integriert sein.
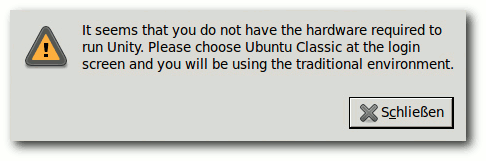
Fehlende Hardware-Voraussetzungen für Unity.
Unity benötigt derzeit 3-D-Beschleunigung in der Hardware, wohl weil
es als Compiz-Plug-in realisiert ist. Wo 3-D nicht verfügbar ist,
wird auf den klassischen GNOME-Desktop umgeschaltet. Dies kann man
auch von Hand einstellen, wenn man Unity nicht verwenden will.
Geplant ist aber, dass Unity künftig auch ohne 3-D auskommen soll.
Dieses „Unity 2-D“ ist jetzt schon auf der ARM-Netbook-Edition von
Ubuntu zu finden und wird wohl in Ubuntu 11.10 Standard. Das
klassische GNOME wird damit entfallen – eine logische Entscheidung,
da GNOME 2.x dann schon alt ist und nicht mehr gewartet wird. Die
Weiterentwicklung von Unity wird also auf GNOME 3 aufsetzen (müssen).
Vorweg sollen zwei wesentliche Komponenten, der Starter und die
Schnellauswahl, erwähnt werden, damit die nachfolgenden
Ausführungen klarer werden. Der markante Starter, der am linken
Bildschirmrand eingeblendet wird, dient hauptsächlich zum schnellen
Starten von Programmen. Durch Klick auf das Ubuntu-Symbol oben wird
die Schnellauswahl (Dash) gestartet, mit der man nach Anwendungen
suchen oder sich durch Kategorien klicken kann. Bei der Dash
handelt es sich im Prinzip um einen Browser, doch leider kann sie
nicht als solcher bedient werden. So fehlt eine einfache
Möglichkeit, eine Ebene zurück zu gehen und beim Überfahren eines Icons mit dem Mauszeiger wäre es
sinnvoll, Informationen dazu anzuzeigen, so wie es Dateimanager
üblicherweise schon machen. Aber vielleicht kommt das alles noch.
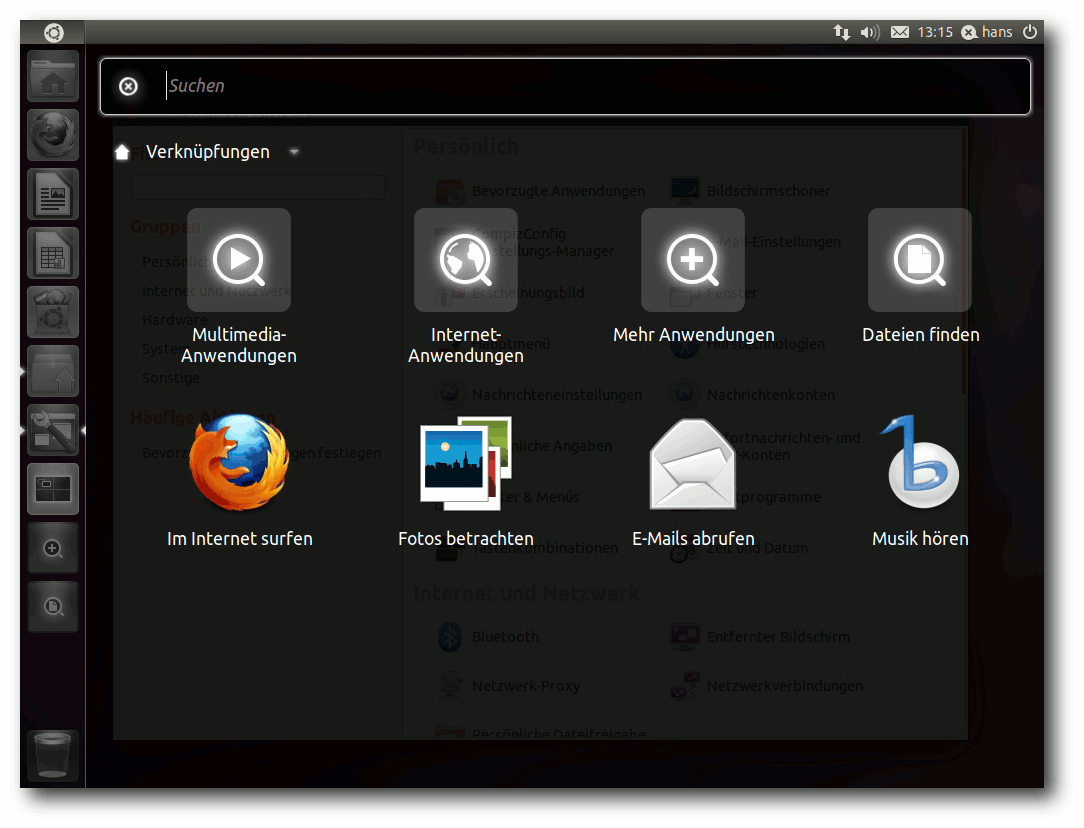
Die Schnellauswahl (Dash).
Um herauszufinden, wie sich Unity anfühlt und warum es kritisiert
wurde, wurde überlegt, welche Aktionen man üblicherweise auf dem
Desktop ausführt, um Anwendungen zu starten oder zu organisieren.
Normalerweise setze ich KDE4 ein und arbeite hauptsächlich in
mehreren Firefox-Fenstern mit einer größeren Anzahl von Tabs, einer
Menge von Konsolen-Fenstern, ebenfalls mit zahlreichen Tabs, und
Editoren. Die meisten Aufgaben sind auf der Kommandozeile weit
schneller als durch Herumklicken auf einer wie auch immer gearteten
Oberfläche zu erledigen, wenn man nur einigermaßen mit den
Kommandos und der Shell vertraut ist. Sicher hat diese Arbeitsweise
dabei aber keine Allgemeingültigkeit.
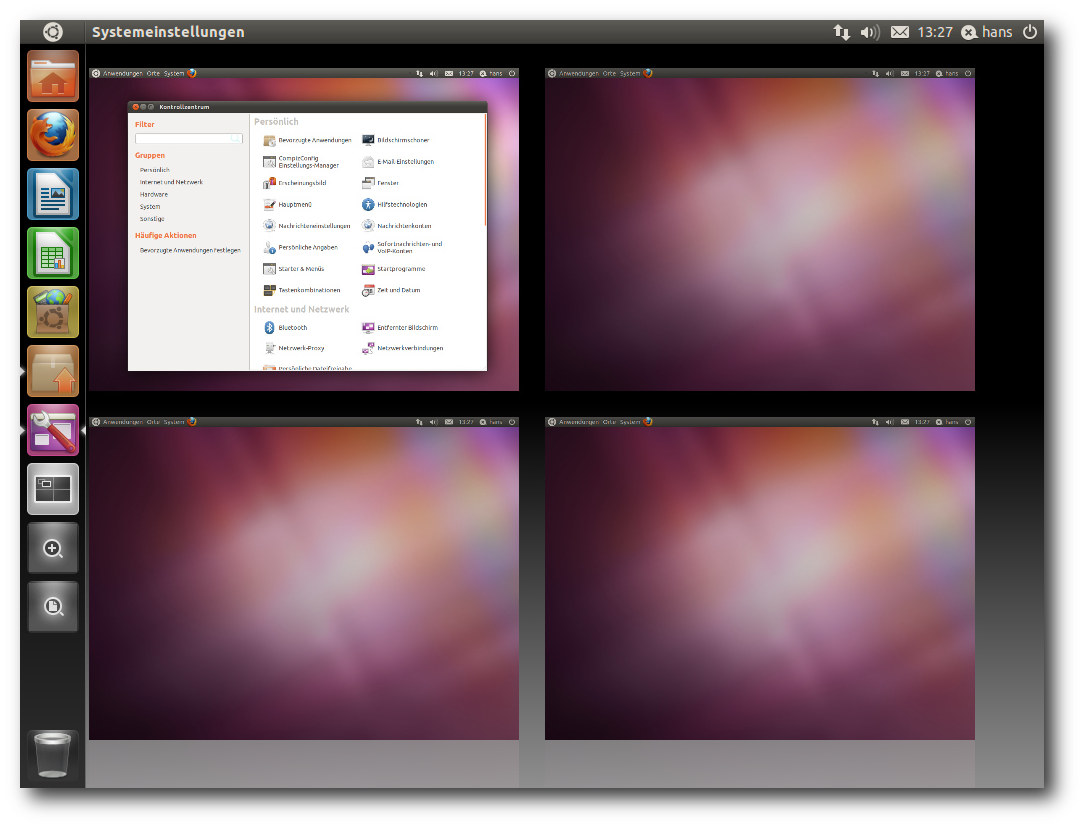
Der Arbeitsflächenumschalter.
Die Fenster werden bei mir in vier virtuellen Desktops organisiert,
sodass das Umschalten zwischen den Arbeitsflächen zu den
häufigsten Tätigkeiten gehört. Zufällig enthält Unity standardmäßig
ebenfalls vier Arbeitsflächen, die allerdings im Quadrat angeordnet
sind. Das
Wechseln zwischen diesen ist über den im Starter
vorhandenen Pager möglich. Klickt man diesen, sieht man die
Arbeitsflächen in einer Übersicht und kann durch Doppelklick zu
einer davon wechseln. Es ist klar, dass das zu umständlich ist.
Glücklicherweise kann man Kurztasten definieren, mit denen man
direkt zu einem der Arbeitsflächen gelangt. Diese wurden auf
auf „Strg“ + „F1“ bis „Strg“ + „F4“ gelegt wie bei KDE. Das Umschalten
mittels dieser Tasten ist dann mit einer kurzen Animation
verbunden. Es wäre sinnvoll, wenn diese Tasten standardmäßig
definiert wären; es gibt zwar zahlreiche vordefinierte Tasten, doch
genau diese fehlten.
Das Starten von Programmen per Tastatur ist mit „Alt“ + „F2“ möglich. Das
ist die schnellste und oft bevorzugte Methode auch unter KDE.
Kennt man den Namen des Programms nicht genau, kann man die
Programmauswahl öffnen, welche installierte Programme anzeigt. Über
das Suchfeld findet man schnell das Gewünschte. Gestartet wird das
Programm dann mit einem Einzelklick. Leider ist das inkonsistent,
da die meisten Aktionen ansonsten einen Doppelklick erfordern, so
wie es üblicherweise in GNOME Classic eingestellt ist.
Nicht nur Programme, sondern auch Ordner, die man dann in Nautilus
öffnet, kann man auf diese Weise suchen. Generell scheint
Unity stark auf das Suchen und weniger auf das Durchstöbern von
Verzeichnishierarchien ausgerichtet zu sein. Dies ist eine durchaus
praktische Neuerung, die wohl durch das Webbrowsen inspiriert wurde
(die meisten Webseiten erreicht man, indem man danach sucht).
Anwendungen lassen sich natürlich auch mit dem Starter starten; sie
lassen sich ebenso aus dem Starter entfernen (durch Rechtsklick aus dem
Kontextmenü oder durch Ziehen auf den Mülleimer), außer dem
Arbeitsflächenumschalter und dem Mülleimer. Das Hinzufügen funktioniert durch
das Ziehen aus dem Dashboard oder indem man eine bereits gestartete
Anwendung, deren Icon im Starter erscheint, per Kontextmenü dort
fixiert.
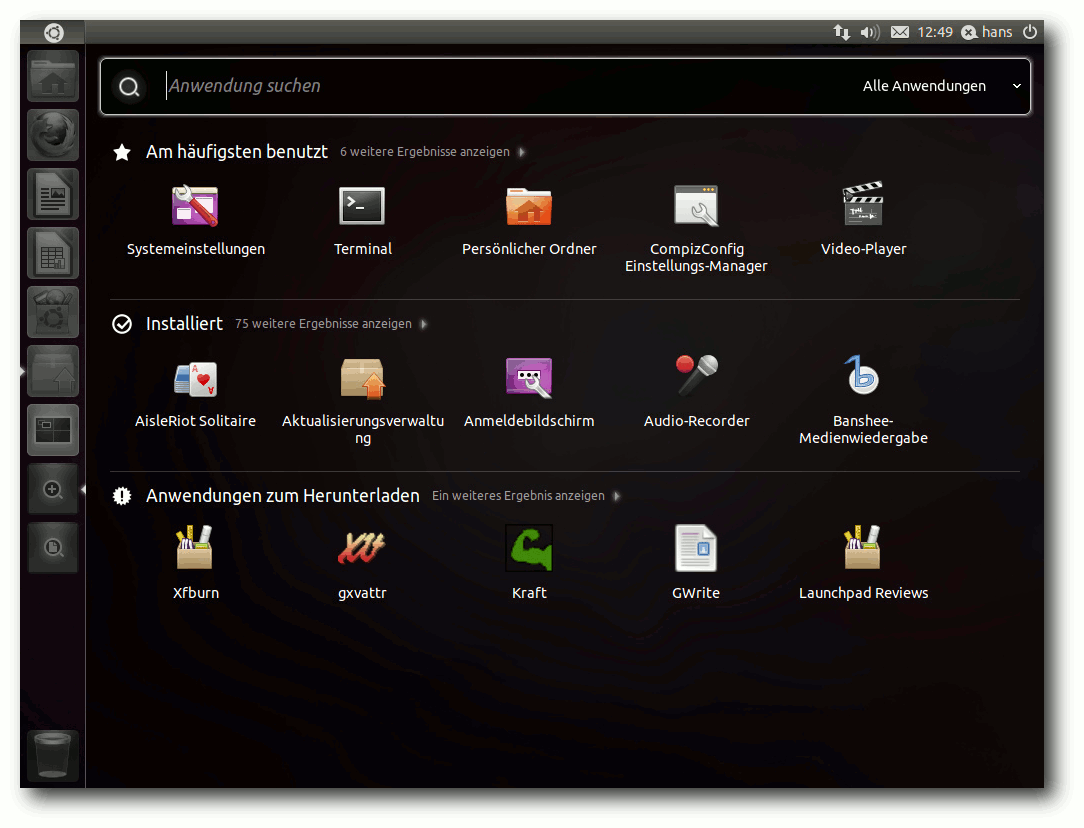
Die Programmauswahl.
Unity enthält auch Vertrautes: Ein Klick in ein Fenster bringt es in
den Vordergrund; „Alt“ + „Tab“ erlaubt Wechsel zwischen Fenstern,
allerdings zeigt es nicht den Namen der Anwendung an, was das
Finden der richtigen Anwendung schwierig machen kann. Auch
Copy & Paste funktionieren wie erwartet.
Eine weitere, ziemlich kontroverse Neuerung von Unity ist, dass die
Menüleiste von Anwendungen grundsätzlich im Panel am oberen
Bildschirmrand erscheint. Das heißt, immer das Menü der gerade
aktiven Anwendung erscheint dort, die anderen sind nicht sichtbar
und belegen damit keinen Platz. Der Vorteil der Platzersparnis ist
offensichtlich, die große Entfernung zwischen Anwendungsfenster und
Menü, die sich auf großen Bildschirmen ergeben kann, ist allerdings
sicher ein Nachteil. Ändern kann man es leider momentan nicht. Eine
kleine Änderung könnte hier schon einen guten Kompromiss ergeben:
Nur bei maximierten Anwendungen sollte die Menüleiste im Panel
erscheinen. Noch besser wäre es allerdings, dies konfigurierbar zu
machen, wobei eine globale Einstellung noch einmal fensterspezifisch
änderbar sein sollte.
In Kombination mit dem Starter ergibt die Anordnung der
Fensterknöpfe links, die zu den strittigsten Neuerungen in Ubuntu
10.04 LTS gehörte, mehr Sinn, da damit der Weg des Mauszeigers vom
und zum Starter kürzer ist. Ob man sich daran gewöhnen kann oder
will, ist eine andere Frage. Wer es nicht will, kann immer noch ein
anderes Theme auswählen, das die Buttons rechts belässt.
Nicht Unity-spezifisch ist eine weitere Neuerung in Ubuntu 11.04:
GNOME-Programme verwenden nun einen Scrollbalken, der weniger
Platz [7]
benötigt. Effektiv ist der Scrollbalken nur noch durch
eine schmale Linie angedeutet und erst wenn man den Mauszeiger in
dessen Nähe bewegt, wird der eigentliche Scrollbalken eingeblendet,
je nach Platz innerhalb oder außerhalb des Fensters. Das spart
Platz und funktioniert gut. Aber auch das wird nicht jedermanns
Geschmack sein und ist auf großen Bildschirmen eher unnötig. Es
sollte daher eine Option geben, die alten Scrollbalken wieder
herzustellen.
Das wäre schon im Rahmen der Barrierefreiheit
notwendig. Es ist geradezu grotesk, dass man sich auf der einen
Seite der Barrierefreiheit annimmt und dann gleichzeitig ein neues,
für manche Benutzer schwer bedienbares Element einführt, das sich
nicht einmal abschalten lässt. Der neue Scrollbalken ist übrigens
auf reine GTK+-Programme beschränkt und einige Programme, die nicht
in diese Kategorie fallen, z. B. Firefox und Programme, die mit
wxWidgets geschrieben sind, zeigen weiterhin den alten
Scrollbalken. Zudem wurden einige Anwendungen per Schwarzer
Liste [8] von
dem neuen Design ausgeschlossen.
Wenn man eine Anwendung maximiert, blendet sich der Starter aus.
Durch Anfahren des linken Bildschirmrandes wird er wieder
eingeblendet. Das Verschieben von Fenstern auf eine
andere
Arbeitsfläche funktioniert, wie bei KDE, über das Fenstermenü. Die Option
„Fenster aktivieren, wenn sich die Maus darüber befindet“, die es
im GNOME-Kontrollzentrum gibt, sollte man ausgeschaltet lassen, da
sie nicht korrekt mit Unity zusammenarbeitet. So wird, wenn eine
Anwendung maximiert ist, immer deren Menü angezeigt, selbst wenn
eine andere, nicht maximierte Anwendung aktiv ist. Denn die
maximierte Anwendung wird ja aktiv, wenn man mit dem Mauszeiger zur
Menüleiste fährt. Das wäre ein weiteres Argument für den obigen
Vorschlag, das Anwendungsmenü nur bei maximierten Anwendungen im
Panel anzuzeigen.
Hat man viele Anwendungen in den Starter eingetragen oder gestartet,
werden die Icons schräg gestellt (Ziehharmonika-Effekt). Das ist
ein pfiffiger Effekt, aber das Scrollen, das teilweise langsam ist,
wird damit nicht ganz vermieden. Alternativen wären kleinere Icons
oder die Darstellung in zwei oder mehr Spalten. Kleinere Icons
lassen sich über CompizConfig einstellen.
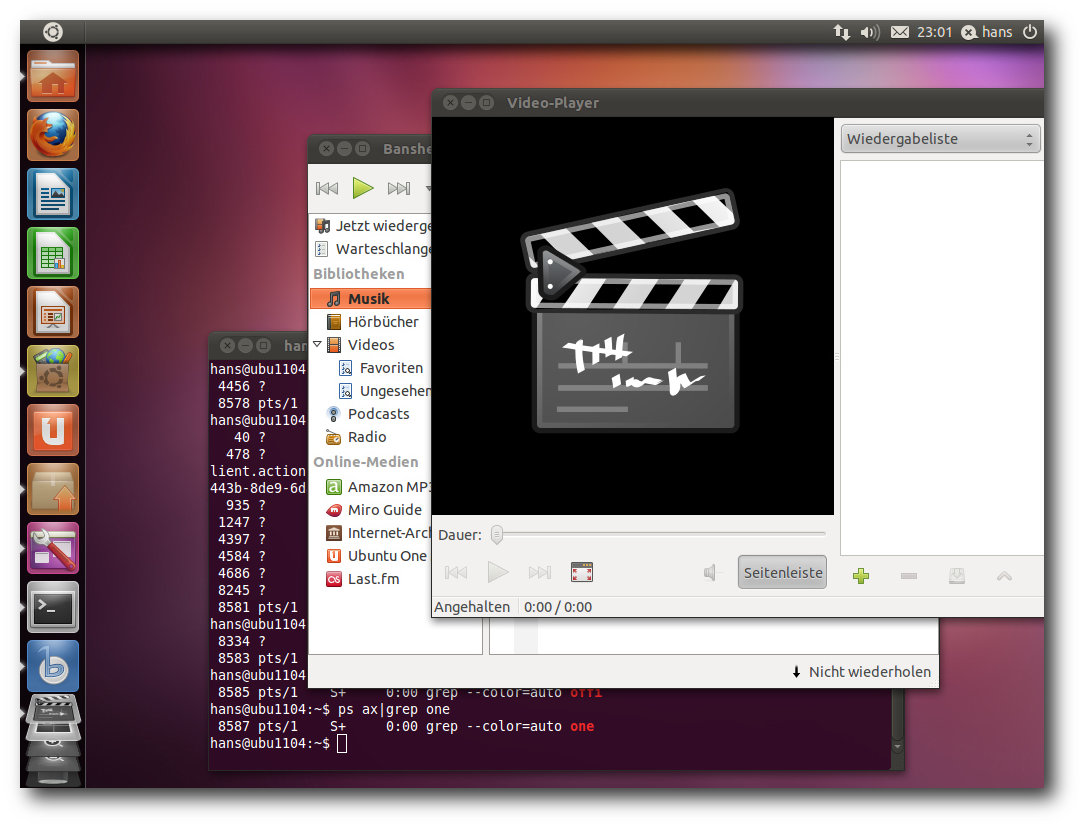
Ein Starter mit vielen Icons.
Damit nun (endlich) zum Thema Konfiguration. Standardmäßig
mitgeliefert wird das GNOME-Kontrollzentrum, dessen Punkte unter
GNOME Classic auch im Menü „System“ zu finden sind. Viele Aspekte,
auch von Unity, sind über CompizConfig änderbar. Ärgerlicherweise
ist dieses Programm aber nicht vorinstalliert. Man sollte es daher
gleich installieren; es verbirgt sich im Software-Center hinter
„Einstellungen für erweiterte Arbeitsoberflächeneffekte (ccsm)“.
Damit lassen sich einige, aber noch nicht alle Aspekte von Unity
anpassen. Beispielsweise muss man den Starter auf der linken
Bildschirmseite belassen.
Kritik von Michael Kofler
Im Artikel von Michael Kofler [6]
wurden eine Reihe von Dingen an Unity kritisiert. Die genannte
„übertriebene Platzoptimierung“ kann man durchaus nachvollziehen,
wenn man z. B. das Erscheinen des Menüs von Anwendungen im globalen
Panel betrachtet. Wie schon geschrieben, wäre es optimal, wenn das
Menü nur bei den maximierten Anwendungen ins Panel gesetzt werden
würde. Das genaue Verhalten sollte über Optionen fein
einstellbar sein.
Das „Zielgruppenproblem“ sehe ich weniger. Ubuntu richtet sich, auch
nach den jüngsten Äußerungen von Marketing Manager Gerry
Carr [9],
immer noch überwiegend an Umsteigewillige aus dem Windows-Lager.
Damit ist die Aussage von Herrn Kofler entkräftet. Natürlich nutzen
auch viele andere Anwender Ubuntu, wie Herr Kofler bestätigt; das
eine schließt das andere nicht aus, zumal es für die meisten
Benutzer keinen Grund gibt, von Ubuntu weg zu wechseln.
Es folgt ein Blick auf die konkret aufgeführten Kritikpunkte von
Michael Kofler:
- „Das Unity-Dock befindet sich am linken Bildschirmrand. Wer das
Dock lieber rechts, unten oder oben hätte – Pech gehabt.“
Korrekt, aber zumindest ist derzeit eine Konfigurationsmöglichkeit
vorgesehen, nur funktioniert sie nicht.
- „Die Größe der Icons ist fix vorgegeben (kann mit CCSM verändert
werden).“
Da sie geändert werden kann, existiert das Problem gar nicht.
- „Fenster sind von Schatten umgeben. Das sieht gut aus – es sei
denn, man will Screenshots erstellen. Früher ließ sich der Schatten
mit dem CCSM einstellen – jetzt nicht mehr (siehe Launchpad).
(Abhilfe: Erstellen Sie Ihre Screenshots mit Shutter!)“
Der Schatten lässt sich sehr wohl einstellen. Leider fehlt ein
einfacher Ein-/Aus-Schalter. Mit den vorhandenen Einstellungen kann
man aber den Schatten unsichtbar machen.
- „Im Launcher (also im Startmenü) befinden sich außer dem Suchmenü
gerade einmal acht Icons (auch wenn der Bildschirm 1920×1600 Pixel
groß ist). Die Icons sind fix vorkonfiguriert. Die Folge: Ich
arbeite mittlerweile vollkommen ohne Startmenü. Häufig benötigte
Programme sind im Dock, den Rest starte ich mit „Alt“ + „F2“.“
Bis auf die Anwendungs- und Ordnerauswahl und den Mülleimer lassen
sich alle Icons austauschen.
- „Unter Unity gibt es ein Zentralmenü im Panel (nicht mehr in der
Leiste des jeweiligen Fensters). Auf kleinen Bildschirmen spart das
Platz, auf großen Bildschirmen macht es die Bedienung des Menüs
aber extrem umständlich. Auch hier keine Wahlmöglichkeit.“
Sehe ich genauso, wie oben schon erläutert.
- „Der Arbeitsflächenumschalter ist fixer Bestandteil des Docks – ganz
egal, ob man Arbeitsflächen verwenden möchten oder nicht. (Und
gerade Einsteiger, für die Unity ja anscheinend konzipiert wurde,
werden Arbeitsflächen anfänglich wohl eher nicht brauchen.)“
Das ist zum einen Ansichtssache; Ubuntu ist der Ansicht, dass seine
Zielgruppe – die Windows-Umsteiger – mehrere Arbeitsflächen
verwenden möchten. Außerdem verschwindet der
Arbeitsflächen-Umschalter nach einem Neustart, wenn man über die
Compiz-Einstellungen die virtuelle Größe des Desktops auf 1x1
gesetzt hat.
Den Kritikpunkten von Herrn Kofler kann ich mich insgesamt
anschließen. Allerdings hat er eine Betaversion getestet. In
der offiziellen Version wurden offensichtlich eine Menge Probleme
behoben, so dass aus obiger Liste nicht mehr viel übrig bleibt.
Als vorläufiges Fazit kann man festhalten: Unity enthält gute Ideen
und ist keinesfalls unbenutzbar – auch auf großen Bildschirmen
nicht. Mit mehr Optionen wäre es aber wesentlich besser. Die
Schlussfolgerung ist für mich aber eine andere als für Herrn
Kofler. Wer Verbesserungen in Unity sehen will, sollte darauf
drängen, dass sie auch passieren, selbst Patches schreiben oder das
Projekt forken. Fürs Erste kann man, wenn man von Unity genervt
ist, auf GNOME Classic umschalten. In der nächsten Ubuntu-Version
sollte man Unity aber auf jeden Fall eine erneute Chance geben.
GNOME-Desktop
Wenn man Unity und die Scrollbalken ausnimmt, bringt erstmals seit
Bestehen von Ubuntu eine neue Version keine wesentlichen Änderungen
im GNOME-Desktop, denn die GNOME-Version blieb 2.32 (genaugenommen
2.32.1). Im Umfeld gab es dennoch, wie nach den turbulenten
Entwicklungen der letzten sechs Monate zu erwarten war, zahlreiche
Änderungen.
Als Webbrowser wird jetzt Firefox 4 eingesetzt. Das
Standard-Office-Paket änderte sich zu LibreOffice 3.3.2.
Banshee 2.0.0 wurde der Standard-Musik-Player anstelle von
Rhythmbox. Der X-Server 1.10.1 und Mesa 7.10.2 bilden die Basis für
die grafische Oberfläche einschließlich der 3-D-Beschleunigung.
Der Online-Dienst Ubuntu One ermöglicht über sein Steuerfeld jetzt
das selektive Synchronisieren und die Synchronisation von Dateien
soll schneller vonstatten gehen. Das Software Center ermöglicht es
nun, installierte Anwendungen zu bewerten, auch in Form von
Anmerkungen, und hat weitere Verbesserungen in der Benutzbarkeit
erhalten. Bewertungen zu einem Paket kann man nur abgeben, wenn man
es installiert hat.
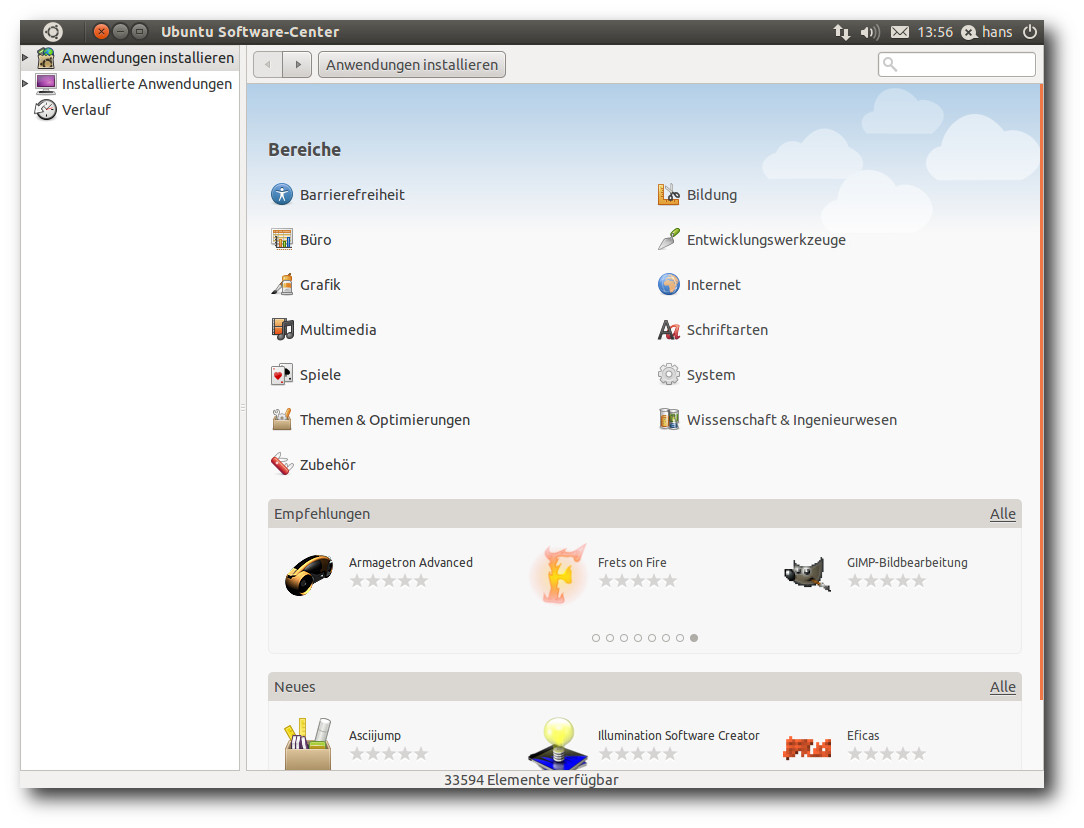
Ubuntu Software Center mit Bewertungen, Empfehlungen und Neuheiten.
KDE-Desktop
Kubuntu [10] nutzt KDE SC
4.6.2, das unter anderem ein Neudesign der Aktivitäten bringt.
Man kann nun Anwendungen und Dateien einer Aktivität zuordnen.
Wechselt man zu einer bestimmten Aktivität, sieht man nur noch
deren zugehörige Anwendungen. Das Konfigurieren von Aktivitäten
verursacht zunächst etwas Rätselraten, bis man darauf kommt, dass
bestimmte Stellen des Symbols anklickbar sind. Das könnte ein
Hinweis sein, dass das Ganze intuitiver zu bedienen ist, als man im
ersten Moment denkt.
Die Energieverwaltung wurde neu geschrieben und kann nun mit Plug-ins
erweitert werden. Mit dem neuen Richtlinien-Agenten kann man
Energieprofile definieren, die festlegen, wann Energiesparfeatures
aktiv sein sollen und wann nicht.
Der Window- und Compositing-Manager KWin wurde optimiert und kann
jetzt mehr Funktionalität der Grafiktreiber nutzen.
Benachrichtigungen von Programmen, die bisher bei der Taskleiste
eingeblendet wurden, können an eine beliebige Stelle verschoben
werden. GTK-Anwendungen passen sich optisch dank eines neu geschriebenen
Oxygen-GTK-Themes noch besser in die KDE-Umgebung ein.
Kubuntu bringt neu ein Modul zur Verwaltung von Samba-Shares
direkt aus dem Eigenschaftenmenü von Dolphin
und ein neues Sprachauswahl-Modul mit.
Die Druckerverwaltung wurde ebenfalls verbessert.

Definition von Aktivitäten in KDE.
Als Webbrowser kommt weiterhin rekonq zum Einsatz, jetzt in Version
0.7.0. Das Programm erinnert mit seinem auf einen einzelnen Button
reduzierten Menü entschieden an Chrome.
Mein „Lieblings“-Themenblock, um darauf einzuhacken, war in den letzten
Versionen stets KPackageKit. Das ist nun vorbei. In der neuesten
Version wurde eine Repository-Verwaltung hinzugefügt, sodass nun
alles, was man für die Paketverwaltung und Updates benötigt,
vorhanden ist. Zwar hätte man die Oberfläche, wie schon mehrfach
angemerkt, platzsparender gestalten können und möglicherweise ist
die Suchfunktion noch nicht ganz intuitiv, aber das Programm
versieht seinen Dienst einwandfrei.
Ansonsten bringt KDE ein neues Standard-Hintergrundbild mit. Die
Icons aus der letzten Version wurden beibehalten, was
Geschmackssache ist. Viele KDE-Anwendungen wurden natürlich auch
stark verbessert. Insgesamt hinterlässt KDE einen exzellenten
Eindruck.
Multimedia im Browser und auf dem Desktop
Firefox, jetzt in Version 4, bringt als eine große Neuerung
Unterstützung für WebM mit. Zahlreiche weitere Plug-ins zum
Abspielen von Videos in freien Formaten sind vorinstalliert.
Die vorinstallierte Erweiterung Ubuntu Firefox Modifications hat
Version 0.9 erreicht. Darin ist der bereits bekannte
Plug-in-Finder-Service enthalten. Will man beispielsweise ein Video
in einer Webseite abspielen, lassen sich komfortabel passende
Plug-ins finden und installieren. Das funktionierte im Test nicht
immer; wenn der Bildschirm schwarz blieb, konnte man aber die
Option „Im Video-Abspieler öffnen“ wählen. Dieser meldete dann, dass
ein Plug-in fehlte und bot eine Suche danach an. Ein passendes
Plug-in konnte dennoch nicht gefunden werden.
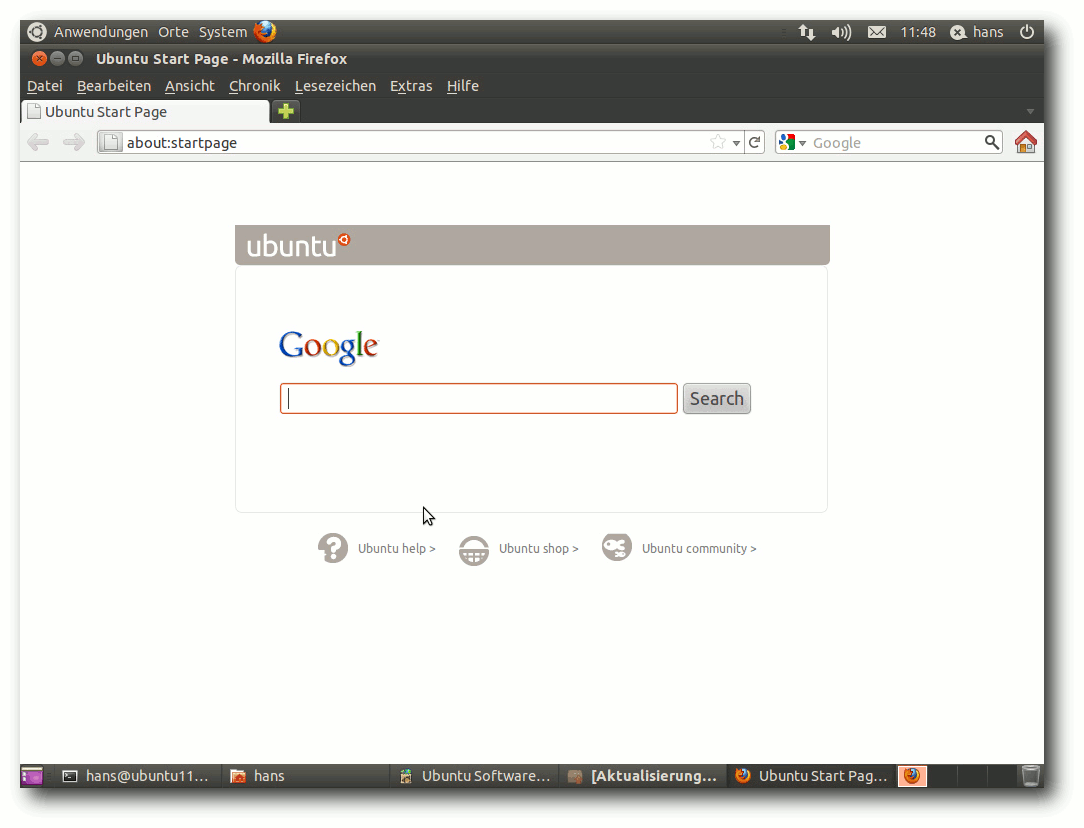
Startseite von Firefox.
Flash ist wiederum ein anderes Thema. In der 64-Bit-Version ist
klar, dass das Adobe-Flash-Plug-in nicht zur Verfügung steht. Warum
Ubuntu hier aber nicht das Gnash-Plug-in anbietet oder
vorinstalliert, ist rätselhaft, denn es funktioniert mit den
meisten Flash-Videos gut. So muss man es manuell aus dem Paket
browser-plugin-gnash installieren.
In den bekannten Anwendungen Banshee und Totem ließen sich
GStreamer-Plug-ins, die die standardmäßig nicht unterstützbaren
Formate kennen, wie gewohnt problemlos installieren. Fast jedes
Audio- und Video-Format ließ sich damit abspielen.
Unter KDE ist Amarok, jetzt in Version 2.4.0, der
Standard-Audioplayer. Anders als in der letzten Version lassen sich
MP3-Dateien nicht ohne Weiteres abspielen. Der Grund dafür ist der
Wechsel des KDE-Multimedia-Systems zu GStreamer als Phonon-Backend.
Amarok erkennt aber, dass ein Plug-in fehlt, startet die
Paketverwaltung, um danach zu suchen, und kann die benötigten
Module erfolgreich installieren.
Der Standard-Videoplayer ist Dragonplayer. Nachdem die
GStreamer-Module bereits durch Amarok installiert wurden, ließ sich
in dem Player alles abspielen, bis auf Flash-Videos. Die Ursache
konnte bisher nicht ermittelt werden, Gnash war jedenfalls
installiert. Im Dateimanager Dolphin fehlt weiterhin eine
Dateizuordnung von Dateien mit dem Suffix .flv. Insgesamt ist die
Multimedia-Integration sowohl in GNOME/Unity als auch in KDE recht
problemlos, aber Verbesserungen wären immer noch möglich.
Fazit
Ubuntu ist, wie es ist. Es besitzt Stärken und Schwächen, daran wird
sich auch nichts ändern. Auch Ubuntu 11.04 ist wieder eine sehr
solide Distribution. Lediglich ein größeres Problem ließ sich
finden, die Partitionierung als Btrfs-Partition. Für alle anderen
Dinge, die einen stören könnten, gibt es entweder Workarounds oder
es sind Kinderkrankheiten, die in den nächsten Wochen durch Updates
beseitigt werden. Wer sicher gehen will, sollte mit der
Installation einfach noch einige Wochen warten.
Unity wird ein ganz großer Wurf – wenn es einmal fertig ist. Das ist
in der aktuellen Version klar nicht der Fall. Unity in Ubuntu 11.04
ist ein Experiment, aber ein durchaus gelungenes, wenn man von
fehlenden Konfigurationsmöglichkeiten absieht. In der kommenden
Version könnte das ganz anders aussehen, denn dann wird Unity GNOME
2 als Basis verlassen und auf GNOME 3 portiert. Damit wird wohl
auch Compiz entfallen, außerdem wird Unity auch ohne
3-D-Beschleunigung funktionieren. Und wer weiß, vielleicht wird es
bereits eine erste Version von Wayland als Ersatz für X11 geben.
Einen Vergleich zu GNOME 3 kann noch nicht gezogen werden,
hierzu muss man erst das Ergebnis von Fedora 15 abwarten.
KDE galt lange als ziemlich vernachlässigt und Kubuntu nicht gerade
als erste Wahl für KDE-Anwender. Mittlerweile hat sich das
gewandelt. Natürlich wurde das Software Center nicht für KDE
entwickelt, aber wer möchte, kann es dennoch nutzen. Ob und wie
sich Ubuntu One unter KDE nutzen lässt, ist nicht bekannt.
Ubuntu will bekanntlich in erster Linie umstiegswillige
Windows-Anwender ansprechen. Das wird immer noch gerne mit
unerfahrenen Anwendern gleichgesetzt, doch davon kann keine Rede
sein. Ubuntu kann genauso auch von erfahrenen Linux-Anwendern
genutzt werden. Sowohl Ubuntu als auch Kubuntu sind in dieser
Version besonders gelungen und lassen für die Zukunft noch viel
Gutes erwarten.
Links
[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1506/ubuntu-1104.html
[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-11
[3] https://wiki.ubuntu.com/NattyNarwhal/ReleaseNotes
[4] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-05
[5] http://www.pro-linux.de/news/1/16923/unity-in-ubuntu-stabilisiert-sich.html
[6] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1504/unity-der-anfang-vom-ende-fuer-ubuntu.html
[7] http://www.pro-linux.de/news/1/16790/neues-scrollbar-design-fuer-ubuntu.html
[8] https://wiki.ubuntu.com/Ayatana/ScrollBars#Blacklist
[9] http://www.netzwelt.de/news/86520-gerry-carr-ubuntu-interview-konnten-gnome-3-warten.html
[10] http://kubuntu.org/news/11.04-release
| Autoreninformation |
| Hans-Joachim Baader (Webseite)
befasst sich seit 1993 mit Linux. 1994 schloss
er sein Informatikstudium erfolgreich ab, machte die
Softwareentwicklung zum Beruf und ist einer der Betreiber
von Pro-Linux.de.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mirko Lindner
Mit der Freigabe von GNOME 3 bricht der Entwicklerkreis rund um die
Desktopumgebung mit vielen gängigen Paradigmen der Benutzerführung
und präsentiert ein weitgehend überarbeitetes Produkt, das
zahlreiche Neuerungen mit sich bringt. Drei wesentliche Punkte sind in
die neue Generation der Umgebung eingegangen: eine Erneuerung der
Oberfläche, Entfernung von unnötigen Komponenten und eine bessere
Außendarstellung.
Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „GNOME 3.0: Bruch mit Paradigmen“ erschien
erstmals bei Pro-Linux [1].
Die Vergangenheit …
Die Desktopumgebung GNOME [2] glänzte in den
letzten Jahren nicht unbedingt durch radikale Änderungen und
Konzepte, die sich jenseits vom Altbewährten bewegten. Die
Oberfläche von GNOME wurde zwar sukzessive poliert und durch neue
Funktionen erweitert, einen Bruch mit Altbewährtem schaffte sie
trotzdem nicht. Die zentralen Komponenten der Umgebung datieren auf
den Anfang des Jahrhunderts, als mit GNOME 2 Schluss mit den
bestehenden Strukturen war.
Einen der Gründe für die Beständigkeit stellte GTK+ dar. Das Toolkit
bildet die Basis der grafischen Oberflächen von GNOME und vielen
weiteren Programmen. Trotz
einiger recht einschneidender Änderungen
wurde die Programmierschnittstelle seit der Version 2.0 kompatibel
gehalten, so dass ältere Programme quellcode- oder gar
binärkompatibel bleiben. Es erklangen allerdings zunehmend
Stimmen [3],
wonach die
Funktionalität von GTK+ nicht mehr für künftige
Entwicklungen ausreiche und das Team sich einer neuen Generation des
Toolkits widmen solle. Mit der Entscheidung, GTK+ radikal zu
erneuern,
wurde auch der Weg zu GNOME 3 geebnet. Herausgekommen ist
dabei eine Umgebung, die viele bekannte Strukturen begräbt und die
Anwender durch neue Konzepte zu überzeugen versucht.

Der Standarddesktop von GNOME 3.0 mit eingeblendeten Optionen für Barrierefreiheit.
… und die Zukunft
Mit der Freigabe von GNOME 3 verabschiedet sich die Umgebung von
vielen bekannten
Einrichtungen und präsentiert ein weitgehend neues
Arbeitsgefühl. Die Hauptkomponente der aktuellen Generation der
Umgebung stellt dabei die GNOME Shell [4]
dar. Diese fungiert als zentrale Stelle und ersetzt nicht nur das
bisherige Panel, sondern auch zahlreiche weitere Einrichtungen. Der
ganz in Schwarz gehaltene Bereich der GNOME Shell gliedert sich
dabei in drei verschiedene Bereiche.
Ganz rechts ist der Systembereich zu finden, unter dem die
Standardkomponenten zur Steuerung der Lautstärke, des Netzwerks
und der Barrierefreiheit sowie der Strom- und
Batteriestatus eingegliedert
wurden. Zudem beinhaltet der Bereich das Benutzermenü, das einen
Zugriff auf das Kontrollzentrum, die Konteneinstellungen oder die
Benutzersteuerung ermöglicht. Zudem kann hier der Anwender seinen
Status setzen und sich vom System abmelden.
Hier ist auch der erste Bruch zu sehen, denn standardmäßig
verzichtet GNOME der Einfachheit wegen auf eine Funktion zum
Herunterfahren und bietet nur den Punkt „Suspend“ zur Auswahl an.
Will der Anwender des System herunterfahren (Shutdown), muss er die
„Alt“-Taste drücken.
Ferner verzichtet GNOME 3.0 in diesem Bereich auch auf ein
dynamisches Panel, wie er noch in der alten Version Usus war. So
lassen sich hier weder Benachrichtigungen noch weitere Applets
einbinden. Eine spätere Integration ist auch nicht geplant.
Aktivitäten
Der zweite Bruch mit den herrschenden Gepflogenheiten findet sich
auf der linken Seite der GNOME-Shell-Leiste in Form eines
Aktivitäteneintrags. Ein Klick auf den Button, der Druck der
„Windows“-Taste, das Kommando „Alt“ + „F1“ oder das Bewegen der Maus in
die linke obere Ecke blenden einen Überblickmodus ein, der einen der
zentralen Bereiche der Umgebung ausmacht. In einer Exposé-ähnlichen
Ansicht finden die Anwender alle Informationen über laufende
Anwendungen. Auf der linken Seite des Bildschirms ist dabei der so
genannte „Dash“ – ein Bereich, der in einer Icon-Ansicht die
favorisierten und gerade ausgeführten Anwendungen auflistet. Bewegt
der Anwender die Maus über ein Icon, blendet die Shell weitere
Informationen ein. Ein Klick auf ein Icon bringt weitere Funktionen
zum Vorschein.
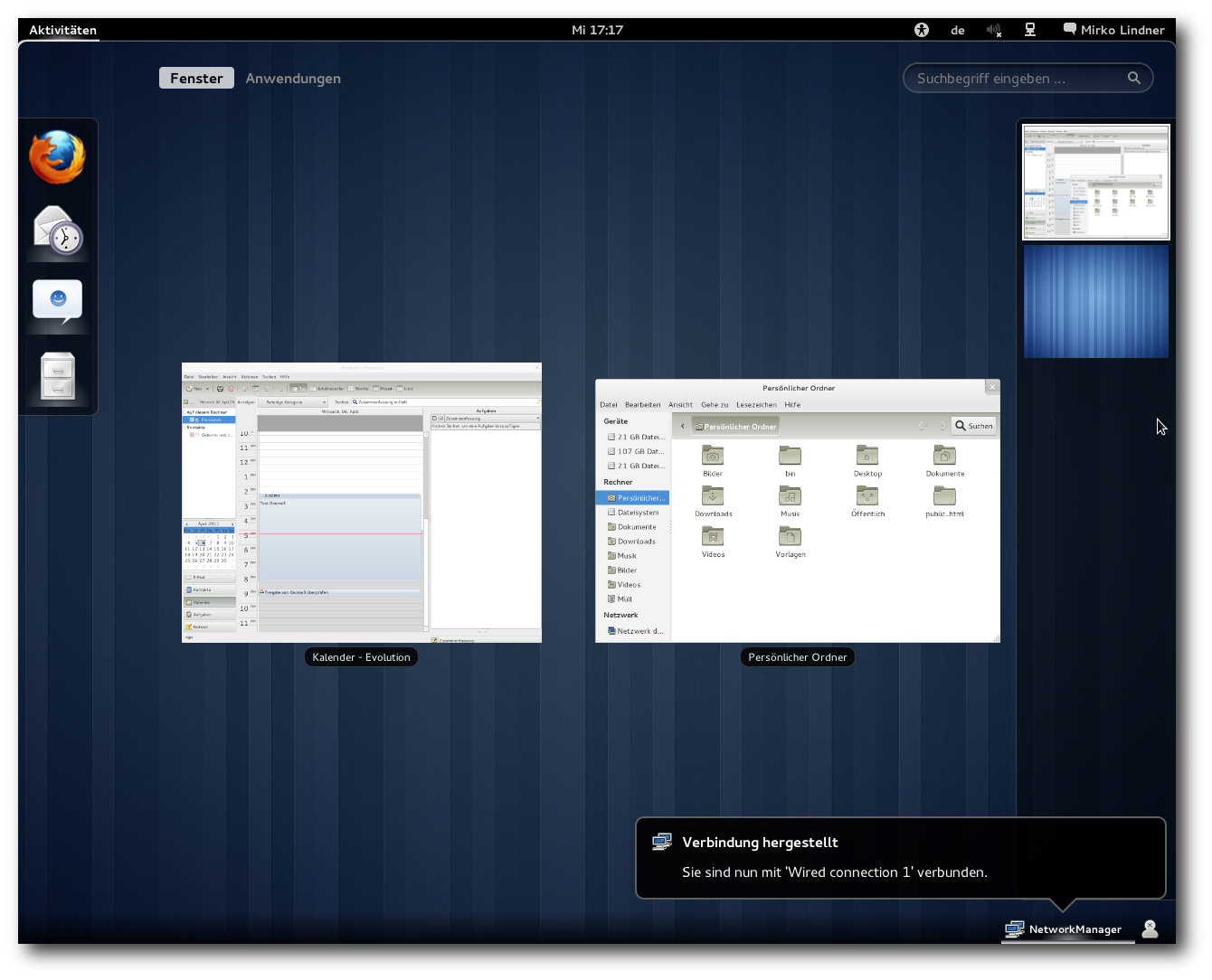
Die neue Übersicht blendet ausgeführte Applikationen ein.
Den Hauptbereich der Ansicht bildet die Übersicht über die laufenden
Anwendungen, wohingegen auf der rechten die momentanen Workspaces
angedeutet sind. So können Anwendungen zwischen verschiedenen
Workspaces verschoben werden, wobei GNOME 3 nicht mehr wirklich
zwischen Workspaces trennt und die Anzahl der Workspaces bei Bedarf
erweitert. Schiebt ein Anwender beispielsweise eine Applikation auf
ein leeres Workspace, wird ein neues leeres Workspace erstellt.
Schließt er
dagegen das letzte Fenster eines Workspaces, wird auch
der Bereich geschlossen. Ein Klick auf ein Workspace wechselt zu
diesem.
Eine Neuerung gegenüber GNOME 2 ist hier, dass die Anordnung der
Workspaces nicht mehr horizontal, sondern vertikal erfolgt. Das
Starten von neuen Anwendungen erfolgt wahlweise entweder durch eine
direkte Eingabe, durch einen Klick auf ein Applikationsicon oder
durch das „Verschieben“ eines Applikationsicons auf ein Workspace.
Die zwei letzten Möglichkeiten können wahlweise auf einer
Favoritenleiste oder auf einer Übersichtsseite erfolgen. Die
Applikationen werden dabei auch hier als Icons gelistet. Je mehr
Anwendungen installiert sind, desto kleiner werden die Icons der
Übersichtsseite. Hier kann der Anwender auch eine Sortierung nach
Kategorien durchführen.
Benachrichtigungen
Einen integralen Bestandteil von GNOME 3 stellt das
Benachrichtigungssystem dar, das nun im unteren Bereich des
Bildschirms angeordnet wurde. Das System unterscheidet zwischen
wichtigen und weniger wichtigen Mitteilungen und blendet sie je nach
Stufe unterschiedlich lange ein. Mehrere Meldungen einer Applikation
werden zu einem Eintrag zusammengefasst und in Form eines Icons
dargestellt. Dabei beschränkt sich das System auf die Ansicht der
wichtigsten Informationen. Erst wenn der Anwender mit der Maus über
einer Nachricht stehenbleibt, blendet die GNOME Shell weitere
Informationen ein. Ein Klick auf die Nachricht startet, sofern
vorhanden, die entsprechende Applikation.
Verpasst ein Anwender eine Nachricht, so reicht es, mit der Maus in
die untere rechte Ecke zu navigieren. Sofort blendet die Shell alle
Nachrichten, die das System erhalten hat, ein. Auch hier werden die
Ausgaben gruppiert dargestellt und können mittels eines Klicks
erweitert werden.
Fenstermanagement und das Aussehen
Für viel Wirbel sorgte im Vorfeld der Freigabe die Handhabung von
Fenstern. So verzichtet GNOME 3.0 auf die Maximieren- und
Minimieren-Buttons in der Leiste und stellt standardmäßig nur einen
Button zum Schließen des Fensters zur Verfügung. Das Maximieren
erfolgt entweder durch einen Doppelklick auf die Fensterleiste oder
durch das Ziehen des Fensters in den oberen Bereich des Bildschirms.
Wird ein Fenster dagegen an den linken oder rechten Bildschirmrand
gezogen, wird es ähnlich Windows, oder neuerdings auch KDE, auf die
Hälfte des Bildschirms angepasst. So lassen sich bequem
beispielsweise zwei Dokumente oder Bilder nebeneinander einblenden,
ohne dass eine manuelles Zentrieren notwendig wäre.
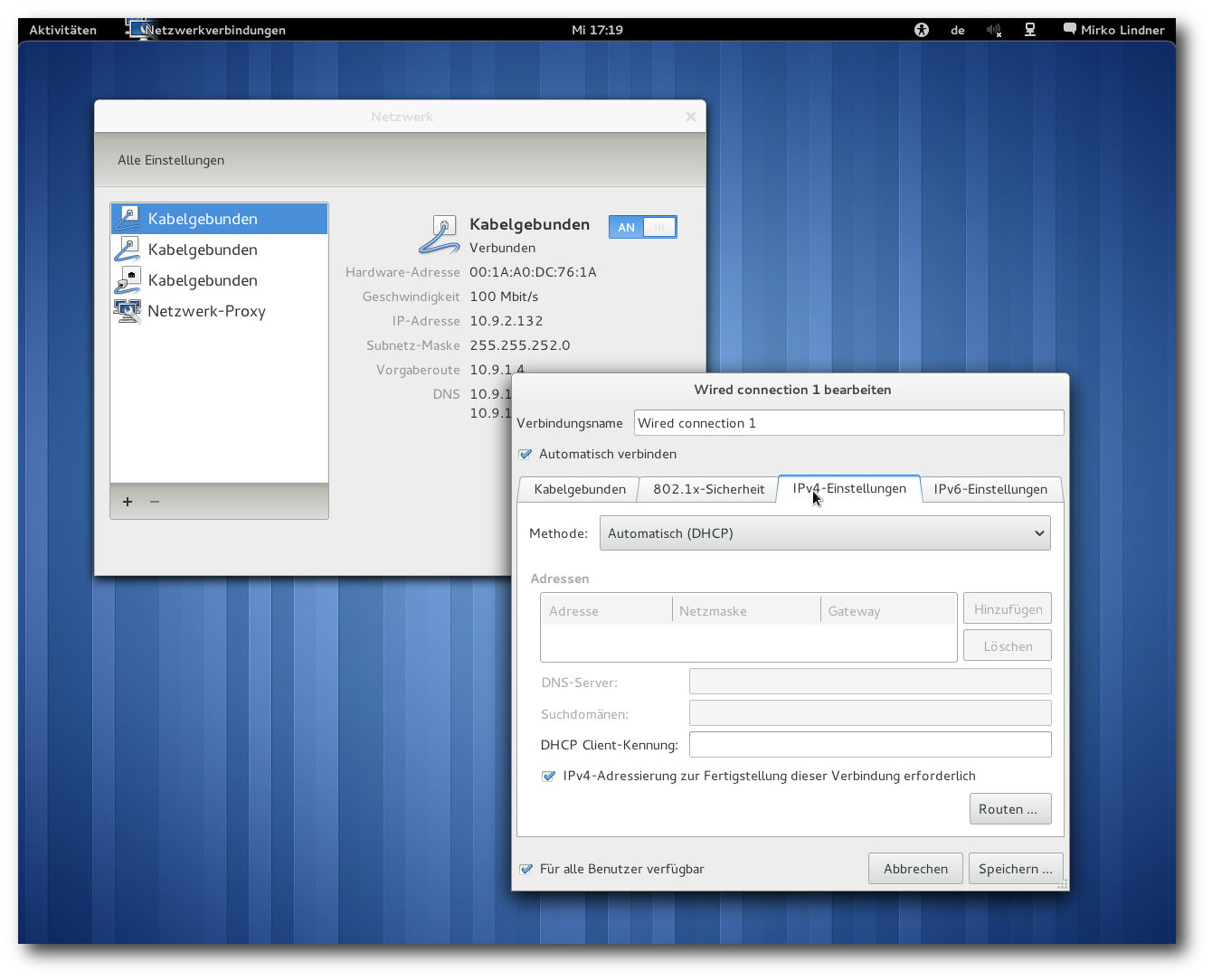
Fensterleisten in GNOME 3.0 beinhalten nur noch den Schließen-Knopf.
Das weitere zentrale Merkmal von GNOME 3.0 stellt das Umschalten von
Fenstern dar. Das System agiert in der neuen Version nicht mehr auf
Fenster-, sondern auf Applikationsebene. Konkret heißt das, dass
beim Betätigen der Tasten „Alt“ + „Tab“ mehrere geöffnete Fenster
derselben Anwendung gruppiert dargestellt werden. Erst die Auswahl
mittels der Maus oder Tastatur klappt ein Untermenü aus, aus dem ein
spezielles Fenster herausgepickt werden kann. In der täglichen
Arbeit erweist sich die Steuerung
allerdings als wenig glücklich.
Vor allem für Anwender, die viele Terminal-Fenster offen haben,
werden eine Weile brauchen, bis das passende ausgesucht wurde.
Einen besonderen Wert bei der Erstellung von GNOME 3 legten die
Programmierer auf das Aussehen der Umgebung. Das neue Desktop-Theme
kann vollständig über eine CSS-Syntax konfiguriert und an die
eigenen Wünsche angepasst werden. Als Teil der Philosophie der
Vereinfachung wurde auch die Darstellung von Icons auf dem Desktop
entfernt. Laut Aussage der Entwickler lassen sich Daten sowieso
schneller mittels der neuen Funktionen finden. Wer der Funktion
nachtrauert, kann sie aber wieder einschalten.
Den Preis der grafischen Pracht stellt allerdings die zwingende
Voraussetzung von 3-D-Funktionen in der Hardware dar. Wer ein System
sein eigen nennt, das über diese Funktionalität nicht verfügt oder
schlicht nicht in der Lage ist, die grafische Anzeige darzustellen,
muss auf einen Fallback-Modus von GNOME 3.0 zurückgreifen.
Weitere Neuerungen
Auch jenseits der GNOME Shell und des Windowmanagers Mutter bringt
GNOME 3.0
zahlreiche Neuerungen mit sich. So bricht GNOME 3
mit dem
alten Konzept der verteilten Konfiguration und bietet ein
vollständig neues Kontrollzentrum, das die wichtigsten Funktionen
unter einer Oberfläche vereint. Zudem wurden zahlreiche Anwendungen
an die neue Umgebung angepasst.
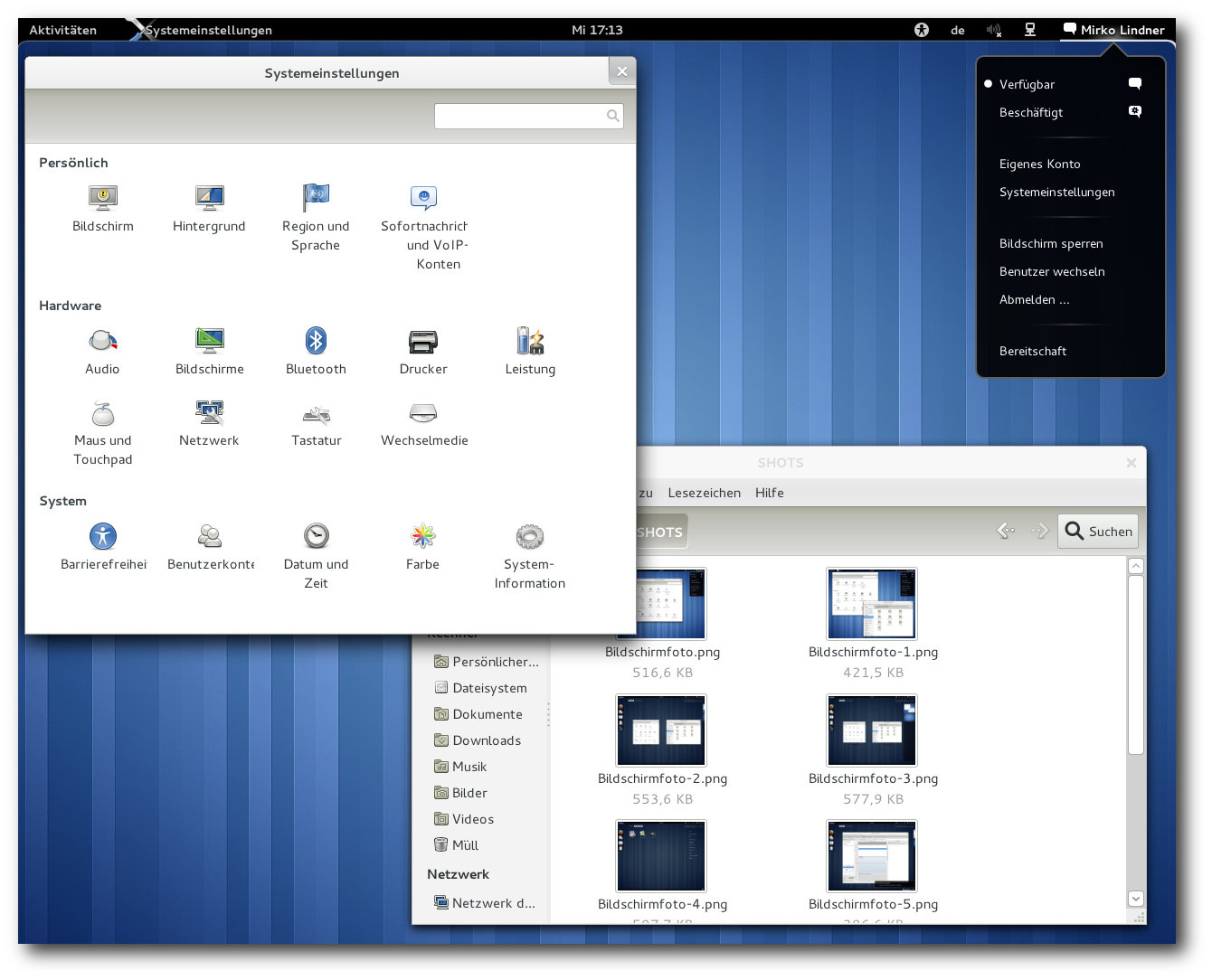
Das neue Kontrollzentrum und Benutzermenü.
So wurde der Instant Messenger Empathy [5]
stärker in die Umgebung integriert. Zusammen mit dem neuen
Benachrichtungungssystem erlaubt die Applikation eine erheblich
schnellere Kommunikation. Eingehende Meldungen werden nun im unteren
Bereich nicht nur eingeblendet, sondern können dort auch beantwortet
werden. Das Setzen des Status im Benutzermenü hat zudem auch eine
Auswirkung auf die Applikation. Zu den weiteren neuen Funktionen
gehören unter anderem das Blocken von Konten und das Speichern von
Passwörtern. Darüber hinaus können eingehende Anrufe automatisch
abgelehnt werden.
Bedingt durch die neue Arbeitsweise wurde auch der Dateimanager
Nautilus [6] stark überarbeitet.
Die in der Vergangenheit am oberen Rand angebrachte Kontrollleiste
ist nun verschwunden. Ein ähnliches Schicksal erlitt die
Statusleiste. Stattdessen nimmt nun die Navigationsleiste einen
größeren Stellwert ein. Statusmeldungen werden dagegen als Overlay
eingeblendet.
Ebenfalls auf die Statusleiste verzichten muss der Webbrowser
Epiphany [7]. Der Downloadmanager
der Applikation wurde dagegen massiv überarbeitet. Neu ist ebenfalls
die Gruppierung von Seiten. Außerdem wird nun das Orten per
Geolocation in Epiphany unterstützt.
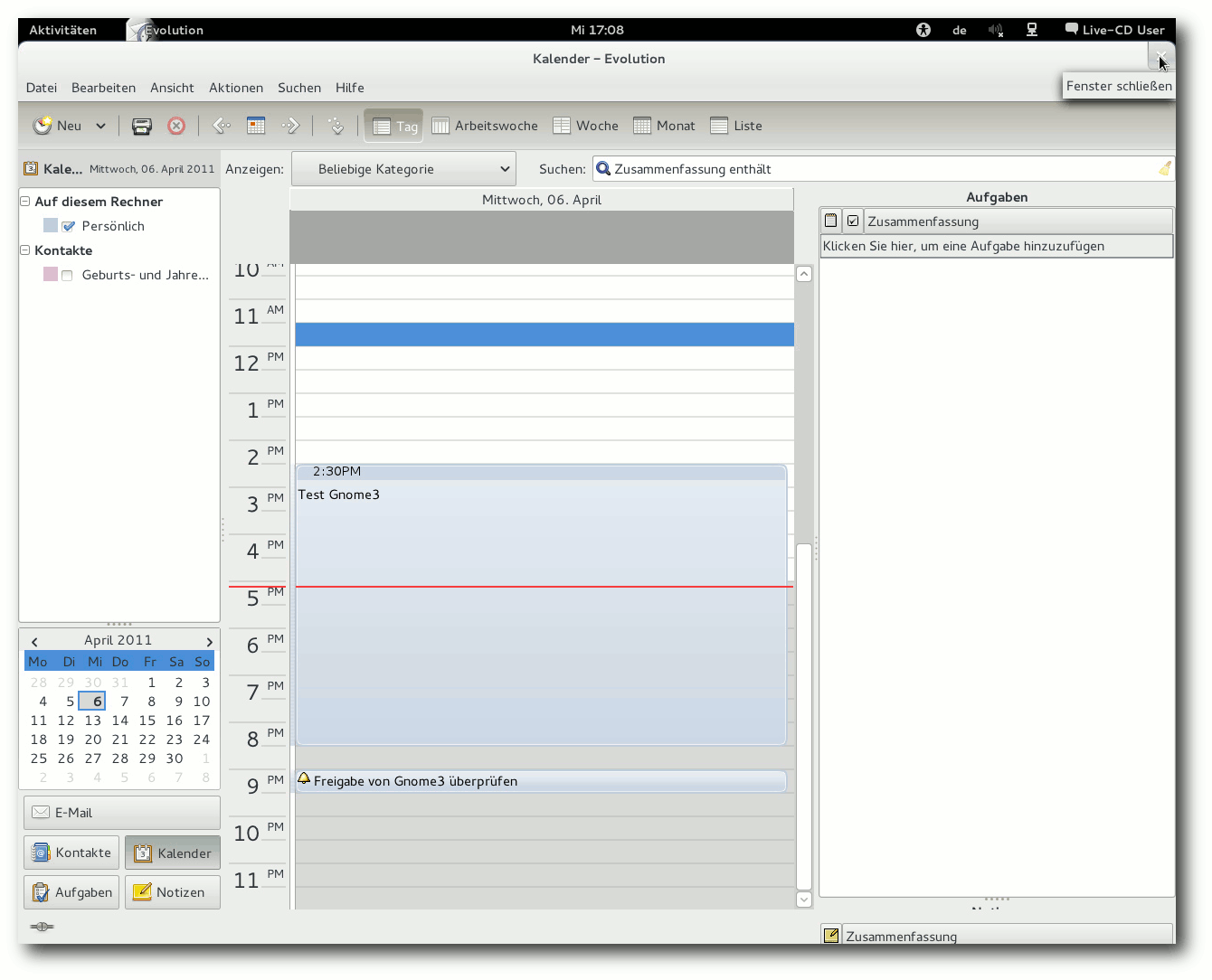
Evolution unter GNOME 3.0.
Des Weiteren haben die Entwickler die Hilfe der Umgebung komplett
umgekrempelt. Zu den weiteren Neuerungen in GNOME 3.0 gehören ferner
massive Überarbeitungen des Webcam-Tools Cheese.
GNOME 3.0 bringt zudem Verbesserungen für den Texteditor
gedit [8], wie beispielsweise eine
verbesserte Rechtschreibprüfung, vollständige Unterstützung für
komprimierte Dateien sowie die Möglichkeit, Dateien mit ungültigen
Zeichen zu bearbeiten. Die neue Version von gedit enthält weiterhin
eine neue Suchfunktion, welche die Sicht auf das bearbeitete
Dokument nicht einschränkt, und Reitergruppen erlauben das Anzeigen
mehrerer Dokumente gleichzeitig.
Auch Anjuta [9], die integrierte
Entwicklungsumgebung für GNOME, erhielt in Version 3.0 eine Reihe
von Verbesserungen. Zu den Neuerungen gehören unter anderem das
automatische Verbinden von Signalen mit Benutzeroberflächen,
verbesserte autotools- und pkg-config-Unterstützung und eine neue
Git-Unterstützung.
Der Unterbau
Die Implementierung von Mutter, GNOME Shell und die Änderung der
Arbeitsweise von GNOME stellen freilich nur die Spitze der in die
Umgebung eingeflossenen Arbeit dar. Das Gros der Arbeit machte die
Bereinigung der Umgebung aus. So haben sich die Entwickler dazu
durchgerungen, das alte Konfigurationssystem GConf durch eine
Kombination aus GSettings und DConf zu ersetzen. Dies hat zur Folge,
dass die Geschwindigkeit der Umgebung gesteigert werden konnte und
eine bessere Integration unter anderen Betriebssystemen ermöglicht
wird. Ganz entfallen wird GConf allerdings nicht, denn es existieren
durchaus noch Anwendungen, die auf die alte Lösung aufsetzen. Diese
anzupassen wird die Arbeit der kommenden Versionen sein.

Installierte Applikationen lassen sich einfach durchsuchen.
Ausgedient hat in GNOME 3 auch das Komponentensystem Bonobo, das nun
nicht mehr Bestandteil der Umgebung ist. Ferner haben die
Entwickler auch das virtuelle Dateisystem
gnome-vfs und die
Interface-Bibliothek libglade entsorgt. Daran glauben musste auch
libgnomeui.
Statt dessen setzen die Entwickler nun auf Clutter, dessen Entwicklung von Intel gesponsort wird.
Clutter stellt ein freies Toolkit dar, mit dem sich Fenster
und Bedienelemente erstellen lassen. Anders als die meisten anderen
Toolkits verwendet es allerdings OpenGL und optional OpenGL ES,
wobei sich die Entwickler nicht mit der Komplexität der
Grafikbibliotheken auseinandersetzen müssen.
Die zweite integrale Bibliothek stellt GTK+ 3.0 dar. Die neue
Version enthält eine große Zahl von Änderungen. Die Grafikausgabe
erfolgt nun durchweg über die Bibliothek Cairo, die im Gegensatz zu
GDK nicht nur für X11 verwendbar ist, sondern auch Grafikausgabe auf
Mac OS X, Windows, OpenGL, PostScript, PDF, SVG und Speicherbereiche
ermöglicht. Die Auswahl des Ziels der Grafikoperation kann zudem zur
Laufzeit erfolgen. Eingabegeräte werden nun auf moderne Weise
behandelt. Unter X11 äußert sich das in der Verwendung von X Input 2.
Eine beliebige Anzahl von Zeigergeräten, Tastaturen und anderen
Geräten wird nun unterstützt. Ein neues Theme-API mit CSS-Syntax
sorgt zudem für mehr Flexibilität beim Aussehen der Fenster und
Grafikelemente. Auch die Geometrieverwaltung wurde flexibler. Neue
Widgets und Tools wurden hinzugefügt. Anwendungen haben es leichter,
sich in die Plattform zu integrieren, und können über die Klasse
GtkApplication automatisch an D-Bus angebunden werden.
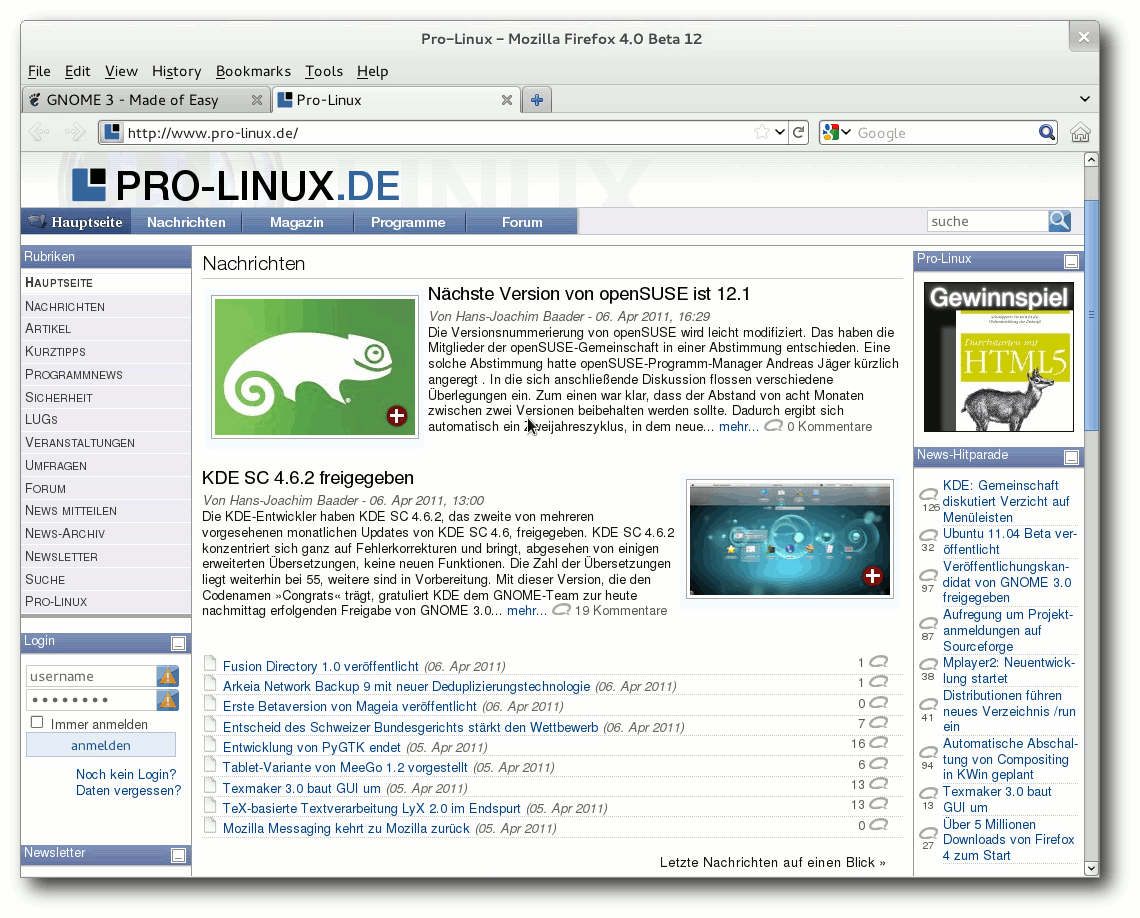
Firefox unter GNOME 3.0.
Fazit
Mit GNOME 3.0 liefert das Team der freien Desktopumgebung
zweifelsohne eine revolutionäre Arbeit ab. Die Umgebung wurde nicht
nur massiv überarbeitet, sondern bricht förmlich mit vielen
bekannten Paradigmen der Benutzerführung. Vor allem die Aktivitäten
bieten einen enormen Aha-Effekt, der durch eine sehr ansprechende
grafische Funktionalität überzeugen kann. Hinzu kommt noch ein
elegantes Aussehen und eine Führung, bei der sofort die klare Linie
der Vereinfachung der Benutzung ins Auge fällt.
Auf der anderen Seite unterscheidet sich die Benutzerführung der
aktuellen Generation maßgeblich von der Umgebung anderer Produkte.
Der Bruch wird vor allem Traditionalisten wenig gefallen. Der
Verzicht auf eine Taskleiste, der veränderte Start von Applikationen
oder die strikte Festlegung auf eine Anordnung der oberen Leiste
werden sicherlich nicht alle Geschmäcker treffen. Vieles lässt sich
an die eigenen Wünsche anpassen, doch allein die Tatsache, dass es
standardmäßig „so oder anders“ gehandhabt wird, könnte manch einen
Anwender vergraulen. Fakt ist aber auch, dass man dem neuen Konzept
auf jeden Fall Zeit geben sollte. Nicht alles, was neu ist, muss
schlecht sein.
GNOME 3.0 [10]
kann ab sofort im Quellcode von der Seite des Projektes heruntergeladen
werden [11]. Zum Kompilieren kann man
jhbuild verwenden. Binärpakete werden von verschiedenen Distributoren
bereitgestellt.
Links
[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1501/gnome-30-bruch-mit-paradigmen.html
[2] http://www.gnome.org/
[3] http://www.pro-linux.de/news/1/11573/nokia-will-gtk-30.html
[4] http://live.gnome.org/GnomeShell
[5] http://live.gnome.org/Empathy
[6] http://live.gnome.org/Nautilus
[7] http://live.gnome.org/Epiphany
[8] http://live.gnome.org/Gedit
[9] http://live.gnome.org/Anjuta
[10] http://library.gnome.org/misc/release-notes/3.0/index.html.de
[11] http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/
| Autoreninformation |
| Mirko Lindner (Webseite)
befasst sich seit 1990 mit Unix. Seit 1998 ist er aktiv in die
Entwicklung des Kernels eingebunden und verantwortlich für diverse
Treiber und Subsysteme für Linux und andere freie Plattformen.
Daneben ist er einer der Betreiber von Pro-Linux.de.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der
fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben
Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen,
erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge
behält.
Linux 2.6.39
Die Entwicklung des 2.6.39 ging ähnlich ruhig weiter, wie sie begonnen hatte. Ein Scheduler-Problem, das letztlich auf einen fehlerhaft initialisierten Timer zurückgeführt wurde, hielt die Entwickler beschäftigt, wie Torvalds beim Veröffentlichen des 2.6.39-rc6 [1] verlauten ließ. Ein Problem am Dateisystem HPFS, das mit dem Rauswurf des Big Kernel Lock zusammenhing, trat bereits früh während der Entwicklungsphase auf. Es wurde damals kurzerhand als „BROKEN“ („Kaputt“) deklariert; -rc7 [2] brachte dann die benötigten Korrekturen dafür mit. Diese machten dann auch gleich den Löwenanteil an dem weiter geschrumpften Volumen an Änderungen aus. Ohne viel Federlesen folgte dann statt einer achten Vorabversion gleich 2.6.39 [3], nach nur 66 Tagen Entwicklungszeit.
BKL: Das war's, Leute!
Die neuen Funktionen klingen nicht ganz so spektakulär wie in mancher vorangegangenen Version, dennoch hat 2.6.39 etwas mehr als nur ein paar aktualisierte Treiber zu bieten. Allem voran, auch wenn dies schon mehrfach erwähnt wurde (siehe „Der April im Kernelrückblick“, freiesMagazin 05/2011 [4]), musste der Big Kernel Lock nun endgültig weichen; seit Arnd Bergmanns Patch mit der Bezeichnung „BKL: That's all, folks“ [5] wird man den Aufruf lock_kernel() nun – außer eventuell in der Dokumentation – nicht mehr im Kernel-Quellcode finden.
Mehr Pakete im Versand
Bei der Kommunikation mittels des Netzwerkprotokolls TCP/IP wird darauf geachtet, dass sich immer nur eine bestimmte Menge an Daten zwischen den beiden Endpunkten in der Zustellung befindet, also Pakete vom Sender abgeschickt wurden, ohne dass deren Eingang vom Empfänger bestätigt wurde. Bislang galten hier vier Segmente zu etwa 4 KB als Obergrenze zu Beginn einer Verbindung. Mitarbeiter von Google haben sich nun nach umfangreichen Tests dafür eingesetzt, diesen Wert auf zehn Segmente zu erhöhen; es wurde auch ein Vorschlag zur Änderung der entsprechenden Richtlinien bei der IETF (Internet Engineering Task Force) [6] eingereicht.
Die Änderung der Segment-Anzahl führte ohne erkennbare Netzwerkprobleme zu spürbaren Reduzierungen der Wartezeiten aus Sicht des Nutzers. Bislang funktionierte dies mit Linux nicht, da hier auf der Empfangsseite nur 6 KB zugelassen wurden. Nachdem dies in 2.6.38 bereits erhöht wurde, folgt nun die von Google vorgeschlagene Aufstockung des „Congestion Window“ auf zehn Segmente (entspricht ca. 10 KB).
IPset vereinfacht Firewall-Regeln
Ebenfalls auf Netzwerkseite rangiert IPset, eine Möglichkeit um Netzwerk-Ressourcen wie IP-Adressen oder Netzwerk-Ports zu einem Satz zusammen zu fassen. Die Sätze können dann von der im Kernel integrierten Firewall-Werkzeugsammlung Netfilter [7] verwendet werden. Damit ist es nun möglich, einen vergleichsweise einfachen Regelsatz vorzuhalten und dennoch in den IPsets lange Listen an Adressen und Ports zu pflegen.
Ext4 und Btrfs
Eine bereits mit 2.6.37 eingeführte Verbesserung am Dateisystem Ext4 bei der Nutzung auf Mehrprozessorsystemen wurde nun endlich in der Standardkonfiguration aktiviert. Bislang war die Verwendung von BIO-Layer (Block I/O – „Blockweise Ein-/Ausgabe“) noch nicht eingeschaltet. Die Übermittlung von Anfragen an den Ein-/"Äusgabe-Scheduler erfolgte über einen Buffer Layer („Zwischenpuffer“), der jedoch nicht effizient von mehreren Prozessoren genutzt werden kann.
Dem Dateisystem Btrfs wurde neben den üblichen kleineren Korrekturen und Verbesserungen noch die Möglichkeit gegeben, unterschiedliche Einstellungen für Komprimierung und das Schreiben auf den Datenträger für einzelne Dateien oder Verzeichnisse zu setzen, wodurch sich der Durchsatz z. B. durch eine geringere Komprimierungsrate bei kleinen, sehr häufig genutzten Dateien verbessert oder / und gleichzeitig eine hohe Komprimierung bei besonders großen Dateien eingesetzt werden kann.
Transzendenter Speicher
Etwas entrückt scheint das Konzept des Transzendenten Speichers (Transcendent Memory) anzumuten. Tatsächlich soll ein solcher Speicher das Wahrnehmbare überschreiten, allerdings nur in der Form, dass niemand zu wissen braucht, wie groß der Speicherbereich ist oder wo er physisch liegt. Er kann als eine Form des Arbeitsspeichers betrachtet werden, bei dem allerdings nicht sichergestellt ist, ob Schreibvorgänge auch erfolgreich verlaufen oder dass geschriebene Daten beim nächsten Leseversuch noch vorhanden sind. Dies sind eigentlich Eigenschaften eines Speichers, die einen Anwender eher abschrecken. Allerdings kann Transcendent Memory sonst ungenutzten Speicher in Beschlag nehmen und wird bei Bedarf einfach verdrängt, wodurch die Auslastung des Gesamtspeichers verbessert wird. Anwendungsbereiche liegen überall da, wo zum Beispiel nur ein Zwischenspeicher benötigt wird, dessen Verlust nicht tragisch ist, da die Inhalte noch woanders liegen.
Pstore sichert des Kernels letzte Worte
Fällt der Kernel wieder einmal auf die Nase, ist es manchmal schwierig, an Logdateien oder einen Speicherauszug zum Zeitpunkt des Crashs zu kommen, da mitunter auch die vom Kernel verwalteten Dateisysteme nicht mehr verfügbar sind. Abhilfe soll hier Pstore schaffen, ein Dateisystem, das den ACPI Error Record Serialization Table (ERST) nutzt, um die Fehlermeldungen eines Kernel-Crashs auch über einen Neustart hinweg zu speichern. ERST ist eigentlich zur Speicherung von Hardware-Fehlermeldungen auf einem nichtflüchtigen Speicher gedacht und in den ACPI-Spezifikationen beschrieben. Der Intel-Entwickler Tony Luck hat dabei nicht nur an die x86-Plattform gedacht, sondern Pstore als Framework umgesetzt, sodass auch andere Plattformen es nutzen können, um Informationen über den „letzten Atemzug eines abstürzenden Kernels“ sicherstellen zu können.
Darüber hinaus wurde wieder in großem Umfang an den bereits bestehenden Treibern gearbeitet und neue eingebracht. Eine vollständige Übersicht liefert die englischsprachige Seite Kernel Newbies auf zwei Übersichtsseiten zu den neuen Funktionen [8] und den Änderungen an den Architekturen und Treibern [9].
Linux 3.0
Richtig, es heißt nun Linux 3.0. Wer aus alter Gewohnheit den 2.6.40-rc1 erwartete, wurde diesmal enttäuscht, da Torvalds einen neuen Abschnitt bei den Versionsnummern eingeläutet hat. Auch Ingo Molnar stimmte ihm zu, dass .40 ausreichend groß sei, um eine neue Major-Version zu beginnen. Einige Zeit lang stand auch noch 2.8 als Nachfolger von 2.6 im Raum [10], allerdings wurde nun auch mit dem alten, bereits seit einigen Jahren nicht mehr gelebten Modell zur Unterscheidung von Entwickler- und Produktiv-Versionen gebrochen, sodass der neue Entwickler-Kernel nun unter 3.0-rc1
veröffentlicht wurde. Somit sind es nicht unbedingt technische Aspekte, die bei diesem Schritt im Vordergrund standen, sondern die ganz banale Faulheit der Entwickler, die nun jedes Mal einige Zeichen weniger zu tippen haben. ;-)
So sind die Änderungen auch eher unspektakulär und halten sich schon rein vom Volumen her unterhalb der Vorgängerversionen. „Keine ABI-Änderungen, keine API-Änderungen, keine märchenhaften neuen Funktionen – lediglich stetig voranschreitender Fortschritt“ beschrieb Torvalds den 3.0-rc1 [11], und das ist auch passend. Besonders erwähnenswert erschienen ihm Aufräumarbeiten an VFS (Virtual File System) und Korrekturen an der Virtuellen Speicherverwaltung (VM). Er plant, bei diesem Entwicklungszyklus besonders strikt bei der Übernahme von Änderungen zu sein, um aus dem Kernel 3.0 ein stabiles Stück Software zu machen.
Kurz erläutert: „Versionsnummerierung des Linux-Kernels“
Die ersten Versionsnummern folgten noch keinem zielgerichteten Muster, erst ab Version 1.0 sollte das folgende Schema gelten: Die erste Stelle wird nur bei tiefgreifenden Änderungen der Systemarchitektur erhöht. Die zweite Stelle bezeichnet die Major-Version, wobei stabile Kernel mit geraden (z. B. 2.4), reine Entwickler-Kernel mit ungeraden Ziffern gekennzeichnet wurden (z. B. 2.5). Die dritte Stelle ist die Minor-Version, die erhöht wird, wenn neue Funktionen hinzukommen.
Seit 2004 entfällt der reine Entwickler-Kernel, beginnend mit 2.6 wird die auf die aktuellste Version folgende Minor-Version als Entwickler-Kernel geführt und bis zur Veröffentlichung als stabile Version mit „-rc“ gekennzeichnet. Parallel dazu wurden immer noch Kernel aus der 2.4er-Reihe mit Änderungen gepflegt, die aus der 2.6er-Reihe zurückportiert wurden.
Die Versionsnummer 2.6.40 erschien Torvalds zu umständlich, daher wurde der Folge-Kernel zu 2.6.39 kurzerhand 3.0 getauft. Dies soll auch einen neuen Abschnitt in der Versionsnummerierung anzeigen, denn die Minor-Version fällt nun weg, der Nachfolger zu 3.0 wird 3.1 heißen. Nicht stabile Kernel-Versionen werden weiterhin mit einem „-rc“ und einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet, also zum Beispiel 3.0-rc1, 3.0-rc2 und so weiter. Darüber, was als Grund für einen Sprung auf 4.0 in Frage kommt, darf gerätselt werden, im Zweifel bis zur Veröffentlichung von Kernel 3.39.
|
Links
[1] https://lkml.org/lkml/2011/5/3/553
[2] https://lkml.org/lkml/2011/5/9/552
[3] https://lkml.org/lkml/2011/5/19/16
[4] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-05
[5] https://lkml.org/lkml/2011/1/25/520
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Netfilter
[8] http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_39
[9] http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_39-DriversArch
[10] http://www.pro-linux.de/news/1/17079/abschied-von-linux-26.html
[11] https://lkml.org/lkml/2011/5/29/204
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels. Dafür erfährt er frühzeitig Details über neue Treiber und interessante Funktionen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Schwarz
Ungern brüllt man Anweisungen von Büro zu Büro. Damit Angestellte
miteinander kommunizieren können, wird vielerorts zum Telefon gegriffen. Wird
bereits telefoniert, muss die dienstliche E-Mail herhalten, um
Kommunikationsbedürfnisse zu befriedigen. Was aber, wenn die Leitung belegt
und das Senden einer E-Mail derzeit nicht möglich ist? Situationen wie die
folgende waren und sind in Büros keine Seltenheit.
Wie alles begann – Vorgeschichte
Nahezu unhörbar vibriert das Mobiltelefon über den Tisch, schon der
Griff danach verspricht nichts Gutes – jedenfalls nicht jetzt, einige
Minuten vor Feierabend: „Technik, Schwarz?“ – Es ist der
Büroleiter, schwer in Rage darüber, dass der Mailserver mal wieder
seinen Dienst quittiert hat. Der Mailserver gehört zur weit entfernten
Hauptdienststelle und wird auch von dort aus administriert. Eigentlich
jedenfalls. Entsprechend sinnfrei, dass zu diesem Thema das Telefon
hier klingelt, einer kleinen Außenstelle – 30 Festangestellte und
einige Zeitarbeitskräfte verteilt auf drei Etagen. Hier gibt es
niemanden, der dafür die Verantwortung übernehmen, geschweige denn mit
einem magischen Fingerschnippen für neue Funktionalität sorgen könnte.
Unabhängig davon folgt die nächste Tirade: „Es ist ein Unding, dass
dieses blöde System dauernd Störmeldungen verursacht!“, schnaubt es am
anderen Ende der Leitung. Nicht zum ersten Mal folgt an dieser Stelle
die Erklärung, dass der Mailserver nicht in Zuständigkeit der
Außenstelle liegt und die Hauptdienststelle dieses Monopol inklusive
Adminrechte für sich behält. Freundlich wie man ist, bietet man an,
den Fehler zur Bearbeitung weiterzugeben … Aber offensichtlich ist dies
nicht die Zeit für Erklärungen und Angebote – und so endet das
Telefonat mit einem unerwarteten Klicken in der Leitung. Funkstille.
Aufgelegt.
Verärgerung macht sich breit: Prügelknabe durch Koinzidenz ist heute
derjenige, der zum falschen Zeitpunkt zum Telefon griff – jedoch bahnt
sich irgendwo zwischen limbischen System und Großhirn eine Lösung an:
„Keine Mitadministration“, „hausinterne Kommunikation“, „unabhängig“,
„kein Telefon“ – Gedankenbruchstücke führen zum Schluss, dass ein
Kommunikator benötigt wird, der im Störfall direkt vor Ort gewartet
werden kann, das Ganze hausintern ohne Anbindung nach „Oben“ und
möglichst textbasiert, fast so wie E-Mail. Nach kurzem Überlegen: Ein
Chatroom für alle, um Statusmeldungen und Mitteilungen an das Personal
verschicken zu können. Der Gedanke hält sich. Dann beginnt die
Internetrecherche: Auf die Stichworte „Hausinterne Kommunikation“
spuckt Wikipedia u. a. „Chat/Webkonferenz/Instantmessaging“ aus, auf
einer der anderen gefundenen Seiten wird „UnrealIRC“ für seine relativ
einfache Konfiguration und dessen Stabilität gelobt. Nach einer
Viertelstunde steht der Entschluss: Ein Chat ist die Lösung für das
Problem.
Grundkenntnisse
UnrealIRCd [1] bedeutet nichts anderes als „Unreal Internet Relay Chat
daemon“, wobei „Unreal“ der Eigenname ist und keine weitere Bedeutung
hat. „Internet Relay Chat“ oder eben kurz „IRC“ benennt die zugrunde
liegende Komponente, ein textbasiertes Chatsystem, für das Projekt. Der
„Daemon“ ist der Dienst, der Verbindungen sowie die generelle
Kommunikation ermöglicht. Ohne Betriebssystem keine Software, als
Grundgerüst dient daher ein Ubuntu 10.04 Server. Das schließt zwar, lässt
man größere Anpassungen außen vor, den Zugriff auf eine GUI aus, der
Vorteil ist aber der lange Unterstützungszeitraum. Ubuntu 10.04 bietet Long
Term Support. Die Servervariante wird bis April 2015, fünf Jahre nach
Veröffentlichung im April 2010, mit Updates versorgt.
Scheinwelt
Den IRC-Daemon sperrt man am Besten in eine virtuelle Maschine. Warum? Zur
Installation und Konfiguration wurde im beschriebenen Szenario ein alter
Pentium4-PC mit 2 GHZ und 512 MB Arbeitsspeicher genutzt. Ein normaler
Desktop-PC von „damals“ ist ökonomisch betrachtet nicht für den
24-Stunden-Betrieb vorgesehen und verpulvert unnötig Strom. Später, wenn das
Projekt ein voller Erfolg und die Belegschaft begeistert ist, wird ein
kleiner PC mit Stromspar-CPU den 24-Stunden-Dienst übernehmen und relativ
umweltfreundlich in einer Ecke des Büros stehen. Wenn der Tag gekommen ist,
wird die virtuelle Maschine mitsamt dem IRC-Daemon einfach den Gastgeber
wechseln. Die Virtualisierung des IRC-Daemon ist auch dann sinnvoll, wenn man
mit einer bereits produktiven IRC-Umgebung Tests durchführen möchte, ohne
dem Büro den lieb gewonnen Kommunikator zu schädigen. Stattdessen erstellt
man ein Backup der VM und experimentiert damit herum, ohne das produktive
System zu belästigen. Letzter Vorteil zum Thema virtuelle Maschine: Ist
bereits ein physischer, ununterbrochen laufender PC oder Server vorhanden,
drückt man diesem einfach zusätzlich die virtuelle IRC-Maschine aufs Auge.
Dabei ist es auch (fast) unwichtig, welches Betriebssystem die virtuelle
Maschine gastieren lässt, da es für alle gängigen Systeme entsprechende
Virtualisierungssoftware gibt.
Voraussetzungen
Zuerst die Virtualisierungssoftware zum Einrichten der virtuellen Maschine:
Im beschriebenen Fall erledigt VirtualBox [2] die
Aufgabe. Die Firma Oracle [3] bietet den Virtualisierer
kostenlos an, was den Geldbeutel schont. Darüber hinaus geht man mit
VirtualBox sicher, dass die eingerichtete virtuelle Maschine im Anschluss auf
Linux-, Windows- oder MacOS-X-Maschinen gleichermaßen eingesetzt werden kann.
Nach VirtualBox sollte die Servervariante von Ubuntu auf der zugehörigen
Homepage [4] heruntergeladen
werden. Dieses System wird später als virtuelle Maschine installiert.
Prinzipiell eignet sich auch eine andere Distribution als Unterbau für den
UnrealIRCd.
Als weitere Grundvoraussetzung ist entsprechende Hardware nötig, je
aktueller desto besser. Die durchgeführte Beispielinstallation begnügte
sich jedoch bereits, wie weiter oben beschrieben, mit einem
Pentium4-Prozessor und 512 MB Systemspeicher.
Vorbereitung
Mit heruntergeladenem Ubuntu-Server CD-Image und installiertem VirtualBox auf
dem Gastgebersystem geht es also ans Werk. Es wird eine virtuelle Maschine
erstellt. Benannt werden kann diese wie es beliebt. „Typ des
Gastbetriebssystems“ sollte „Linux“, Version „Ubuntu“ sein. Bei der
Zuweisung des VM-RAM spielt der reelle Arbeitsspeicher eine große Rolle. Bei
insgesamt 512 MB wäre eine Zuweisung von 512 MB an die virtuelle Maschine
mehr als töricht. Bei 2 GB und mehr verbautem Arbeitsspeicher aber durchaus
praktikabel. Ein Wert zwischen 256 MB und 512 MB sollte zur Installation
vorerst eingestellt werden. Tatsächlich ist der spätere Betrieb auch mit
lediglich 96 MB virtuellem Arbeitsspeicher möglich. Eine virtuelle
Festplatte wird am Folgebildschirm erzeugt. Hierbei wählt man optimalerweise
„dynamisch wachsendes Medium“ mit einer Größe von 3,70 GB. Dieser Wert
ist praktisch, da die komplette virtuelle Maschine, wann immer gewünscht,
auf einer DVD gesichert oder darauf von Gastgebersystem zu Gastgebersystem
transportiert werden kann. Letztlich sind 3,70 GB lediglich ein Vorschlag,
der Benutzer hat, gemessen an seiner Festplattenkapazität, die freie Wahl.
Nach einigen Klicks auf „Weiter“ ist die Baustelle „Virtuelle
Maschine“ also soweit hergerichtet, Zeit „Baustellenfahrzeuge“ und
„Baumaterial“ hinzuzufügen: Im Hauptfenster von VirtualBox markiert man
die soeben erstellte virtuelle Maschine und klickt auf „Ändern“.
Schließlich mangelt es am zu installierenden Ubuntu-Server bzw. dessen
CD-Image. Unter „Massenspeicher“ wählt man bei „IDE-Controller“ den
Eintrag „leer“. Am rechten Rand von „Attribute“ selektiert man das
kleine CD-Symbol und klickt auf „Datei für virtuelles CD/DVD-ROM-Medium
auswählen …“. Anschließend wird das CD-Image des Ubuntu-Server gesucht
und eingebunden.
Startet man jetzt die virtuelle Maschine, sollte nach dem
Hochfahren ein Ubuntu-Startmenü gezeigt werden.
Die Installation des Betriebssystems der virtuellen Maschine wird im
Anschluss durchgeführt. Benennt man die Ubuntu-Installation stimmig mit
unrealircd, ist eine Zuordnung im Netzwerk später einfacher. Die Frage
nach einem Proxy-Server während der Installation sollte erhöhte Beachtung
finden, wird im Firmennetz ein solcher verwendet. Gleiches gilt für die
Frage, ob Updates automatisch oder manuell installiert werden sollen. Die
Abfrage nach der Software kann, ohne etwas zu markieren, übersprungen
werden. Nach Abschluss der Installation wird es interessanter.
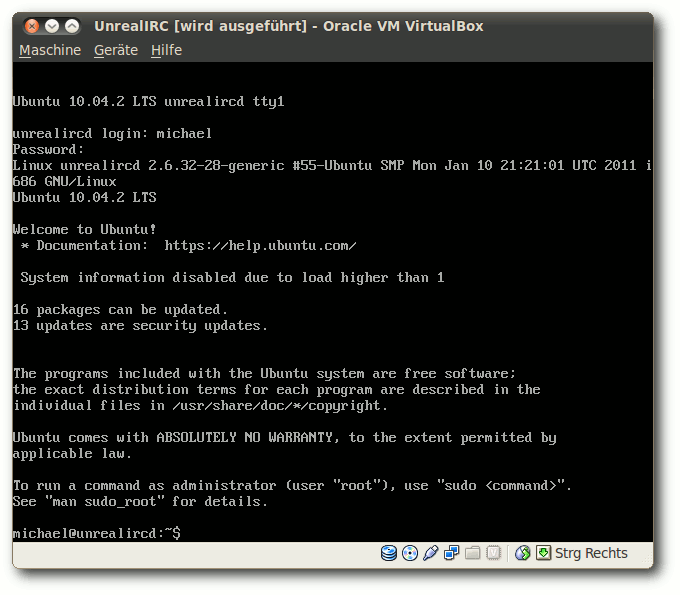
Der Server, frisch installiert und betriebsbereit.
Jetzt geht's los
Das System der VM ist installiert und bereit. Wichtig jetzt: Die Beschaffung
des Unrealircd.
Über
$ wget http://www.unrealircd.com/downloads/Unreal3.2.8.1.tar.gz
findet das
Programmpaket seinen Weg auf die virtuelle Festplatte. Mittels
$ tar xfz Unreal3.2.8.1.tar.gz
entpackt man das Archiv in den Ordner
Unreal3.2. Dieser sollte auch prompt über
$ cd Unreal3.2
betreten werden. Bevor die Installation nun stattfinden kann, installiert
man noch erforderliche Abhängigkeiten. Einzig der Compiler gcc schien
nach der Installation des Servers zu fehlen, was sich aber durch die
Paketverwaltung nachträglich beheben lässt. Im Anschluss wird das
Skript zur Vorkonfiguration von UnrealIRCd laufen. Netterweise liegt dieses
Script dem Programmpaket bei und wird via
$ ./Config
ausgeführt. Statt Parameter manuell eintragen zu müssen, werden
diese durch die Beantwortung einiger Fragen automatisch gesetzt.
Folgende Antworten waren im Beispielszenario hilfreich, wobei per
Standard die Voreinstellung (ohne Eingabe mit „Enter“ bestätigen)
gewählt wurde, wenn nichts anderes dabei steht. Potenzielle Nachahmer
sollten die Fragen jedoch nach eigenen Ansprüchen beantworten.
- „Anti Spoof Protection“ Pfeil rechts Yes
- „directory of configuration files“
- „path to ircd binary“
- „Hub or Leaf“
- „hostname of server“
- „default permission of conf files“
- „support ssl“
- „enable IPv6“
- „ziplinks support“
- „enable remote includes“
- „enable prefixes“
- „listen() backlog value“
- „how far keep nickname history“
- „maximum sendq length“
- „how many buffer pools“
- „how many file descriptors“
- „more parameters?“
Wenn der Fragen-Marathon überstanden ist, beginnt das Skript automatisch mit
der Konfiguration. Abhängig von der eingesetzten Hardware kann
das einige Minuten in Anspruch nehmen. Ist die Konfiguration abgeschlossen
erscheint eine Tabelle mit dem Namen „UnrealIRCd Compile-Time Config“.
Sollte diese Tabelle nicht erscheinen hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die
Konsole sollte dann über die Art des Fehlers Auskunft geben. Ist alles in
Ordnung wird der Befehl
$ make
eingegeben und bestätigt. Zur Belohnung gibt es eine ausführbare Datei
unreal.
Hinweis: Da das Programm UnrealIRC nicht aus den Paketquellen
installiert wurde, sollte man von Zeit zu Zeit auf dessen
Aktualisierungen achten und diese installieren. Das Paket gcc kann
nach Erledigung der Aufgabe wieder deinstalliert werden.
Würde man bereits jetzt den Start der ausführbaren Datei wagen, wäre eine
Fehlermeldung bezüglich der fehlenden Datei unrealircd.conf die Folge.
Diese befindet sich leider nicht im Lieferumfang und muss separat
heruntergeladen bzw. erstellt werden.
Die Konfigurationsdatei ist nahezu allumfassend und eine Beschreibung jeder
Option würde den Rahmen des Artikels sprengen. Sucht man im Internet nach
dem Begriff unrealircd.conf, findet man aus verschiedensten Quellen
Anregungen und Beispielkonfigurationen. Ein sehr schönes deutschsprachiges
Exemplar gibt es beispielsweise auf
der Seite irc-guide.de [5], online
gestellt von Hendrik Bergunde. Wer sich darüber hinaus über weitere
Konfigurationsoptionen informieren möchte, nutzt als Quelle die
deutschsprachige Beschreibung zur
UnrealIRCd-Konfigurationsdatei [6].
Eine speziell auf
das Szenario dieses Artikels angepasste Konfiguration kann man direkt von
freiesMagazin
über die Datei unrealircd.conf herunterladen
und im Ordner Unreal3.2 ablegen. Bitte beachten: Die hier zur
Verfügung gestellte Datei bietet lediglich grundlegende Funktionen. Im
Umkehrschluss heißt das keine verschlüsselte Verbindung, keine
Einstellungen zur Kommunikation mit anderen IRC-Servern und nur die
nötigsten Erweiterungsmodule. Es sei an dieser Stelle daran erinnert,
dass diese Datei auf eigene Verantwortung hin genutzt wird!
UnrealIRC kann im ausgereiften Zustand ein wahrer Wolkenkratzer werden, der
hier konfigurierte Dienst ist im Vergleich eine Wellblechhütte.
Wenn die Anpassung der Konfiguration auf die eigenen Bedürfnisse
abgeschlossen ist, müssen noch zwei weitere conf-Dateien angelegt werden.
Wenn man sich im Ordner Unreal3.2 befindet, erledigen die Befehle
$ touch rules.conf
$ touch motd.conf
diese Aufgabe. Das Anlegen verhindert lediglich die Ausgabe von
Fehlermeldungen. Falls für die eigenen Zwecke gewollt, sind auch in diesen
Konfigurationsdateien Anpassungen nötig.
Wurde alles konfiguriert, wird der Dienst via
$ ./unreal start
aktiv geschaltet. Sollte etwas mit der Konfiguration nicht stimmen,
beschwert sich der Dienst auf der Konsole mit Zeilenangabe und Art des
Fehlers. Landet man nach Eingabe des Befehls hingegen erneut in der
Befehlseingabe hat vermutlich alles geklappt und der IRC-Dienst läuft.
Sollten Änderungen an der unrealircd.conf nötig sein, kann man den
IRC-Dienst mit
$ ./unreal stop
beenden und später wieder starten oder nach Einpflegen der Änderungen mit
$ ./unreal restart
neustarten.
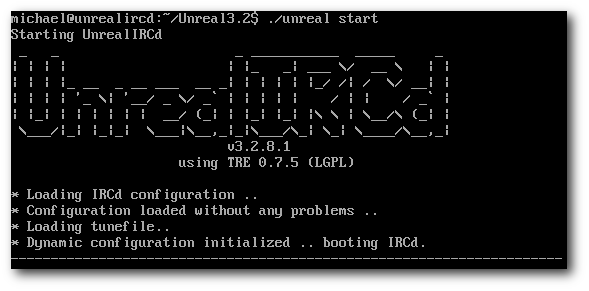
Sieht man diese Ausgabe, hat alles funktioniert.
Das große Testen
Der UnrealIRCd läuft offenbar. Ob er erreichbar ist, testet man mit einem
IRC-Client seiner Wahl. Vor dem Test sollte spätestens jetzt die Option zur
Weiterleitung von Anfragen an den IRC-Port der virtuelle Maschine aktiviert
werden. Falls nicht, findet kein Paket seinen Weg zum UnrealIRCd. Hierzu
fährt man die virtuelle Maschine herunter (dazu im Terminal init 0
eingeben)
und wählt im VirtualBox Manager die „Ändern“-Funktion der
UnrealIRCd-VM. Im Folgefenster navigiert man zum Punkt „Netzwerk“. Über
„Erweitert“ erscheint weiter unten der Button „Port-Weiterleitung“.
Wurde dieser betätigt, trägt man im jetzt erschienenen Fenster mindestens
Protokoll „TCP“, die IP-Adresse des PCs auf dem die virtuelle Maschine läuft,
den Port auf dem
Anfragen vom IRC-Client ankommen (meistens 6667), die
Gast-IP (zu erfahren in der virtuellen Maschine mit dem Befehl ifconfig)
und bei Gast-Port
den in der UnrealIRCd-Konfiguration eingetragenen
„listen“-Port ein. Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden,
sollte dem Zugriff auf den IRC-Server nichts mehr im Wege stehen.
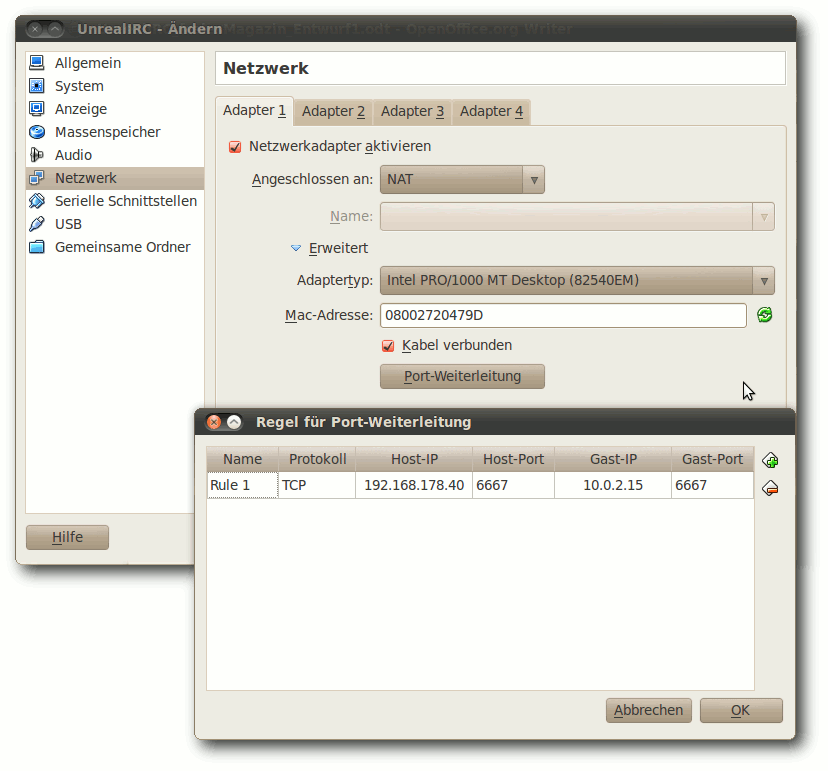
Vorzunehmende Konfiguration der virtuellen Maschine.
Zeit für den ersten Test; das Programm XChat [7] eignet sich z. B. wunderbar
dafür. Man startet
XChat, öffnet die Netzwerkliste und fügt ein neues
Netzwerk hinzu. Dieses editiert man sogleich und trägt als Server die
IP-Adresse des Gastgebersystems der virtuellen Maschine ein (nicht die der
virtuellen Maschine selbst). Zusätzlich fügt man noch den vorher in der
Konfigurationsdatei von UnrealIRCd eingetragenen Port, auf
dem nach
eingehenden Verbindungen gelauscht
wird (Stichwort: listen), hinzu. Ein
vollständiger
Eintrag sollte in etwa „192.168.178.40/6667“
ähneln.
Wenn die Verbindung vom Gastgebersystem
funktioniert, sollte im Anschluss
noch von einem weiteren, zweiten PC im Netzwerk getestet werden. Damit geht
man sicher, dass der Träger der virtuellen Maschine die eingehende
Verbindung eines externen Rechners wie gewollt an die virtuelle Maschine
weiterleitet.
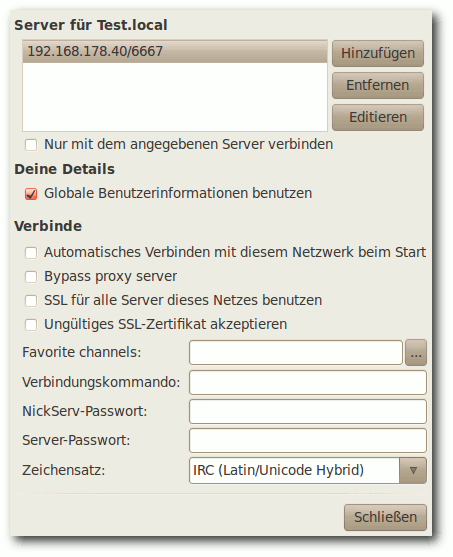
Ein eingerichteter Testlauf unter XChat.
Den Benutzer mit ins Boot holen
Der Server ist getestet und die Verbindung funktioniert. Großartig. Womit
verbinden sich die Benutzer nun zum IRC-Dienst?
Eine passende Software muss
her. Diese sollte die wesentlichen Funktionen, Teilnahme am Kanal, wahlweise
eine Option zum automatischen Verbinden, wie auch die Möglichkeit mit
anderen Benutzern direkt zu kommunizieren, mit sich bringen. Noch wichtig:
Nicht jeder Benutzer ist mit überdurchschnittlichen IT-Kenntnissen gesegnet,
die Einfachheit der Software spielt also eine entscheidende Rolle. In diese
engere Kategorie kamen XChat [7] bzw.
XChat Gnome [8], smuxi [9]
oder LostIRC [10]
für Linux-Clients. Verwenden die Benutzer ausschließlich oder auch Windows-Clients
hat eine abgespeckte Variante von MirandaIM [11]
mit entfernten ICQ-, AIM- und Yahoo-Plugins sowie zusätzlichen Add-ons (PopupPlus, Autoaway) gute Dienste
verrichtet. Für welche Cĺient-Lösung man sich
entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen. Im beschriebenen Szenario wurde
letztlich XChat gewählt.
Manche Benutzer im Büro haben das Bedürfnis, auch noch an anderen
IRC-Servern außerhalb des Büros kommunizieren zu wollen. In Netzen, wo den
08/15-Benutzer kein Proxy daran hindert bzw. dessen Daten jedem bekannt sind,
stellt die Unterbindung dessen ein Problem für den Administrator dar. Wo
Port-Sperren oder andere Möglichkeiten zur Blockierung nicht umzusetzen sind,
lässt sich die IRC-Kommunikation nach außen immerhin erschweren, indem man
eine angepasste Version der Datei servlist_.conf (XChat) bereitstellt. In
der angepassten Version befindet sich nur der interne Server und alle anderen
Einträge wurden gelöscht. Die Datei liegt
üblicherweise im Heimatverzeichnis des Nutzers unterhalb von .xchat2/
und kann mit einem Texteditor angepasst werden. XChat darf währenddessen
nicht laufen.
In dieser Datei lässt sich außerdem wunderbar eingeben, welcher IRC-Kanal
nach der Verbindung zum Server automatisch betreten werden soll. Beispiel:
J=#buerostock1,#buerogesamt sorgt dafür das nach dem Starten die
Kanäle #buerostock1 und #buerogesamt betreten werden. Eine Last
weniger für den Endanwender im ersten Stockwerk des Büros.
N=SchmidtBuero.Kommnik
J=#buero1stock,#buerogesamt
E=IRC (Latin/Unicode Hybrid)
F=26
D=0
S=192.168.178.40/6667
Listing: servlist_.conf
Es kann manchmal hilfreich sein, die Benutzer zu ihrem Glück zu zwingen. Das
heißt nichts anderes, als das IRC-Programm, in diesem Falle
XChat,
automatisch zu starten. Ubuntu-Systeme bieten dafür unter „System -> Einstellungen -> Startprogramme“
einen einfachen Weg.
Ein Blick über den Tellerrand
Diese Anleitung endet hier. UnrealIRC bietet aber darüber hinaus schier
unendliche Möglichkeiten. Das beschriebene Szenario widmet sich lediglich
einem Einzelstandort. Genauso gut wäre es möglich gewesen, einen UnrealIRC-Server
im Internet zu betreiben, damit nicht nur ein Büro sondern auch die
Kollegen aus der Hauptdienststelle auf Rügen und der Hauptpersonalrat,
ansässig in München, darüber kommunizieren können. Auch wäre es dann
möglich, dass
Personen von zu Hause teilnehmen (Stichwort:
Heimarbeitsplatz). Die Vergabe eines Passworts zum Verbinden auf den Server
und die Konfiguration einer gesicherten SSL-Verbindung wird spätestens dann
zur Pflicht.
Eine weitere schöne Funktion, die unbedingt noch Erwähnung finden sollte, ist
die Inanspruchnahme von IRC-Diensten [12]
wie nickserv oder chanserv. Die
Integration dieser Dienste in einen internen IRC-Server für circa 30
Personen schien jedoch unangebracht.
Links
[1] http://www.unrealircd.com
[2] http://www.virtualbox.org
[3] http://www.oracle.com
[4] http://www.ubuntu.com/business/get-ubuntu/download
[5] http://irc-guide.de/wiki/Main/UnrealIRCdBeispielkonfigurationsdatei
[6] http://www.vulnscan.org/UnrealIrcd/unreal32docs.de.html
[7] http://xchat.org/
[8] http://live.gnome.org/Xchat-Gnome
[9] http://www.smuxi.org/main/
[10] http://lostirc.sourceforge.net/
[11] http://www.miranda-im.org/
[12] http://de.wikipedia.org/wiki/IRC-Dienste
| Autoreninformation |
| Michael Schwarz (Webseite)
schreckt nicht davor zurück, sein sonst
lediglich zu privaten Zwecken genutztes Kommunikationsmittel IRC auch im
Büro einzubürgern, wenn es dem Austausch von Informationen dienlich und der
Vorgesetzte zufrieden ist.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Sujeevan Vijayakumaran
Im Januar des Jahres 2011 erschien eine neue Version des
Content-Management-Systems Drupal [1]. Die
siebte Version wurde Anfang des Jahres nach dreijähriger
Entwicklungsphase freigegeben. Dies ist eine gute Gelegenheit,
einen Blick auf den aktuellen Stand des CMS zu werfen.
Das Content-Management-System (kurz: CMS) Drupal wurde nach einer
dreijährigen Entwicklungszeit in Version 7 von den Entwicklern
freigegeben. Durch die neueste Veröffentlichung endet auch der
offizielle Support von Drupal 5. Neben Drupal gibt es zahlreiche
weitere Content-Management-Systeme wie zum Beispiel Joomla, Contao,
Wordpress und Typo3. Sie dienen zentral der Organisation und
Erstellung von Inhalten für eine Internetseite. Dabei arbeiten die
verschiedenen Systeme unterschiedlich und setzen verschiedene
Schwerpunkte. Drupal selbst setzt sich als Ziel, ein ausgewogenes
CMS zu sein. Das Projekt gibt in seiner
Dokumentation [2]
an, dass viele andere CMS entweder zu kompliziert für Einsteiger
oder zu einfach gehalten sind, sodass man nicht sehr viel damit
realisieren kann. Drupal selbst erhebt den Anspruch, sowohl
leistungsstark als auch einfach für Einsteiger zu sein. Durch den
Einsatz von vordefinierten Komponenten bildet Drupal sowohl ein CMS
als auch ein Content-Management-Framework. Drupal ist komplett in PHP
geschrieben und ist mit zahlreichen Datenbanksystem kompatibel.
Neben MySQL kann auch unter anderem PostgreSQL, Microsoft SQL und
SQLite genutzt werden. Das CMS steht unter der GNU General Public
License.
Ein deutschsprachiges Drupal-Forum [3]
gibt es seit 2006, welches über 12.000 registierte Benutzer hat. Die
internationale Drupal Community [4]
mit Forum hat insgesamt über 500.000 registrierte Benutzer.
Es gibt inzwischen viele Webseiten, die Drupal einsetzen. Zu den
bekannteren gehören unter anderem MTV [5],
Ubuntu [6],
Greenpeace [7] und natürlich
auch freiesMagazin [8].
Die Entstehung von Drupal
Die Geschichte [9] begann im Jahr
2000. An der Universität Antwerpen in Belgien entstand der erste
Vorläufer von Drupal. Damals war es ein großes Privileg für
Studenten, eine permanente Internetverbindung zu besitzen. So
bildeten acht belgische Studenten ein Netzwerk. Das einzige, was in
dem Netzwerk fehlte, war eine Plattform, um die einfachsten Sachen zu
teilen und zu diskutieren. Dies inspirierte Dries Buytaert eine
kleine Newsseite zu programmieren, welche dann im Netzwerk genutzt
werden konnte. Nachdem Dries die Universität verlassen hatte,
entschied sich die Gruppe, den Weblog online zu stellen. Zunächst
war geplant gewesen, die Domain dorp.org zu registrieren. Dorp ist
das holländische Wort für Dorf. Nach einem Tippfehler wurde jedoch
die Domain drop.org registriert. Im Januar 2001 wurde dann die
Software unter dem Namen Drupal veröffentlicht. „Drupal“ stellt
die englische Aussprache des niederländischen Wortes „Druppel“ dar,
welches „Tropfen“ auf Deutsch heißt. Aus diesem Namen leitet sich
auch das Logo ab, welches ein Tropfen darstellt.
Der Aufbau des Front- und Backends
Die verschiedenen Content-Management-Systeme sind sehr häufig
unterschiedlich aufgebaut. Viele Systeme haben getrennte Front- und
Backends. Das Frontend dient dazu, die Inhaltselemente einer
Webseite darzustellen, während das Backend das Administrationsmenü
ist. Dort lassen sich neue Artikel erstellen und bearbeiten sowie
zahlreiche weitere Einstellungen vornehmen. Bei einigen
Content-Management-Systemen, wie zum Beispiel Contao, sind die Frontends von den Backends
getrennt. Bei Drupal gibt es hingegen einen fließenden Übergang
zwischen Front- und Backend. Das
Administrationsmenü erreicht man in Drupal über die Leiste, die
oberhalb der Seite positioniert ist. Das Menü wird in
mehrere Kategorien unterteilt.
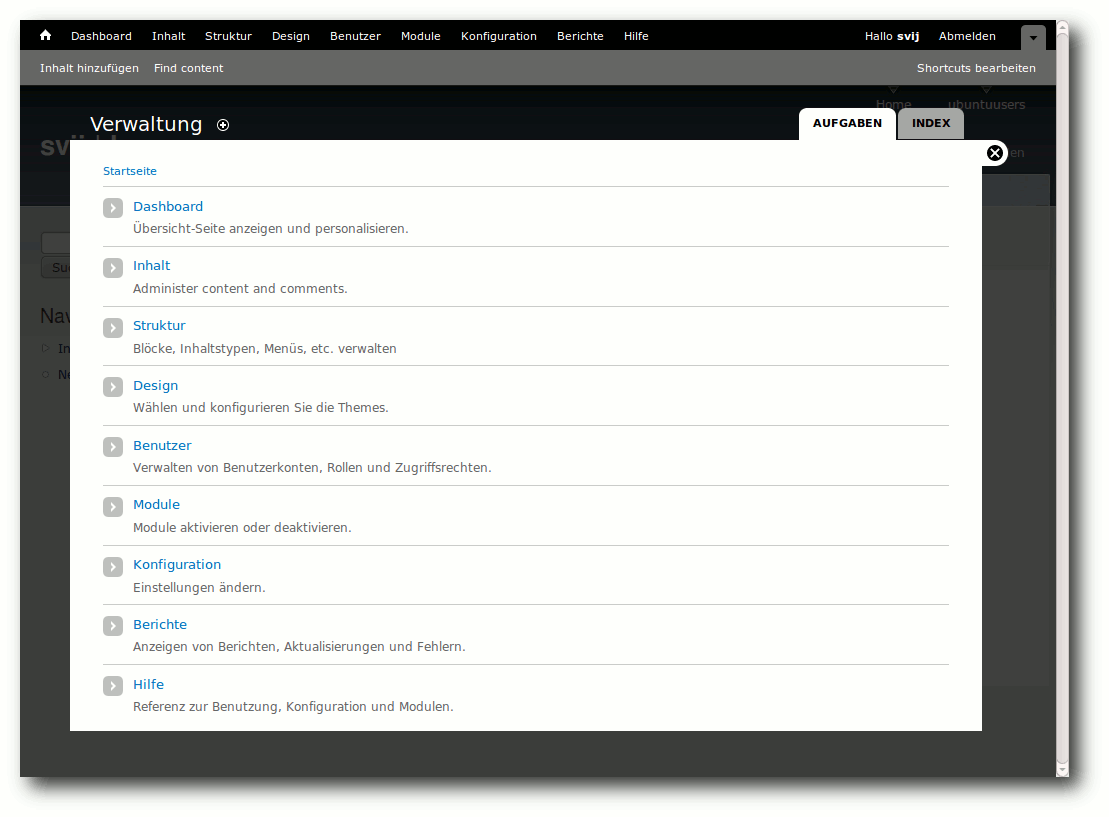
Das Administrationsmenü in Drupal 7.
Dashboard
Auf dem „Armaturenbrett“ liegen verschiedene „Blöcke“ die sich jeder
nach seinen eigenen Vorlieben anpassen kann. Standardmäßig
dargestellt werden die neuesten Inhalte, ein Suchformular, die
neuesten Mitglieder, die sich registriert
haben, als auch die
Kommentare, die zu Artikeln bzw. Seiten abgeben worden sind. Das
Dashboard lässt sich über weitere Blöcke erweitern und auch die
Anordnung der Blöcke lässt sich ordnen.
Inhalt
Das Inhaltsmenü unterteilt sich in zwei weitere Untermenüpunkte.
Es lassen sich zum einen neue Inhaltsfelder einfügen. So gibt es
die vorkonfigurierten Module „Inhaltsseiten“ und „Artikel“ mit denen
man direkt einen Text veröffentlichen kann. Außerdem lassen sich
weitere, selbst konfigurierte Inhaltstypen auswählen. In
einem weiteren Menüpunkt gibt es die Möglichkeit, die bereits
erstellten Seiten zu durchsuchen. Bei einer sehr großen Anzahl von
Artikeln ist dabei auch die Filterfunktion sehr nützlich, womit man
beispielsweise die erzeugten Artikel nach Typ,
Sprache oder dem
Status anzeigen lassen kann.
Struktur
Das Strukturmenü wird unterteilt in die Untermenüpunkte „Blöcke“,
„Inhaltstypen“, „Menüs“ und „Taxonomie“, die im Folgenden erläutert werden.
Blöcke
Blöcke sind Boxen, die sich in verschiedene Bereiche einer Webseite
verschieben lassen. So lässt sich beispielsweise per Drag & Drop
die Navigation der Webseite von der linken Seite auf die rechte
Seite verschieben. Es gibt viele vorkonfigurierte Blöcke, die mit
der Installation von Drupal daherkommen. Praktisch für Anfänger
ist auch die Vorschau der Blockregionen. Dabei wird angezeigt, wo
welche Region liegt. Dies ist besonders beim Einsatz von neuen
Themes nützlich, da sich die Anordnung und Anzahl der Blöcke bei
jedem Theme unterscheidet.
Inhaltstypen
In Drupal wird jeder Inhalt in einem „Node“ gespeichert. Jedes Node
gehört zu einem bestimmten Inhaltstyp, welcher verschiedene
Einstellungen speichert. Darunter fallen unter anderem, ob
standardmäßig die Artikel eines Inhaltstyps direkt veröffentlicht
werden und beispielsweise auch, ob Kommentare möglich sind oder
nicht.
Drupal bringt zwei Inhaltstypen mit. Dies ist zum
einen der Inhaltstyp „Artikel“ und zum anderen „Inhaltsseiten“.
Seiten mit dem Inhaltstypen „Artikel“ sind für häufig aktualisierte
Artikel sinnvoll. Seiten mit dem Typ „Inhaltsseiten“ sind für
statische Seiten geeignet, die nicht oder eher selten aktualisiert
werden. Weitere Inhaltstypen mit angepassten Einstellungen lassen
sich erstellen.
Menüs
Im Punkt „Menüs“ kann man die verschiedenen bereits vorhandenen
Menüs der Webseite verändern, umbenennen oder die Rangfolge
verändern. Es ist des Weiteren möglich, neue Menüs zu
erstellen. Die Menüs lassen sich dann als Block im Blockmenü auf
der Webseite anordnen. Jedes Menü lässt sich mit weiteren Links
erweitern. Die Sortierung der Links innerhalb des Menüs, auch
innerhalb von Untermenüs, kann man sehr einfach per Drag & Drop
verschieben.
Taxonomie
Die Taxonomie erlaubt das Identifizieren, Kategorisieren und auch
das Klassifizieren von Inhalten. Die einzelnen Tags kann man in
Gruppen zusammenfassen und damit Artikel kategorisieren
(siehe freiesMagazin-Wortwolke [10]).
Design
Auch die Konfiguration der Themes in Drupal ist sehr umfangreich.
Nach der Installation sind drei Themes einsetzbar. In den
Einstellungen des jeweiligen Themes kann man die Standardthemes
individuell gestalten. Das Farbschema lässt sich besonders gut
konfigurieren. So kann man entweder die Farbwerte für die
verschiedenen Bereiche der Webseite ändern oder, besonders
bequem
für Einsteiger, vordefinierte Farbschemen nutzen. Des Weiteren
lassen sich diverse Seitenelemente einschalten oder auch
abschalten. Außerdem kann man auch ein eigenes Logo und Favicon
hochladen, welches dann von dem Theme genutzt wird. Nicht nur für
das Frontend gibt es Themes. Es gibt auch Themes für das
Administrationsmenü. Weitere Themes gibt es auf der
Projektseite von Drupal [11].
Benutzer
Den Benutzern, die man als Administrator erstellt oder die sich
selbst registriert haben, kann man verschiedenen „Rollen“ zuweisen.
Die beiden Rollen „Gast“ und „Authentifizierter Benutzer“ sind
gesperrte Gruppen, die man nicht löschen kann. Neben diesen beiden
Gruppen gibt es standardmäßig auch die Administratorengruppe.
Weitere Rollen lassen sich hinzufügen, die verschiedenen
Berechtigungen der Rollen lassen sich ebenfalls ändern. Jedem
Benutzer lässt sich daher eine „Rolle“ zuweisen. Einzelne
Benutzer kann man verständlicherweise auch sperren.
Module
Erweiterungen sind in vielen Projekten enorm wichtig, da sie den
bestehenden Funktionsumfang deutlich ausweiten können. Ein
klassisches Beispiel dafür ist der Browser Firefox. In Drupal
werden Erweiterungen „Module“ genannt. Einige Module liefert Drupal
im Kern mit, die zwar nach der Installation vorhanden, aber
zunächst deaktiviert sind. Der Admin kann diese mitgelieferten
Module selbstständig aktivieren und nutzen. Für Drupal in Version 7
gibt es etwas mehr als 1500 Module, die man installieren kann.
Monat für Monat kommen weitere Erweiterungen hinzu. Kurz nach der
Veröffentlichung von Drupal 7 Anfang Januar gab es knapp unter 1000
Module. Einige der Module für die aktuellste Version sind jedoch
noch nicht in einer finalen und stabilen Version erschienen und
befinden sich daher noch in der Entwicklungsphase. Dies hängt damit
zusammen, dass eben die Veröffentlichung von Drupal 7 noch nicht
allzu lange zurückliegt.
Die Installation von Modulen ist sehr einfach gestaltet. Man kann
entweder von einer URL installieren oder man kann das
entsprechende Paket direkt im Browser hochladen. Sehr gute und
nützliche Module findet man direkt auf der
Projekthomepage auf Modules [12].
Konfiguration, Berichte und Hilfe
Das Konfigurationsmenü von Drupal enthält alle restlichen
Einstellungen, die für die Webseite von Bedeutung sind, wie unter
anderem Einstellungen für die Lokalisierung und das System. Darüber
hinaus erstellt Drupal auch Berichte. Darunter fallen
Benachrichtigungen über Aktualisierungen vom Drupal-Kern und von
Modulen, als auch Protokolle über die häufigsten Suchbegriffe, die
häufigsten „Nicht gefunden“- und „Zugriff verboten“-Fehler.
Im Hilfebereich findet man viele Informationen, die für den Umgang
mit Drupal von Bedeutung sind. So umfasst die Hilfe viele
Erklärungen zu den Modulen. Eine ausführlichere Hilfe bietet das
Drupal Handbook [13], welches jedoch
nur in der englischen Sprache vorhanden ist. Ein deutsches Handbuch
beziehungsweise FAQ zu Drupal ist auf
Drupalcenter.de [14] zu finden.
Darüber hinaus stellt die Webseite Thoor.de einige
Screencasts [15]
zur Verfügung, die den Umgang mit Drupal erläutern.
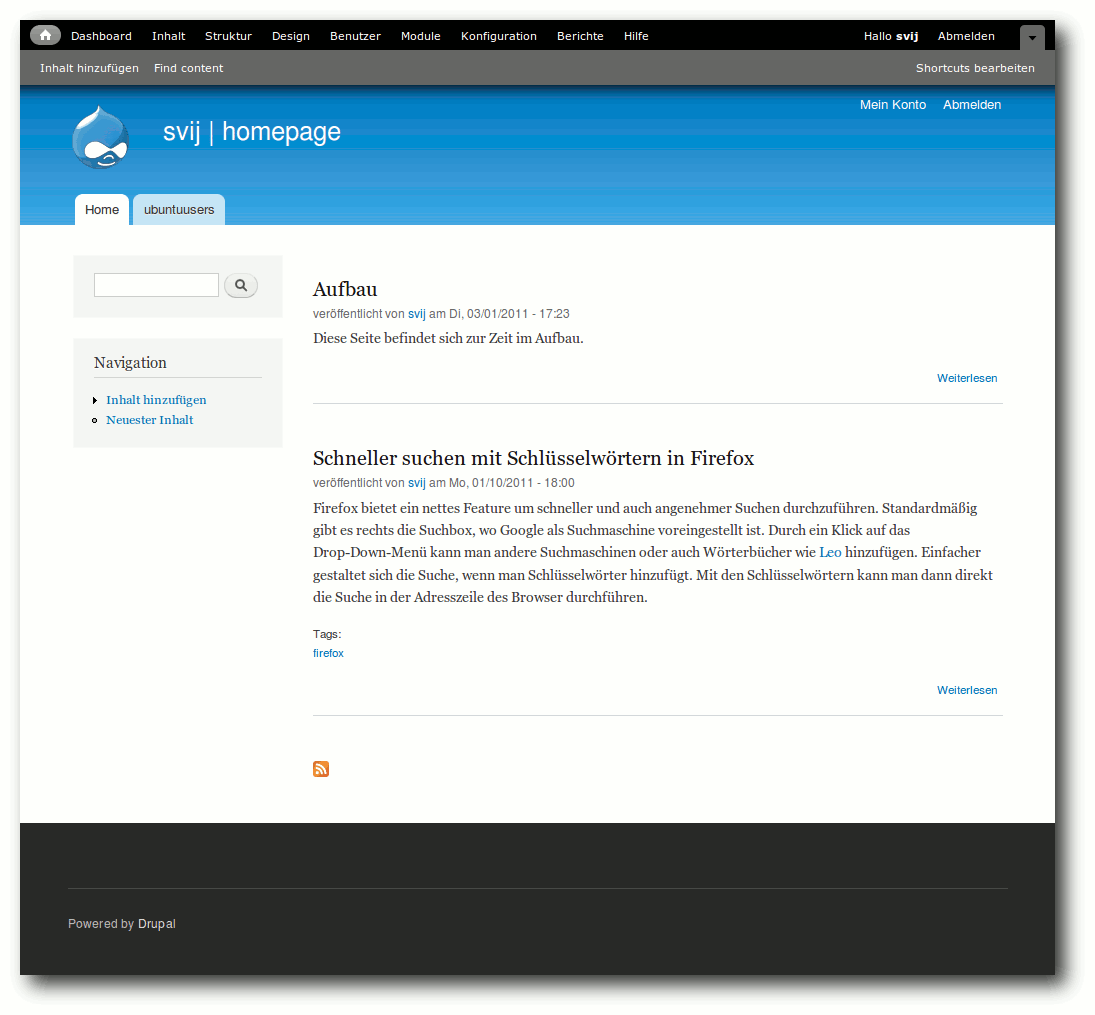
Das Standardtheme von Drupal 7.
Neues in Drupal 7
Drei Jahre hat es gedauert, bis das siebte Release von Drupal
veröffentlicht wurde. Bei diesem Release wurde eine enorme
Verbesserung des Adminstrations- bzw der Benutzeroberfläche
durchgeführt. Neben der Verbesserung der Oberfläche sind nun auch
flexible Inhaltsfelder möglich. Außerdem wurde die
Barrierefreiheit in Drupal deutlich verbessert. Des Weiteren wurde
die Datenbankunterstützung optimiert, sodass man Drupal
mit sehr vielen Datenbanksystemen nutzen kann.
Ein Blick in die Zukunft
Mit der Veröffentlichung von Drupal 7 begann im März 2011 die Arbeit
an der achten Version. Auf der DrupalCon in
Chicago [16] nannte Dries
Buytaert die Schwerpunkte für die kommende Version. Zum einen soll
die Unterstützung auf allen Geräten ausgeweitet werden, sodass
besonders mobile Geräte wie Smartphones und Tablets eine
verbesserte Oberfläche erhalten. Eine Integration von
Cloud-Diensten soll kommen, sowie eine verbesserte Trennung
zwischen Inhalt und Konfiguration.
Neben einigen weiteren Punkten gilt, dass auch weiterhin
die Benutzbarkeit und die Performance verbessert wird.
Links
[1] http://drupal.org/
[2] http://drupal.org/getting-started/before/overview
[3] http://www.drupalcenter.de/forum
[4] http://drupal.org/community
[5] http://www.mtv.co.uk/
[6] http://www.ubuntu.com/
[7] http://www.greenpeace.org.uk/
[8] http://www.freiesmagazin.de/
[9] http://drupal.org/node/769
[10] http://www.freiesmagazin.de/wortwolke
[11] http://drupal.org/project/themes
[12] http://drupal.org/project/modules
[13] http://drupal.org/handbooks
[14] http://www.drupalcenter.de/handbuch
[15] http://www.thoor.de/drupal/anleitungen/drupal-7-video-screencasts
[16] http://chicago2011.drupal.org/
| Autoreninformation |
| Sujeevan Vijayakumaran (Webseite)
testet gerne verschiedene Content-Management-Systeme
und setzt Drupal auch auf seiner eigenen Homepage ein.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Hans Müller
Eigene Hardware von einer möglichst einfach und leicht zu benutzenden
Softwarelösung ansteuern zu lassen, ist eine feine Sache. Allerdings wird das in
dem Moment schwierig, in dem exotische oder gar komplett selbst entwickelte
Hardware zum Einsatz kommt, welche von der gewählten Prozesssteuerungssoftware
nicht direkt unterstützt wird. Dann entscheidet sich, ob die bis dahin
verwendete Visualisierungslösung so flexibel und erweiterbar ist, dass sie
dennoch weiter benutzt werden kann, oder ob es sich um eine Sackgasse handelt,
aus der man ohne einen kompletten Systemwechsel nicht mehr heraus kommt.
In den ersten beiden Teilen dieser Artikelserie, welche in den
freiesMagazin-Ausgaben 01/2011 [1] und
03/2011 [2]
zu finden sind, wurde gezeigt, wie es mittels der
OpenAPC-Software möglich ist, kleine und auch größere Projekte samt des
zugehörigen HMI zu erstellen. Die dort exemplarisch vorgestellte
Rollladensteuerung hat mit der Außenwelt über die Parallelschnittstelle
kommuniziert. Nachdem der Parallelport ein mittlerweile ziemlich veraltetes
Stück Hardware ist, welches – wenn überhaupt – nur noch als Pfostenleiste auf
dem Mainboard zu finden ist, liegt der Wunsch nahe, hier etwas anderes
einzusetzen.
Alternativen gibt es viele, so kann die Kommunikation mit der Außenwelt per USB,
per PCI-IO-Karte oder vielleicht sogar per Controller an der seriellen
Schnittstelle erfolgen.
Egal welche Lösung bevorzugt wird, es ergibt sich das Problem, dass die OpenAPC-Software
diese neue Hardwareschnittstelle möglicherweise nicht von Haus aus
unterstützt. Dank des Plug-in-Konzeptes ist es aber leicht möglich, solche neuen
Devices einzubinden und damit
über die OpenAPC-Steuerungssoftware nutzbar zu
machen.
Ganz in der Tradition der ersten beiden Teile soll auch hier nun wieder mit dem
Software-Part, sprich der Implementierung eines neuen Plug-ins, der Teil eines
Projektes im Vordergrund stehen, der für den Hardwareentwickler nicht nur ein
fremdes Fachgebiet sondern meist auch ein
ungeliebtes aber notwendiges Übel ist.
Hinweis: Alle vorgestellten Dateien können über das Archiv
Heimautomatisierung.zip heruntergeladen werden
Baukastenprinzip
Plug-ins sind ein elementarer Bestandteil der OpenAPC-Visualisierungssoftware.
Innerhalb der Applikation ist das nicht so ohne weiteres zu erkennen, aber sehr
viele Funktionalitäten sind bereits in externen Plug-ins implementiert und gar
nicht Teil des Hauptprogrammes.
Ein Vorteil, der sich daraus ergibt, ist die Möglichkeit, auf dem Zielsystem nur
die Plug-ins zu installieren, welche auch wirklich benötigt werden. Das spart
Platz und beschränkt eine solche Installation auf das absolut notwendige Minimum.
Doch zuerst ein Blick in die neue Version 1.5: Auffälligste Änderung sind
Foldbars jeweils am rechten Rand des Fensters, in der die vorhandenen Funktionen
und Elemente verfügbar sind und in denen man auch leicht erkennen kann, welche
dieser Elemente als externe Plug-ins realisiert sind. Sowohl im HMI- als auch im
Flow-Editor sind all diejenigen Objekte, welche sich in den Foldbars unterhalb
der kleinen, horizontalen Trennlinie befinden, als externe Softwarekomponenten
realisiert. In den Flowelementgruppen „Daten“, „Bewegung“, „Eingang/Ausgang“
sind das sogar alle. Hier existieren gar keine Funktionen, welche vom
Hauptprogramm ausgeführt werden.
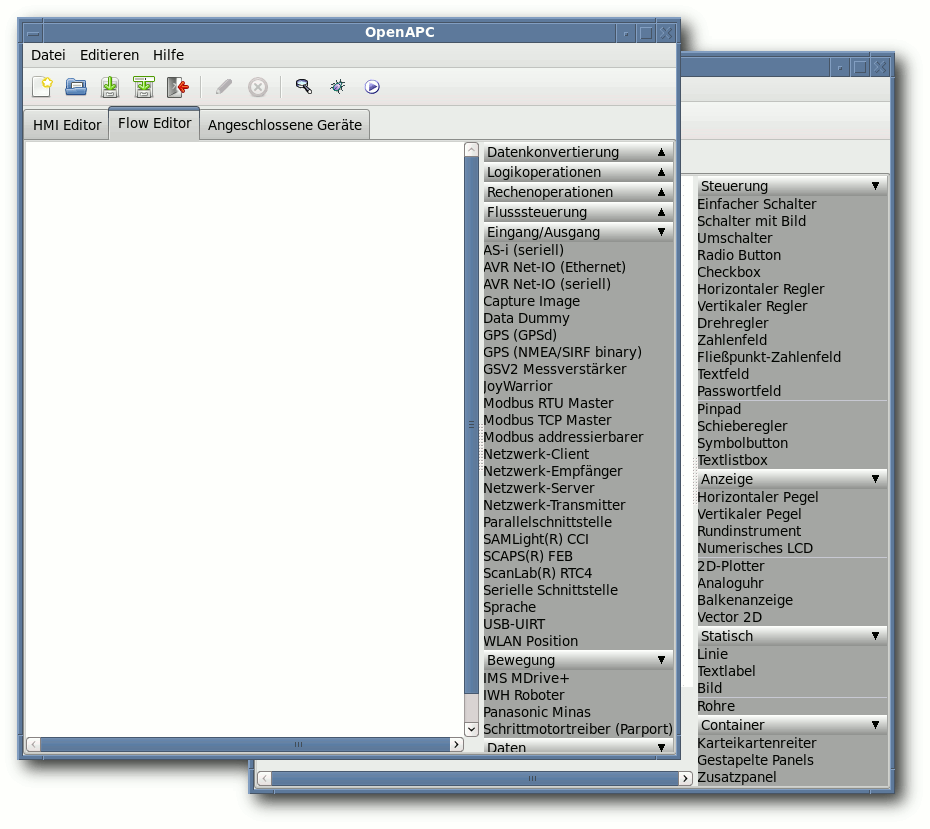
Leichter Zugriff auf HMI-und Flow-Elemente per Foldbar – Plug-ins inklusive.
An dieser Stelle ist bereits zu erahnen, dass zwischen den einzelnen Typen von
Flow-Plug-ins kein großer Unterschied besteht. Die Schnittstelle nach oben hin
ist für alle gleich. Es ist nur eine Frage der Implementierung, was diese genau
tun.
Aus diesem Grund soll hier in einem ersten Schritt ein einfaches, allgemein
nutzbares Plug-in entwickelt werden, welches gar nicht zur Kategorie „Eingang/Ausgang“ gehört, sondern in der Kategorie „Daten“ Zufallszahlen erzeugt. Dies
ist eine Funktionalität, welche dem OpenAPC-Paket noch fehlt. Das fertige Plug-in
wird dem Projekt anschließend zur Verfügung gestellt. Die Weiterentwicklung
auf ein Plug-in, welches dann tatsächlich irgendeine sehr spezielle Hardware
ansteuert (und damit zu einer anderen Kategorie gehört), bedarf dann nur noch
weniger Änderungen.
Die Werkzeuge
Um mit der Entwicklung eines eigenen Plug-ins zu beginnen, werden einige Tools
und Pakete benötigt. Das wären zum einen gcc und make, welche Teil jeder Linux-Distribution
sind und im Zweifelsfall leicht nachinstalliert werden können. Zum
anderen ist das das OpenAPC-Entwicklungspaket. Dieses findet sich z. B. auf der
OpenAPC-Downloadseite [3] im
SDK [4]. Alternativ
kann der aktuelle Stand aller Sourcen und Header aber auch per git von der
Projektseite auf fedorahosted.org beschafft werden. Ein Kommandozeilenaufruf
$ git clone http://git.fedorahosted.org/git/OpenAPC.git
erzeugt dabei eine lokale Kopie des Sourcenarchives inklusive der benötigten
Headerfiles. Kleiner Nachteil hier: Das Handbuch, welches alle
Programmierschnittstellen beschreibt, ist dort nicht enthalten. Dieses ist nur im
SDK zu finden.
In der mittels git clone erzeugten Verzeichnisstruktur finden sich im
Unterverzeichnis plugins/ gleich eine ganze Sammlung von Sourcen, welche
innerhalb des OpenAPC-Paketes diverse Plug-ins realisieren. Das ist auch ein
guter Platz, um ein eigenes Verzeichnis libio_random/ anzulegen und ein
Makefile zu erzeugen. Dabei ist es das einfachste, sich eines der existierenden
Makefiles der anderen Plug-ins zu bedienen und lediglich die Namen der
Sourcedateien anzupassen.
Zwei Eigenheiten dieser Makefiles sind jedoch zu beachten: Zum einen wird ein
Verzeichnis ../../flowplugins erwartet, in dem das Plug-in erzeugt wird,
welches aber nicht existiert und deswegen von Hand mittels
$ mkdir ../../flowplugins
angelegt werden muss. Und zum anderen wird als letzter Schritt im Makefile ein
$ sudo cp $(EXECUTABLE) /usr/lib/openapc/flowplugins/
aufgerufen, was dazu führt, dass das eben generierte Plug-in in das flowplugins-Verzeichnis
der aktuellen OpenAPC-Installation kopiert wird, sodass man es nach
einem Neustart der Applikation sofort testen kann. Damit dass klappt, muss
sudo [5] allerdings so
eingerichtet sein, dass der lokale Benutzer auch cp mit root-Rechten ausführen
darf. Ein Eintrag
username ALL = NOPASSWD: /bin/cp
in der Datei /etc/sudoers sorgt dafür, dass das auch klappt. Hier muss
username natürlich durch den Namen des Benutzers ersetzt werden, welcher cp per
sudo ausführen können soll.
Die Basis
Prinzipiell wird ein Plug-in immer in zwei verschiedenen Umgebungen ausgeführt.
Das ist zum einen der Editor, in welchem hauptsächlich
Konfigurationsfunktionalitäten gefragt sind, und zum anderen der Player,in welchem das Plug-in dann seine eigentliche Arbeit
verrichtet. Entsprechend dieser unterschiedlichen Umgebungen müssen vom Plug-in
auch unterschiedliche Funktionen bereit gestellt werden.
Technisch gesehen ist so ein Plug-in nichts weiter als eine Shared Library,
welche unter Linux durch die Dateiendung .so gekennzeichnet wird. Da diese
Libraries aber nicht beim Programmstart gelinkt sondern zur Laufzeit dynamisch
geladen werden, kommt eine Besonderheit zum Tragen: In so einem Fall muss die
Library ihre internen Daten selbst trennen, da sie bei mehrfacher Verwendung
nicht mehrfach private Speicherbereiche zugewiesen bekommt. Praktisch heißt das,
dass die OpenAPC-Software zuerst immer eine Funktion oapc_create_instance2()
aufruft, in welcher ein Datenbereich angelegt werden muss, der die aktuelle
Instanz dieses Plug-ins ausschließlich verwenden darf. Eine andere Funktion
oapc_delete_instance() kann verwendet werden, um diesen Speicherbereich wieder
freizugeben.
Das klingt jetzt komplizierter als es ist. Praktisch sind das nur wenige Zeilen
Code. Um diesen Datenbereich anzulegen, muss zuerst definiert werden, was das
Plug-in tun soll. In diesem Beispiel soll es zwei Digitaleingänge besitzen,
welche immer dann auf dem gegenüberliegenden Ausgang einen Zufallswert ausgeben,
wenn ein HIGH-Signal gesetzt wurde. Die Ausgänge bestehen dementsprechend aus
einem Digital- und einem numerischen Ausgang. Der Wertebereich des numerischen
Ausganges soll konfigurierbar sein. Damit ist die Datenstruktur klar, welche
beim Erzeugen einer Instanz angelegt werden muss:
struct libio_config
{
unsigned short version,length;
int numRange;
};
struct instData
{
struct libio_config config;
int m_callbackID;
unsigned char m_digi;
double m_num;
};
Die erste Struktur libio_config enthält die Konfigurationsdaten, welche auch
geladen und gespeichert werden sollen, weswegen sie in eine eigene Struktur
ausgelagert wurden. version und length werden hier eingesetzt, um spätere
kompatible Erweiterungen der Funktionalität zu ermöglichen, numRange speichert
den maximal zulässigen Wertebereich des Zufallswertes.
Diese Struktur ist Teil von instData, der eigentlichen Instanzdatenstruktur.
Hier kommen noch einige, nur während der Laufzeit benutzte Member hinzu, welche
später näher erklärt werden. Die Erzeugung einer solchen Plug-in-Instanz ist
damit denkbar simpel:
OAPC_EXT_API void* oapc_create_instance2(unsigned long /*flags*/)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)malloc(sizeof(struct instData));
if (!data)
return NULL;
memset(data,0,sizeof(struct instData));
data->config.numRange=500;
return data;
}
Es wird ein Speicherbereich alloziert und mit 0 initialisiert, in welchem die
oben definierte Struktur passt. Der einzige Parameter numRange wird auf seinen
Vorgabewert gesetzt. Dieser Speicherbereich ist gleichzeitig der Rückgabewert
der Funktion. Geht während der Initialisierung irgend etwas schief, so muss NULL
zurück gegeben werden.
Noch simpler geht es beim Freigeben der Instanzdaten zu:
OAPC_EXT_API void oapc_delete_instance(void* instanceData)
{
if (instanceData) free(instanceData);
}
Damit ist die gesamte Funktionalität im Zusammenhang mit den Plug-in-Instanzen
bereits bereitgestellt. Bei allen folgenden Aufrufen wird der oben angelegte
Speicherbereich immer mitgeliefert. Wenn das Plug-in dann ausschließlich diese
Daten verwendet, ist es egal, wie oft es innerhalb eines Projektes
verwendet wird. Es arbeitet automatisch immer mit den richtigen Daten.
Funktionen für den Editor
Innerhalb des Editors muss ein Plug-in folgende Aufgaben erfüllen:
- mitteilen, was es kann, wie es angesprochen werden soll und welche Ein-/
Ausgänge es besitzt;
- Daten zur Verfügung stellen, welche das Layout des Konfigurationsdialoges
festlegen;
- die vom Konfigurationsdialog zurückgegebenen Daten empfangen;
- aus einem Projektfile geladene Daten intern verarbeiten;
- die intern gehaltenen Daten so zur Verfügung stellen, dass sie in einem APCP-Projektfile
abgespeichert werden können.
Für all diese Aufgaben werden wieder Funktionen erwartet, welche vom Plug-in bereit
gestellt werden müssen.
static char libname[]="Random Generator";
OAPC_EXT_API char *oapc_get_name(void)
{
return libname;
}
Diese Funktion teilt dem Hauptprogramm mit, wie das Plug-in heißt. Dieser Name
wird dann überall dort angezeigt, wo das Plug-in verwendet wird. Wichtig hier:
der Name ist in einer globalen Variablen libname gespeichert, sodass sichergestellt
ist, dass diese Daten auch nach Verlassen der Funktion noch gültig sind.
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_get_capabilities(void)
{
return OAPC_HAS_INPUTS|OAPC_HAS_OUTPUTS|
OAPC_HAS_XML_CONFIGURATION|OAPC_ACCEPTS_PLAIN_CONFIGURATION|
OAPC_ACCEPTS_IO_CALLBACK|
OAPC_FLOWCAT_DATA;
}
Diese Funktion liefert verschiedene Flags zurück, welche festlegen, was das Plug-in
kann und welche Features es besitzt. Die ersten beiden Konstanten
OAPC_HAS_INPUTS und OAPC_HAS_OUTPUTS legen fest, dass es sowohl Ein- als auch
Ausgänge hat. Von diesen hängt dann ab, ob die im Folgenden beschriebenen zwei
Funktionen vorhanden sein müssen oder nicht. Das Flag OAPC_HAS_XML_CONFIGURATION
ist ein wenig seltsam, zumindest in der aktuellen Softwareversion muss dieses
eigentlich immer vorhanden sein. Es legt fest,
dass die Konfiguration per XML-Struktur
übermittelt wird, Alternativen dazu existieren derzeit keine. Ähnlich
scheint es sich mit OAPC_ACCEPTS_PLAIN_CONFIGURATION zu verhalten. Hierüber wird
festgelegt, wie die im Konfigurationsdialog eingegebenen Daten
zurückgeliefert werden. Auch hier ist derzeit nur diese eine Variante
vorgesehen. Anders die nächste Konstante OAPC_ACCEPTS_IO_CALLBACK. Ist diese
gesetzt, werden die Ausgänge des Plug-ins nicht zyklisch abgefragt, vielmehr
kann das Plug-in dem OpenPlayer per Callback-Funktion
mitteilen, dass neue Daten
vorhanden sind, welche von den Ausgängen abgeholt werden können. Dieses Flag ist
somit für die Verwendung des Plug-ins in Player oder Debugger relevant.
Die letzte Konstante legt fest, innerhalb welcher Kategorie das Plug-in im
Editor aufgelistet werden soll. Hiermit wurde dem Zufallszahlen-Plug-in die
Kategorie „Daten“ zugeordnet. Andere Varianten existieren mit
OAPC_FLOWCAT_CONVERSION für „Datenkonvertierung“, OAPC_FLOWCAT_LOGIC für
„Logikoperationen“, OAPC_FLOWCAT_CALC für „Rechenoperationen“, OAPC_FLOWCAT_FLOW
für „Flusssteuerung“, OAPC_FLOWCAT_IO für „Eingang/Ausgang“ und
OAPC_FLOWCAT_MOTION für die Flow-Elemente-Kategorie „Bewegung“.
Mit den nächsten beiden Funktionen wird der Applikation mitgeteilt, dass die
Digitaleingänge 0 und 1 sowie die Ausgänge 0 (digital) und 1 (numerisch)
verwendet werden sollen:
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_get_input_flags(void)
{
return OAPC_DIGI_IO0|OAPC_DIGI_IO1;
}
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_get_output_flags(void)
{
return OAPC_DIGI_IO0|OAPC_NUM_IO1;
}
Hier ist darauf zu achten, dass jeder Ausgang nur einmal mit einem
entsprechenden Flag für einen Datentyp belegt wird. Eine Angabe wie z. B.
OAPC_CHAR_IO7 - OAPC_BIN_IO7 wäre unzulässig, da ein Ein- bzw. Ausgang nur exakt
einen Datentyp unterstützen und nicht gleichzeitig für Text- und Binärdaten
benutzt werden kann.
Die nächste Funktion – bzw. die Daten, welche von ihr erzeugt und zurückgegeben
werden – haben es in sich. Hier wird der Applikation mitgeteilt, welches Symbol
zur Verwendung im Flow-Editor benutzt werden soll, wie das Layout des
Konfigurationsdialoges aussehen soll und welche Parameter mit welchen
Wertebereichen dort angezeigt werden sollen:
OAPC_EXT_API char *oapc_get_config_data(void* instanceData)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
sprintf(xmldescr,xmltempl,
flowImage,
data->config.numRange);
return xmldescr;
}
Wie zu sehen ist, passiert hier nicht all zu viel. Die Informationen selbst
stecken in einer XML-Struktur, welche an dieser Stelle zusammengesetzt und
zurückgegeben wird. Diese besteht im Beispiel aus drei Teilen: der
Definition des Bildes für den Floweditor, der Definition des Panels für die
Parameter sowie der Definition des Hilfe-Panels, in welchem die Ein- und
Ausgänge sowie deren Funktion erklärt werden:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<oapc-config>
<flowimage>%s</flowimage>
<dialogue>
<general>
<param>
<name>numrange</name>
<text>Numeric Range</text>
<type>integer</type>
<default>%d</default>
<min>2</min>
<max>10000</max>
</param>
</general>
<helppanel>
<in0>CLK - generate random digital value</in0>
<in1>CLK - generate random numeric value</in1>
<out0>RND - random digital value</out0>
<out1>RND - random numeric value</out1>
</helppanel>
</dialogue>
</oapc-config>
An Stelle des Platzhalters %s im XML-Tag <flowimage /> wird das Bild
eingefügt. Hier wird ein Base64-Encodiertes PNG-Bild in der Größe 106x50 Pixel
erwartet. PNG-Bilder lassen sich mit quasi jedem Zeichenprogramm erzeugen, die
Base64-Codierung kann beispielsweise online gemacht
werden [6]. Das Ergebnis
dieser Codierung ist dann ein Textstring, welcher nur noch aus druckbaren
Zeichen besteht, die sich als normales Character-Array in die XML-Struktur
einfügen.
Mit Hilfe des <general />-Tags wird eine eigene Tab-Pane erzeugt, in der alle
Elemente angeordnet werden, welche sich zwischen diesen befinden. Hier in diesem
Beispiel wird ein Eingabefeld (<param></param>) für
Ganzzahlen (<type>integer</type>) angelegt, welches Werte im Bereich
von 2 (<min>2</min>) bis 10000 (<max>10000</max>) akzeptiert und mit dem Wert
aus data->config.numRange vorbelegt ist (<default>%d</default>). An dieser
Stelle wird der Wert aus der Variablen numRange für den Default-Wert verwendet,
damit sichergestellt ist, dass bereits geänderte und möglicherweise aus einem
Projektfile geladene Werte auch korrekt angezeigt werden.
Alles, was vom <helppanel>-Tag eingeschlossen ist, landet wiederum in einer
eigenen Tab-Pane „Beschreibung“, in der Sinn und Zweck der verschiedenen Ein-
und Ausgänge noch einmal kurz erklärt sind. Diese Pane sollte in keinem Plug-in fehlen, da es als Gedächtnisstütze hilfreich ist.
Ein besonderes Augenmerk soll hier noch auf das Tag <name>numrange</name> für
das Integer-Eingabefeld gelegt werden. Der vergebene Name muss innerhalb
eines Plug-ins eindeutig sein, da er benötigt wird, um zu ermitteln, welchen
Wert der Benutzer hier eingegeben hat:
OAPC_EXT_API void oapc_set_config_data(void* instanceData,const char *name,const char *value)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
if (strcmp(name,"numrange")==0) data->config.numRange=atoi(value);
}
So bald das Konfigurationspanel eines Plug-ins mit „OK“ verlassen wurde, kommt
diese Funktion zum Zug. Das passiert mehrfach – für jedes in der XML-Struktur
definierte Eingabefeld je einmal. Dabei wird im Parameter name der eindeutige
Name des Eingabefeldes übergeben und in value der Wert, der vom Benutzer gewählt
wurde. Dieser liegt dabei in jedem Fall als Character-Array vor und muss
gegebenenfalls entsprechend konvertiert werden. Die Umwandlung in eine Ganzzahl
geschieht hier über die Funktion atoi().
Noch kurz ein Wort zur oben aufgeführten XML-Struktur: Hier wurden zwei
Paneltypen und ein Typ für Dateneingaben vorgestellt. Tatsächlich existieren
wesentlich mehr Möglichkeiten. Neben zusätzlichen Panels, welche jeweils eigene
Namen haben können, gibt es auch Auswahlfelder, statische Texte, Eingabefelder
für Texte und Fließpunkt-Zahlen, Dateiauswahldialoge, Buttons zur Auswahl einer
Farbe und anderes mehr. Damit ist im Prinzip jede Art von Konfigurationsdialog
machbar.
Was jetzt noch fehlt, sind Möglichkeiten, die lokal gehaltenen
Konfigurationsdaten in ein
gemeinsames Projektfile zu bringen bzw. die dort
gespeicherten Daten zurück zu erhalten, wenn so eine .apcp-Projektdatei geladen
wird. Auch das ist nicht wirklich kompliziert, allerdings gilt es, ein paar
Kniffe zu beachten.
static struct libio_config save_config;
OAPC_EXT_API char *oapc_get_save_data(void* instanceData,unsigned long *length)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
*length=sizeof(struct libio_config);
save_config.version =htons(1);
save_config.length =htons(*length);
save_config.numRange=htonl(data->config.numRange);
return (char*)&save_config;
}
Die obige Funktion erwartet als Rückgabewert einen Pointer auf den Speicherbereich,
in welchem die zu speichernden Daten liegen und in der Variablen, auf die length
zeigt, deren Größe. Im Prinzip ist hier der Inhalt der zuvor angelegten Struktur
libio_config zurückzugeben – in dieser befindet sich der zu speichernde
Parameter numRange. Da das Plug-in zum einen kompatibel zu möglichen zukünftigen
Änderungen bleiben soll und zum anderen auch auf anderen Rechnerarchitekturen
funktionieren muss, sind allerdings einige Maßnahmen erforderlich.
So werden zusätzlich eine Versionsnummer für die Datenstruktur und deren Länge
gespeichert und in den zu übergebenden Daten abgelegt.
Des Weiteren werden alle Member der Struktur libio_config mittels htons() und
htonl() in das plattformunabhängige Netzwerk-Datenformat umgewandelt. Dieses
dient eigentlich dazu, die direkte Datenübertragung zwischen Rechnern
unterschiedlicher Architektur zu ermöglichen, kann aber auch dann problemlos
verwendet werden, wenn diese Daten „nur“ gespeichert werden. Es ist lediglich zu
beachten, das beim Laden die Rückkonvertierung mittels ntohs() und ntohl()
stattfindet:
OAPC_EXT_API void oapc_set_loaded_data(void* instanceData,unsigned long length,char *loadedData)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
if (length>sizeof(struct libio_config)) length=sizeof(struct libio_config);
memcpy(&save_config,loadedData,length);
data->config.version =ntohs(save_config.version);
data->config.length =ntohs(save_config.length);
if ((data->config.version!=1) || (data->config.length!=sizeof(struct libio_config)))
{
// do conversion from earlier versions here
}
data->config.numRange=ntohl(save_config.numRange);
}
Die obige Funktion handhabt die umgekehrte Richtung: In loadedData werden die
geladenen Daten mit der Länge length übergeben und anschließend konvertiert. An
dieser Stelle ist bei späteren Versionen des Plug-ins dann auch zu überpüfen, ob
die geladenen Daten eventuell konvertiert werden müssen.
Damit ist ein wesentlicher Teil des Plug-ins fertiggestellt. Nachdem es
erfolgreich mittels eines simplen Aufrufes von
$ make
in der Konsole kompiliert wurde, kann es im Flow-Editor des OpenEditors erstmalig
getestet werden.
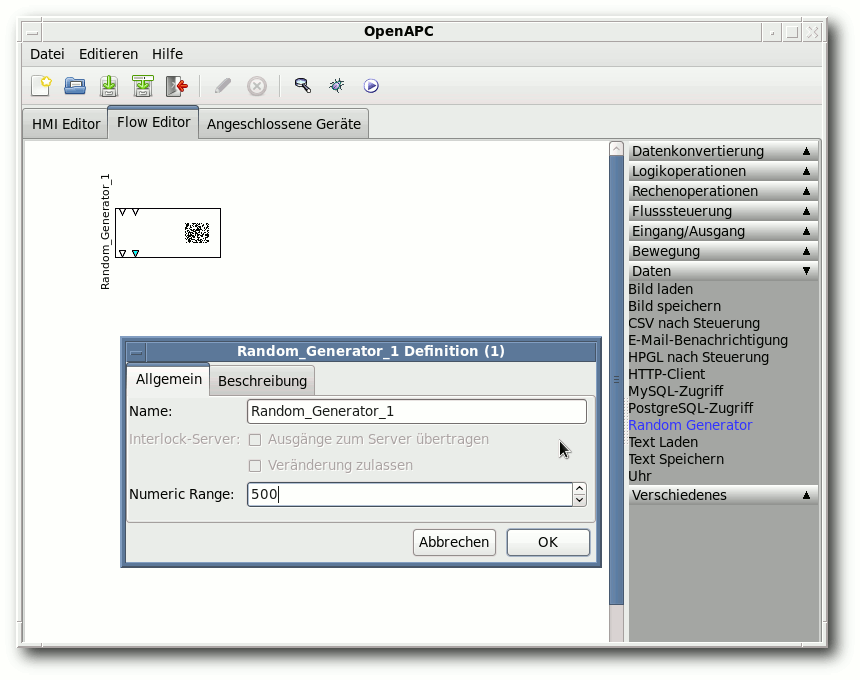
Symbol und Konfigurationsdialog des ersten eigenen Plug-ins.
Funktionen für den Player
Nachdem bis eben auch einige Funktionen beschrieben wurden, welche in Player und
Editor verwendet werden, geht es jetzt an die eigentliche Implementierung der
Plug-in-Funktionalität. Die folgenden Funktionen werden im Player bzw. Debugger
ausschließlich dazu benutzt, um einem Plug-in überhaupt „Leben“ einzuhauchen.
Wird ein Plug-in im Player oder Debugger gestartet, ist der erste Aufruf vom
Player an das Plug-in auch wieder der zum Erzeugen einer neuen Instanz per
oapc_create_instance2(). Anschließend werden die gespeicherten Werte mittels
eines Aufrufs der Plug-in-Funktion oapc_set_loaded_data() übergeben. Beide
Funktionen existieren bereits.
Im nächsten Schritt versucht der Player nun, das Plug-in zu initialisieren:
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_init(void* instanceData)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)malloc(sizeof(struct instData));
srand(time(NULL));
return OAPC_OK;
}
Die einzig erforderliche Initialisierung für dieses Beispiel ist der Aufruf von
srand() für den Zufallsgenerator. Wäre dies ein Plug-in, mit dem Hardware
angesteuert werden müsste, so wäre diese Funktion ein guter Ort, um alle
notwendigen Maßnahmen wie das Öffnen des zugehörigen Geräte-Devices, das Senden
der Firmware oder von Initialisierungsparametern zu erledigen. Diese Werte
sollten dann wieder aus der Struktur instData kommen und konfigurierbar sein.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch die Returncodes dieser Funktion, diese
geben darüber Auskunft, was schiefgegangen ist und sorgen dafür, dass der Benutzer
durch den Player auch gleich eine aussagekräftige Fehlermeldung angezeigt
bekommt. Hier existieren folgende vordefinierte Codes, welche – sofern sie zum
aufgetretenen Problem passen – im Prinzip für fast alle Funktionen verwendet
werden können:
- OAPC_OK – die Operation war erfolgreich, alles ist in Ordnung
- OAPC_ERROR_CONNECTION – es ist ein Verbindungsproblem aufgetreten (z. B. bei
Netzwerkkommunikation)
- OAPC_ERROR_DEVICE – ein benötigtes Geräte-Device steht nicht zur Verfügung
bzw. konnte nicht erfolgreich geöffnet werden
- OAPC_ERROR_NO_DATA_AVAILABLE – es wurden Daten abgefragt, obwohl momentan
keine zur Verfügung stehen (dieser Returncode ist bei den Funktionen zum Holen
von Ausgangsdaten wichtig)
- OAPC_ERROR_NO_SUCH_IO – der spezifizierte Ein-/Ausgang existiert nicht (dieser
Returncode ist ebenfalls für die I/O-Funktionen wichtig und würde etwas
signalisieren, was so eigentlich nicht auftreten kann, wenn OpenAPC-Software
und Plug-in fehlerfrei sind)
- OAPC_ERROR_NO_MEMORY – es ist nicht genügend Speicher vorhanden
- OAPC_ERROR_RESOURCE – eine sonstige benötigte Ressource steht nicht zur
Verfügung
- OAPC_ERROR_AUTHENTICATION – es ist ein Fehler bei einer Authentifizierung
aufgetreten, die für eine Operation benötigten Zugangsdaten sind falsch
- OAPC_ERROR_CONVERSION_ERROR – es war nicht möglich, eine erforderliche
Datenkonvertierung durchzuführen
- OAPC_ERROR_STILL_IN_PROGRESS – es ist nicht möglich, neue Daten
entgegenzunehmen, da die vorhergehende Operation noch läuft (ist in erster
Linie bei den Funktionen zum Setzen von Eingangsdaten sinnvoll)
- OAPC_ERROR_RECV_DATA – der Empfang von Daten ist fehlgeschlagen
- OAPC_ERROR_SEND_DATA – das Senden von Daten ist fehlgeschlagen
- OAPC_ERROR_PROTOCOL – Fehler in einem (Kommunikations-)Protokoll
- OAPC_ERROR_INVALID_INPUT – die Eingangsdaten sind ungültig (z. B. außerhalb
eines zulässigen Bereiches)
- OAPC_ERROR – es ist ein sonstiger Fehler aufgetreten, der durch die anderen
Codes nicht abgedeckt wird
Auch Teil der Plug-in-Initialisierung ist der Aufruf einer Funktion, welcher nur
dann erfolgt, wenn das Capability-Flag OAPC_ACCEPTS_IO_CALLBACK gesetzt war:
OAPC_EXT_API void oapc_set_io_callback(void* instanceData,lib_oapc_io_callback oapc_io_callback,unsigned long callbackID)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
m_oapc_io_callback=oapc_io_callback;
data->m_callbackID=callbackID;
}
Hier teilt der Player mit, über welche Funktion er darüber informiert werden
möchte, wenn neue Daten vorhanden sind, welche von ihm anschließend abgeholt werden
können. Der entsprechende Funktionspointer oapc_io_callback sowie der ebenfalls
benötigte Callback-Code callbackID werden für die spätere Verwendung
gespeichert. Der Funktionspointer darf dabei in einer globalen Variable landen,
da er keiner spezifischen Plug-in-Instanz zugeordnet ist, sondern offenbar für
alle Plug-ins immer auf den gleichen Einsprungpunkt zeigt.
Wichtig ist auch die Deinitialisierung, welche beim Beenden des Players erfolgt,
hierfür wird ebenfalls eine eigene Funktion benötigt:
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_exit(void* instanceData)
{
return OAPC_OK;
}
Für dieses Beispiel-Plug-in muss an dieser Stelle nichts unternommen werden, da
keine Speicherbereiche freizugeben oder Geräte-Devices zu schließen sind. Das
wäre wieder anders, wenn Hardware im Spiel ist, die vom Plug-in angesprochen
wird.
Alle folgenden Funktionen dienen der Datenkommunikation und existieren als „set“-Funktion
zum Setzen von Eingangsdaten, als „get“-Funktion zum Abholen von
Ausgangsdaten. Diese gibt es dann dann jeweils in Varianten für Digital-,
numerische, Binärdaten und Zeichenketten. Ob und welche dieser Funktionen
vorhanden sein müssen und vom Player erwartet werden, hängt von den oben
gesetzten IO-Flags OAPC_xxx_IOy für Ein- und Ausgänge ab.
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_set_digi_value(void* instanceData,unsigned long input,unsigned char value)
{
struct instData *data;
if (value!=1) return OAPC_OK;
data=(struct instData*)instanceData;
if (input==0)
{
if (rand()>RAND_MAX/2) data->m_digi=1;
else data->m_digi=0;
m_oapc_io_callback(OAPC_DIGI_IO0,data->m_callbackID);
}
else if (input==1)
{
double factor;
factor=(1.0*data->config.numRange)/RAND_MAX;
data->m_num=(int)(rand()*factor);
m_oapc_io_callback(OAPC_NUM_IO1,data->m_callbackID);
}
else return OAPC_ERROR_NO_SUCH_IO;
return OAPC_OK;
}
An dieser Stelle findet die Implementierung der Zufallsfunktion für die
Eingänge 0 (if (input==0)) und 1 (else if (input==1)) statt. Mittels der
Funktion rand() wird ein neuer Zufallswert ermittelt und in der zugehörigen
Variable data->m_digi bzw. data->m_num gespeichert. Wird irrtümlich ein Wert für
einen anderen Eingang übergeben, so quittiert die Funktion das mit Hilfe des
Rückabewertes OAPC_ERROR_NO_SUCH_IO.
An dieser Stelle wird nun auch Gebrauch von der Callback-Funktion gemacht: Der
Funktionspointer m_oapc_io_callback() dieser Funktion wird jetzt verwendet, um
dem Player bzw. Debugger mitzuteilen, dass neue Daten am Digitalausgang 0
(OAPC_DIGI_IO0) bzw. am numerischen Ausgang 1 (OAPC_NUM_IO1) zur Verfügung
stehen. Die eindeutige Zuordnung zu dieser speziellen Instanz des Plug-ins
geschieht dabei über den zweiten Parameter data->m_callbackID welcher der
Callback-Funktion mitgegeben wird.
Infolge dieses Funktionsaufrufes wird jetzt die jeweilige „get“-Funktion des
Plug-ins vom Debugger bzw. Player aufgerufen, um die neuen Daten abzuholen:
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_get_digi_value(void* instanceData,unsigned long output,unsigned char *value)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
if (output==0) *value=data->m_digi;
else return OAPC_ERROR_NO_SUCH_IO;
return OAPC_OK;
}
OAPC_EXT_API unsigned long oapc_get_num_value(void* instanceData,unsigned long output,double *value)
{
struct instData *data;
data=(struct instData*)instanceData;
if (output==1) *value=data->m_num;
else return OAPC_ERROR_NO_SUCH_IO;
return OAPC_OK;
}
Beide überprüfen, ob der Aufruf für den richtigen Ausgang erfolgt (if (output==…)
und geben dann den gespeicherten Zufallswert data->m_digi bzw. data->m_num
zurück. Wäre echte Hardware im Spiel, wäre das der Ort, an dem von der Hardware
gelesene Daten an den Player übergeben werden könnten. Ähnlich die „set“-Funktionen:
Diese würden die Schnittstelle von der Software hin zum Gerät
darstellen.
Ich habe fertig!
Auch wenn das auf den ersten Blick etwas kompliziert aussieht, so geht die Implementierung
von eigenen Plug-ins nach einer Weile recht flüssig von der
Hand. An gewisse Merkwürdigkeiten wie Capability-Flags, zu denen eigentlich gar
keine Alternativen existieren, gewöhnt man sich und der Rest erscheint einem irgendwann logisch.
Auch ist der umfangreiche Fundus an Sourcen und fertigen Plug-ins durchaus hilfreich – sei es, um aus deren
Programmierung zu lernen oder sei es, um sie als Basis für eigene Plug-ins zu
verwenden. Die Lizenz der allermeisten Plug-ins lässt es sogar zu, dass diese
verändert werden, ohne dass die Sourcen anschließend veröffentlicht werden
müssen [7].
Es bleibt noch zu erwähnen, dass dieser kleine Artikel wirklich nur als Einstieg in
die Plug-in-Programmierung gedacht ist. Die Möglichkeiten innerhalb der OpenAPC-Software
sind weit umfassender.
So existieren nicht nur wesentlich mehr
Konfigurationselemente, welche sich per XML erzeugen lassen, auch können
visuelle Plug-ins entwickelt werden, welche dem HMI ganz neue grafische Elemente
hinzufügen. Auch zu erwähnen wäre die mitgelieferte Bibliothek liboapc.so. Diese
bietet viele zum Teil recht einfache Funktionalitäten, diese aber in einer
plattformunabhängigen Version. So ist es damit beispielsweise nicht notwendig,
Zugriffe auf die serielle Schnittstelle für jedes Betriebssystem separat zu
implementieren. Hier bietet diese Bibliothek bereits fertige Funktionalitäten.
Auch bei eher trivial anmutenden Features wie Netzwerkzugriffen,
Threading-Funktionalitäten oder Timern sollten möglichst immer die Funktionen
der liboapc.so verwendet werden, um einen möglichen Portierungsaufwand auf andere
Plattformen klein zu halten. Denn auch wenn ein
pthread_create() [8] unter Linux
ganz simpel ist – unter Windows existiert es schlichtweg nicht und würde an
dieser Stelle schon wieder diverse #ifdef's erforderlich machen.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-01
[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-03
[3] http://www.openapc.com/download.php
[4] http://www.openapc.com/download/index.php?c=1&f=opensdk.zip
[5] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Sudo
[6] http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp
[7] http://www.openapc.com/oapc_license.php
[8] http://www.manpagez.com/man/3/pthread_create/
| Autoreninformation |
| Hans Müller
ist als Elektroniker beim Thema Automatisierung mehr der
Hardwareimplementierung zugeneigt als dem Softwarepart und hat demzufolge
auch schon das ein oder andere Gerät in der privaten Wohnung verkabelt.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Niedermair
Das Buch „Praxiskurs Unix-Shell“ hat sich die Aufgabe gestellt, den
Anfänger mit den Standard-Shell-Skripten unter Linux vertraut zu
machen, sodass wiederkehrende Abläufe automatisiert werden können
und der Leser Shell-Skripte selbst erstellen kann. Im Mittelpunkt
stehen dabei die bash, die Korn-, die Bourne- und die TC-Shell. Mit
Übungen sollen die einzelnen Gebiete vertieft und geübt werden.
Was steht drin?
Das Buch ist in 13 Kapitel aufgeteilt und hat mit Index und
Informationen über den Autor 293 Seiten, wobei 10 Seiten auf das
Inhaltsverzeichnis und das Vorwort entfallen.
Im ersten Kapitel (16 Seiten) geht es um die Grundlagen. Hier wird
Allgemeines zur Unix-Shell, zum Betriebssystem, zu Befehlen und
deren Kombination geschrieben. Am Ende werden dann die
verschiedenen Shell-Familien mit ihrem Hintergrund kurz erläutert.
Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer kleinen Übung, bei der der
Leser seine Standard-Shell ermitteln kann.
Im zweiten Kapitel (30 Seiten) unternimmt der Leser die ersten
Schritte mit der Shell. Dabei wird auf die Historyfunktion und die
Tastenkürzel mit Emacs- bzw. vi-Belegung eingegangen. Anschließend
wird das Verzeichnissystem mit seinen Pfadangaben und wie
man sich darin absolut bzw. relativ bewegt erläutert. Abgeschlossen wird das
Kapitel mit den Möglichkeiten der Manpages und der
info-Dokumentation – vor allem, wie man diesen Information entlockt.
Das dritte Kapitel (30 Seiten) behandelt das Arbeiten mit Dateien.
Zuerst wird dabei auf die Datentypen (Datei, Verzeichnis, Link,
Pipe …) eingegangen. Anschließend geht es um die Standarddateien
und die Datenströme (stdin, stdout und stderr). Danach wird das
Dateisystem erläutert, insbesondere wie man freien und belegten Platz ermitteln
kann und wie Zugriffsrechte verwaltet werden, gefolgt von der
Benutzer- und Gruppenverwaltung. Im Anschluss folgen
Dateioperationen, beispielsweise Verzeichnisse und Dateien anlegen, löschen und
verschieben. Abgeschlossen wird das Kapitel mit dem Quoting von
Parametern.
Im vierten Kapitel (31 Seiten) geht es um das Kombinieren und
Erweitern von Befehlen, z. B. die Umleitung der Ein- und Ausgabe.
Im Anschluss folgt das Arbeiten mit Pipes,
das Definieren und Löschen von Variablen und die Definition von
Aliases. Nicht fehlen darf die Verknüpfung von einzelnen Befehlen
über Pipes oder entsprechende Ein- und Ausgabeumleitungen. Am Ende des
Kapitels wird mit Prozessen gearbeitet, erläutert, wie man diese in den
Hintergrund schiebt, Prioritäten verändert oder Signale an diese
schickt.
Im fünften Kapitel (12 Seiten) wird die Arbeitsumgebung angepasst.
Hier wird kurz auf die entsprechenden Konfigurationsdateien, beispielweise .profile, eingegangen und die speziellen Umgebungsvariablen wie
PATH, LD_LIBRARY_PATH, MANPATH, PAGER und PS1
etc. für den Prompt vorgestellt.
Im sechsten Kapitel (26 Seiten) lernt der Leser, Textdaten zu
verarbeiten und reguläre Ausdrücke zu verwenden. Kurz wird
dabei auf awk und sed eingegangen. Am Ende werden noch die
Archivierungsprogramme zip und tar besprochen.
Im siebten Kapitel (9 Seiten) steht das Netzwerk im Fokus. Hier
werden Telnet, die secure shell (SSH), ftp und scp kurz vorgestellt.
Das achte Kapitel (29 Seiten) behandelt die Grundlagen der
Shell-Skripte. Es wird hier mit Parametern gearbeitet, gezeigt, wie
man eine bestimmte Shell für ein Skript festlegt und einfache
Kontrollstrukturen, wie Verzweigung und Schleifen anwendet.
Im neunten Kapitel (35 Seiten) werden komplexere Shell-Skripte für
Fortgeschrittene vorgestellt. Es beginnt mit Inline-Dokumenten und
zeigt, wie man z. B. temporäre Dateien wieder aufräumt. Ein kurzer
Ausflug zeigt, wie man mit getopts Parameter verwaltet und wie man
Funktionen in einer Shell erstellt und aufruft. Damit Skripte auch
automatisch zu bestimmten Zeiten starten, gibt es eine kleine
Einführung in cron-Jobs. Für den Systemstart wird System-V Init
erläutert. Zum Ende werden Skripte
gezeigt, die eine Log-Rotation
durchführen und Verzeichnisarchive klonen.
Im zehnten Kapitel (13 Seiten) geht es um den Systemeditor vi. Dabei
werden die wichtigsten Kommandos kurz erläutert.
Das elfte Kapitel (17 Seiten) beinhaltet die Lösungen zu den
Übungen. Teilweise wird hier nur die Lösung gezeigt, manchmal auch
eine zusätzliche Beschreibung.
Im zwölften Kapitel (6 Seiten) geht es dem Autor um „Folklore“. Es
wird kurz „Unsinn mit der Shell“ und die RFC 1925 gezeigt.
Kapitel dreizehn (14 Seiten) enthält eine Liste (sortiert) aller
behandelten Befehle, Variablen und Operatoren mit einer kurzen
Beschreibung.
Zum Schluss folgt der Index
mit 8 Seiten und eine Seite mit
Informationen über den Autor und das Design des Buchs (Umschlag,
verwendete Schrift …).
Wie liest es sich?
Das Buch ist für den Anfänger geschrieben und beschreibt Schritt für
Schritt die einzelnen Bereiche. Der Text ist verständlich und man
kann diesem auch ohne Schwierigkeiten folgen. Dabei wird je nach
Fall zwischen den einzelnen Shells (bash, Korn, Bourne und TC)
unterschieden. Der erfahrenere Benutzer wird die eine oder andere
Seite überspringen. Zu den Kapiteln gibt es jeweils passende
Übungen, die den vorher beschriebenen Inhalt durch praktische
Anwendung vertiefen.
Kritik
Das Buch gibt eine
Einführung in die Shell, zum „Virtuosen“, wie auf dem Einband vesprochen, fehlt noch sehr
viel. Jedoch ist das Buch für einen Anfänger gut geeignet. Der Autor
lässt bei einigen Bereichen Informationen weg, wie z. B. bei
den Dateirechten (SUID, GUID und das Sticky-Bit). Unter dem Aspekt
der didaktischen Reduktion kann man dies aber für ein Anfängerbuch
akzeptieren. Die Übungen sind für den Anfänger gut geeignet und die
Lösungen sind da, wo es notwendig ist, ausreichend erklärt.
Das Kapitel 12 macht den Anschein, als ob Autor hier noch Seiten
füllen wollte oder musste. Dem Anfänger bringen diese Informationen
wenig.
Der Index ist bei diversen Einträgen mit zusätzlichen Stichworten
wie Befehl, Schlüssel, Programm, Variable etc. versehen. Für den
Anfänger wirkt dies eher verwirrend, da dieser meist nicht zwischen
einem Befehl und einem Programm unterscheiden kann.
Abschließend muss man das Buch für den Anfänger als gut bezeichnen.
Für den schon
erfahrenen Benutzer ist das Buch weniger geeignet.
| Buchinformationen |
| Titel | Praxiskurs Unix-Shell |
| Autor | Martin Dietze |
| Verlag | O'Reilly |
| Umfang | 293 Seiten |
| ISBN | 978-3-8972-1565-8 |
| Preis | 19,90 € |
| |
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair
ist Lehrer an der Münchener IT-Schule
und unterrichtet hauptsächlich
Programmierung, Datenbanken und IT-Technik. Er beschäftigt sich
seit Jahren mit Unix und unterrichtet Linux für die
LPI-Zertifizierung.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
Das Buch „Computergeschichte(n) – nicht nur für Geeks“ möchte, wie
der Titel schon andeutet, einen Streifzug durch die Geschichte und
Geschichten rund um den Computer anbieten. Und zwar so, dass nicht
nur Geeks [1] beim Lesen des Buchs
Spaß haben. Nun neigen gerade erfahrenere Computernutzer, so wie
der Autor H. R. Wieland, seines Zeichens Diplom-Informatiker und
Softwareentwickler, manchmal zur Geekigkeit, sodass Geschichten für
„normale“ Leser schnell langweilig werden. Daher stellt sich die
Frage, wie das vorliegende Buch mit dem Thema umgeht.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem Verlag Galileo Computing für die
Bereitstellung eines Rezensionsexemplares.
Von der Antike zur Neuzeit
Das Buch ist chronologisch aufgebaut und beginnt zeitlich viel
früher, als man es zunächst erwartet, nämlich in der Antike zur
Zeit Alexanders des Großen (ca. 350 v. Chr.). Hier wurden bereits die
ersten Rechenmaschinen, seinerzeit natürlich voll mechanisch,
genutzt. Von dort aus startend geht es dann vom Mittelalter über
die Neuzeit bis hin zur Gegenwart. Beleuchtet werden dabei
fortgeschrittene mechanische Rechner, die ersten „echten“ Computer
wie der Zuse und ENIAC, die „Klassiker“ aus den 70ern und 80ern wie
der Apple I, der C64 und der Cray 1 (der erste „Superrechner“)
sowie die aktuellen Hochleistungsrechner und verteilte Rechner in
Form von Grid-Computing.
Alles über Software
Die folgenden Kapitel widmen sich dann konsequenterweise der
Software in Form von Programmiersprachen. Begonnen wird hier mit
Assembler, eben weil die ersten „richtigen“ Computer quasi nur in
Assembler programmiert werden konnten. Darauf folgt eine kurze
Einführung in das Konzept und den Aufbau der Turingmaschine, bevor
ein Überblick über die historische und aktuelle
Programmiersprachenlandschaft gegeben wird. Der
Programmiersprachenteil ist vergleichsweise kurz, worauf in der
Einleitung des Buchs aber auch explizit hingewiesen wird. Das
Anliegen des Buchs ist ja die IT-Geschichten im Allgemeinen, ohne
einen bestimmten Fokus zu legen. Außerdem gibt es aus dem gleichen
Verlag auch ein Buch, welches sich explizit mit verschiedenen
Programmiersprachen beschäftigt („Coding for Fun“, siehe Rezension in
freiesMagazin 04/2009 [2]).
Nach den Programmiersprachen folgt ein Kapitel zur
Anwendungssoftware. Hier findet man eine Mischung aus Geschichten
rund um die Software an sich sowie Geschichten zu den Höhen (und
Tiefen) diverser Softwarefirmen wie Microsoft, Oracle, Novell und
Ashton-Tate. Nahtlos daran an schließt sich das Kapitel zu
Betriebssystemen, wobei hier der Schwerpunkt auf der Geschichte von
DOS und den frühen
Windows-Versionen sowie Linux liegt. Den
Abschluss der Softwarekapitel bilden die Computerspiele, wobei hier
diverse Klassiker und wegweisende Spiele aus allen
Epochen vorgestellt werden.
Die Weiten des Internet
Das folgende Kapitel handelt vom „Netz der Netze“, dem Internet.
Hier wird in der erster Linie die Entstehungsgeschichte des
Internets erzählt. Wo notwendig und passend wird dabei aber ein
wenig Technik eingestreut, wie z. B. „Was ist IPv4/IPv6?“ oder „Wie
funktioniert DNS?“ Der zweite Teil des Kapitels widmet sich dann
den Browsern, angefangen von den allerersten Browsern bis zum
Browserkrieg „Netscape gegen Microsoft“.
Der dritte und letzte Teil des Buchs trägt den Titel „die Zukunft“
und handelt von aktuellen Themen. Es gibt zwei vergleichsweise
kurze Kapitel zur Virtualisierung und zum Cloud-Computing, gefolgt
vom letzten, ausführlichen Kapitel „Denkmaschinen“. Hier wird
die noch junge Geschichte
und Entwicklung der Quantencomputer
erzählt. Den Abschluss bildet die Beschreibung und Möglichkeiten
von zellulären Automaten.
Fazit
Wie bereits erwähnt ist das Buch chronologisch aufgebaut, wenn auch
nicht völlig strikt. Dies ist aber auch schon allein aufgrund der
Trennung von Hardware- und Softwaregeschichte nicht möglich. Dem
Autor gelingt es aber durchweg, geschickt zwischen den
einzelnen Teilen überzuleiten und diese flüssig miteinander zu
verknüpfen. Wo nötig und angebracht, werden auch kurze Biographien
zu den für das Kapitel relevanten Personen (wie z. B. Pascal,
Leibnitz, Zuse, Jobs, Shuttleworth) eingeflochten. Weiterhin gibt
es für eine ganzen Reihe von alten und älteren Rechnern und Software
Emulatoren, welche auf der dem Buch beiliegenden CD enthalten sind.
In separaten Abschnitten wird dann jeweils knapp die Installation
und die Nutzung erklärt, sowie in der Regel ein kurzes
Anwendungsbeispiel gegeben. Dies ist jedoch eher als
„Bonusmaterial“ zu sehen; für das Verständnis (und den Lesespaß)
sind diese nicht weiter relevant, sodass diese Abschnitte ohne
weiteres auch übersprungen werden können. Aus Sicht des Linux-/MacOS-Nutzer
ist hierzu lediglich anzumerken, dass ein Teil der
Emulatoren lediglich als Windows-Software beiliegt. Dies ist aber
wohl weniger dem Autor anzulasten als vielmehr der Tatsache, dass
diese Software einfach nicht für andere Plattformen vorliegt. Wo
möglich, setzt der Autor aber durchweg auf das
plattformübergreifende Java.
Das Buch ist in der Tat ein Geschichtsbuch, welches Computerthemen
bis hin zur Gegenwart behandelt. Dabei ist es aber an keiner Stelle
trocken, angestaubt oder gar langweilig – ganz im Gegenteil.
Der Autor pflegt einen flüssigen, lebendigen und sehr gut zu
lesenden Schreibstil. Alle Themen werden mit der notwendigen
Ausführlichkeit behandelt, jedoch ohne auch nur im Ansatz
ausschweifend oder langatmig zu sein. Theorie findet man an keiner
Stelle, lediglich die Kapitel zur Turingmaschine und zu zellulären
Automaten haben einen leicht mathematischen Ansatz, was sich
aufgrund der Themen aber wohl kaum vermeiden lässt. Insgesamt ist
das Buch ziemlich weit davon entfernt, „geekig“ zu sein.
Andererseits ist das Buch aber so gestaltet, dass sowohl Geeks als
auch computer-unerfahrene Leser Gefallen daran findet können. Hat
man einen Teil der Geschichte(n) miterlebt, so wird sicherlich die eine oder andere
Erinnerung geweckt.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Wer sich für die Geschichte von
Computern und Software interessiert, der findet in diesem Buch
kurzweiligen Lesespaß.
Redaktioneller Hinweis: Und weil es ja schade wäre, wenn das Buch bei Jochen
Schnelle im Bücherregal verstaubt, verlosen wir
„Computergeschichte(n) – nicht nur für Geeks“ an die erste Person,
die uns sagen kann, wie der heutzutage legendäre Supercomputer
heißt, welcher im Jahr 1976 zum ersten Mal gebaut wurde und eine
seinerzeit unglaubliche Rechenleistung von 133 Megaflops hatte.
Antworten können wie immer über den Kommentarlink am Ende des
Artikels oder per E-Mail an  eingesendet werden.
eingesendet werden.
| Buchinformationen |
| Titel | Computergeschichte(n) – nicht nur für Geeks |
| Autor | H. R. Wieland |
| Verlag | Galileo Computing |
| Umfang | 605 Seiten |
| ISBN | 978-3-8362-1527-5 |
| Preis | 29,90 € |
| |
Links
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Geek
[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesmagazin-2009-04/
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle
nutzt Computer seit dem C64 und interessiert sich
allgemein für Computergeschichten und IT-Themen.
|
| |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
Für Leserbriefe steht unsere E-Mailadresse
 zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
Leserbriefe und Anmerkungen
Editorial „Konsumgesellschaft“ und Gewinnspiel zum Geburtstag
->
Eigentlich lese ich das Magazin nur gelegentlich und habe mir bisher
nicht Gedanken gemacht, dass auch diese Beiträge von Usern für User
erstellt werden. Sie fragen dabei, weshalb die Beteiligung und
Bereitschaft für etwas (freiwillig und kostenlos) für die Gemeinschaft
nachlässt … Ich verstehe nicht, weshalb das eine Frage für Sie ist …
Dieser Trend ist auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu
erkennen. Als Vereinsmitglied in einem Handballverein ist dieser Trend
bereits seit etwa zehn Jahren zu erkennen. Die Konsumgesellschaft ist
auch hier angekommen. Alles mitnehmen, was möglich ist, aber selbst bei
einem Jugendturnier mitzuhelfen, ist nicht mehr möglich. Deswegen kann
sich diese Entwicklung in die ganzen anderen Lebensbereiche einfügen. Es
ist so – der Einzelne ist nicht bereit, für die Gemeinschaft etwas zu
opfern, sondern möchte dabei etwas an der Sache gewinnen. Wenn er dies
nicht erreicht, sucht er andere Bereiche, an denen er profitieren kann.
[…]
Der Einzelne ist daran interessiert, das Beste für sich herauszuholen.
Die Gemeinschaft ist an dieser Stelle uninteressant … Also Sie sollten
sich an die Situation gewöhnen – aus meiner Sicht wird es in Zukunft
noch schlimmer …
Christoph Straub
<-
Vielen Dank für Ihren Kommentar. In der Tat war dies auch etwas, was uns
auf der Zunge lag, denn nicht nur bei freiesMagazin sieht man diesen
Wandel der Gesellschaft.
Ganz so düster wie Sie sehe ich die Zukunft aber nicht. Zumindest habe
ich noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir irgendwann wieder zu
einem Nash-Gleichgewicht [1]
finden. Denn nur wenn man so handelt, dass es für einen selbst
und für die Gruppe das Beste ist, kann man seinen
Gewinn maximieren. Das haben nur noch nicht alle erkannt.
Dominik Wagenführ
->
Ich bin Angehöriger der „verkommenen Konsumgesellschaft“.
Als Fan Eures Magazins freue ich mich jeden Monat aufs neue, wenn mein
RSS-Reader ausschlägt. Ich empfehle Euch bei jeder Gelegenheit weiter
und wenn sich mir die Zeit bieten würde, würde ich auch sehr gerne etwas
beitragen. Da dies bisher noch nicht der Fall war, muss ich mich
allerdings zur Konsumgesellschaft zählen und somit in Eure Ungnade fallen.
Mir persönlich bereiten solche Aussagen deshalb Unbehagen, da man sich
so als schmarotzendes Mitglied Eurer Leser-Gesellschaft fühlt.
Meiner Meinung nach nicht der richtige Aufruf zu mehr Mitwirken.
Dies soll euch lediglich als kleines Feedback dienen, um Euch diese
Tatsache bewusst zu machen.
Johannes Stefan
<-
Immerhin haben wir so eine Reaktion aus Ihnen herausgekitzelt. Die
meisten der 8000 Leser sind für uns nur anonyme IP-Adresse in unseren
Download-Logs. So bekommt diese Zahl endlich eine Stimme.
Von „verkommen“ oder „schmarotzend“ haben wir aber nirgends etwas
geschrieben, dies wäre beleidigend gegenüber unseren Lesern. Und wir
haben die Aussage natürlich auch als These bzw. Frage formuliert, nicht
als Tatsache. Das schlechte Gewissen wollten wir aber natürlich etwas
wecken – wenn auch nicht zu sehr. Da Sie z. B. aktiv Werbung für
freiesMagazin in Ihrem Bekanntenkreis machen, sollten Sie aber gar kein
schlechtes Gewissen haben.
Sie haben aber natürlich recht, dass wir solche Helfer gar nicht sehen,
wenn diese sich nicht wie Sie bei uns melden. Daher Danke für Ihre E-Mail.
Dominik Wagenführ
->
Eigentlich hätte ich ja gerne teilgenommen, aber mir fehlte
irgendwie die zündende Idee. Und da habe ich dann gedacht, was
soll's, du würdest bei deinem künstlerischem Talent sowieso keinen
Blumentopf gewinnen. So kann man sich täuschen!
Meine Erklärung, wieso keiner teilnimmt, ist folgende: Die Preise
dürften viele nicht vom Hocker hauen. Das ist natürlich klar, was
sind schon 30 € im Verhältnis zum Aufwand für so ein Bild? Wobei es
bei dem Wettbewerb ja auch nicht um die Preise gehen sollte,
sondern um den Spaß und den freien Gedanken, denke ich. Viele sehen
das wahrscheinlich aber nicht mehr so. Schade. Ich auf jeden Fall
habe mir fest vorgenommen, beim nächsten Wettbewerb dabei zu sein.
Vielleicht wird's wieder nichts, aber das war für mich jetzt ein
Anstoß.
Henrik7 (Kommentar)
<-
Die Preise sind und waren in der Tat nur als Anreiz zu sehen, damit
man sich vielleicht etwas motiviert fühlt, teilzunehmen. Hätten wir
gar keine vergeben, gäbe es vielleicht gar keine Einsendung (wobei
ich das dem Gewinner natürlich nicht unterstellen will). Auf alle
Fälle sollte niemand wegen der Preise teilnehmen, das wäre
definitiv der falsche Ansatz.
Dominik Wagenführ
->
Ihr habt danach gefragt, „ob die Linux- und
Open-Source-Community zu einer reinen Konsumgesellschaft verkommt.“
Nö.
Es ist nur so, dass der durchschnittliche Bürger 9h am Werktag arbeitet,
sich mindestens 1h auf oder zur Arbeit weg bewegt, 8h Schlaf benötigt und
in den restlichen 4h (die der Tag vielleicht noch über hat) in
Futtersuche, Familie oder Beziehung, Haushalt, soziale Verpflichtungen und
Hobby stecken muss/will.
Früher(TM) hat sich um die häuslichen Angelegenheiten i. d. R. die
Lebenspartnerin / der Lebenspartner gekümmert, der Abend und das Wochenende
gehörte der Familie oder dem Hobby. Heute ist es kaum noch möglich, mit nur
einem Gehalt eine Familie zu ernähren. Wer kann, geht arbeiten und versucht
danach noch erst mal so viel wie möglich von seinem eigenen Kram auf die
Reihe zu bringen.
Die Folge ist schlicht und ergreifend weniger freie Zeit, die überhaupt
zur Verfügung steht. Dem entgegen stehen sowohl in der Open-Source-Community
als auch im echten Leben immer mehr unterstützungswürdige
Projekte, zwischen denen man sich schlichtweg entscheiden muss. Getreu dem
Motto „Wer vieles gleichzeitig macht, macht nichts wirklich richtig“ kann
man nunmal nicht alles aktiv unterstützen.
Oder spendet Ihr bei jedem Erdbeben, Deichbruch, Vulkanausbruch,
Großbrand, Weisenkind, <insert tragische Krankheit here>, gestrandetem
Wal? Nein? Beim DRK lasst Ihr Euch auch nicht blicken und Diakonie kennt
Ihr nur aus dem Wörterbuch? Freiwillige Jugendarbeit? Straßenarbeit?
Nada? Und kein schlechtes Gewissen dabei?
Und nun jammert Ihr, weil sich keiner auf einen Bildwettbewerb gemeldet
hat? Ein Wettbewerbstyp, der selbst bei großen Projekten kaum Beachtung in
der Community findet? Ich meine, Ihr seid nicht ganz „im Bilde“, liebe
Redaktion.
Dies ist keine Herabwürdigung Eurer Arbeit. Ich finde es toll, wie Ihr
regelmäßig ein ansehliches PDF zustande bringt. Zwar inhaltlich für mich
selten wirklich interessant, doch erfreut mich, dass es eben noch Menschen
gibt, die zwischen all dem Alltagsstress noch Zeit für ein gemeinnütziges
Hobby, wie ein solches Magazin, aufbringen können.
Bernd Kosmahl
<-
Ihre Anmerkungen sind natürlich korrekt, sodass die meisten Leute mit
Arbeit und Familie sehr ausgelastet sind und kaum Zeit für Hobbys wie
z. B. Artikel für freiesMagazin bleibt. Aber: Uns geht das im Team nicht
anders. Die meisten Mitglieder sind berufstätig und haben eine Familie,
um die sie sich kümmern müssen. In der Regel kann aber jeder ein oder
zwei Stunden pro Woche aufbringen, mehr Zeit kostet es nicht (wenn die
Arbeit gut verteilt ist). Einzig in der Redaktion fällt etwas mehr
Arbeit an.
Ich denke daher, dass, wenn das Interesse da ist, sich auch die Zeit
findet, an einem freien Projekt mitzuwirken. Bei freiesMagazin zum
Beispiel durch Artikel schreiben. Innerhalb von 4 bis 8 Stunden schafft
man locker einen Artikel pro Monat zu schreiben – darüber hinaus hetzt
aber auch niemand bei uns. Manche Artikel benötigen über sechs Monate,
ehe sie fertig sind.
Beim Wettbewerb war vor allem enttäuschend, dass es jeden Teilnehmer mit
etwas Grafikkenntnissen einmalig vielleicht eine Stunde gekostet hätte,
ein Bild zu zeichnen.
Die Kommentare auf der Webseite und oben zeigen aber auch, dass viele nicht
teilgenommen haben, weil sie dachten, sie hätten keine Chance bei der
Masse an Teilnehmern. Auf alle Fälle zeigt uns das, dass die
Bereitschaft und die Zeit da war, aber aus anderen Gründen nicht
teilgenommen wurde.
Dominik Wagenführ
->
Ich bin ein begeisterter Leser Ihres Magazins, vor allem da ich vor
kurzem auf openSUSE umgestiegen bin. Und durch Ihr Magazin lerne
ich mein System immer besser kennen. :)
An dem Grafikwettbewerb hatte ich auch überlegt mitzumachen,
jedoch war ich in der Annahme, dass sehr viele an dem Wettbewerb
teilnehmen und dadurch meine geringen Kenntnisse im Grafikdesign
kaum eine Chance hätten. Nun bin ich eines besseren belehrt worden.
Dass Ihnen nun die Frage aufkommt, ob die Linux- und
Open-Source-Community zu einer reinen Konsumgesellschaft geworden
ist, nachdem die Teilnahme so schlecht ausgefallen ist, kann ich
gut verstehen, da die einzelnen Wettbewerbe einiges an Vorbereitung
gekostet haben und man anderen mit der Lösung dieser Aufgaben
Freude bereiten wollte.
Ich versuche, diese Frage mal aus meiner Sicht zu beantworten.
Zurzeit bin ich im zweiten Semester im Bachelor-Studiengang „Scientific
Programming“ (dualer Studiengang zum Mathematisch-Technischen
Software-Entwickler). Während des Studiums musste ich schon so
manches Programm ergänzen und mich dann auch immer wieder in den
ganzen Code einarbeiten, daher hab ich großen Respekt vor den
Open-Source-Projekten, die doch um einiges größer sind. Gerne würde
ich bei solchen Projekten mit aktiv sein und meinen kleinen Beitrag
leisten, jedoch hielt mich die Ungewissheit darüber, wie eine
solche Community arbeitet und agiert, noch zurück. Vielleicht könnt
Ihr mir so eine Community ein bisschen näher bringen, dann hätte
ich auch ein Thema über das ich berichten kann. :)
Im Allgemeinen schätze ich, dass die Leute glauben (wie ich beim
Wettbewerb), dass sie nicht in der Lage sind, so etwas
zusammenzustellen wie ein Artikel oder ähnliches. ([Das] ist jetzt keine
Kritik, soll nur eine Erklärung sein.)
Julian Cloos
<-
Wie auch in den Kommentaren auf unserer Webseite
zu lesen ist, dachten viele Leser wie Sie, dass man eh keine Chance hat
zu gewinnen. Zu dem Thema haben wir auch im
aktuellen Editorial etwas geschrieben.
Zu Ihrer Frage der Teilnahme an Open-Source-Projekten: Dies hängt sehr
vom gewählten Projekt ab. Ich selbst habe z.B. bei Projekten wie
Geany [2], LostIRC [3]
oder Lapack++ [4] mitgemacht und Code
beigesteuert. Dies sind alles sehr kleine Projekte mit wenigen, wenn
nicht gar nur einem Entwickler.
Wenn Sie einen Verbesserungsvorschlag oder eine Fehlerbehebung haben (am
besten in Codeform), schreiben Sie den Betreuer des Codes (meist findet
sich irgendwo eine Kontaktadresse) an und bieten Sie Ihren Code an (in
der Regel wird das als Patch abgeliefert). Das ist der erste Einstieg.
Sie können auch einfach bei irgendeinem Projekt anfragen, was zu tun
ist. Je größer das Projekt aber ist, desto komplizierter sind die Regeln
und Prozesse, sodass es anfangs ggf. etwas frustierend sein kann, dort
hineinzufinden.
Dominik Wagenführ
->
Ich habe keine Theorie, warum die Teilnahme an den Gewinnspielen und
Wettbewerben so niedrig ist, aber ich möchte doch mal anregen, Flattr
einzuführen – ich denke, das hat mehr Akzeptanz. :-)
P.S.: Man sieht auch immer wieder, wie die Leute so viel konsumieren,
dass sie gar nicht mehr dazu kommen, sich selbst irgendwo
einzubringen, wenn der RSS-Feedreader aus den Nähten bricht. ;-)
Jan-Florian Hilgenberg
<-
Zu Flattr hatten wir im Editorial der freiesMagazin-Ausgabe 07/2010
bereits etwas geschrieben [5].
Und zu dieser Meinung stehen wir immer noch. freiesMagazin ist ein
nicht-kommerzielles Projekt und dazu zählt auch Flattr.
Zusätzlich ist dem Magazin durch Geld
nicht geholfen, denn dadurch entstehen leider keine neuen Inhalte.
Dominik Wagenführ
Mobilausgabe
->
Ich finde das freieMagazin sehr schön würde mich aber sehr über eine
Konvertierung das EPUB-Format freuen. :D
Anonym
<-
Zu dem Thema gab es im Januar 2011 eine Umfrage [6].
Es hat sich gezeigt, dass nur wenige Leser wirklich eine extra
EPUB-Version benötigen.
Daneben scheint es nicht so einfach zu sein, so eine EPUB-Version zu
erzeugen. Wir haben keine Software gefunden, die das PDF (wegen des
dreispaltigen Layouts) oder die HTML-Seiten in irgendetwas annehmbares
konvertieren konnte. Wenn wir so eine Version offiziell herausgeben,
soll sie natürlich auch einigermaßen unseren Qualitätsstandards entsprechen.
Wenn nicht zufällig jemand aus unserem Leserkreis Erfahrung auf dem
Gebiet der EPUB-Erzeugung hat, müssen Sie noch etwas warten, bis wir
ein ordentliches EPUB aus freiesMagazin erzeugen können.
Dominik Wagenführ
->
Ich finde es toll, dass es eine mobile Ausgabe von freiesMagazin
gibt (ich finde freiesMagazin sowieso toll :))! Nur leider
sind die Artikel so breit, dass man selbst auf einem quer gehaltenen
Smartphone die Seite für jede Zeile sehr stark hin- und herschieben
muss, da die Seiten offenbar gut doppelt so breit angelegt sind, wie
ein Smartphone quer an Breite zur Verfügung hat. Das trübt leider
den Lesespaß ziemlich.
Ich habe ein Samsung Wave 533 (Bada OS, Dolfin Browser auf
Webkit-Basis). […]
Die automatische Breitenanpassung funktioniert ganz hervorragend auf
der Startseite. Aber nicht bei den Magazinen selbst. Nun, vielleicht
ist es ja ein Bug im Dolfin-Browser …
Susan
<-
Also ich habe im Netz gesucht und einige Bada-Nutzer gefunden, die
sich auch über die fehlenden Zeilenumbrüche beschweren. Es scheint also
am OS zu liegen. Die „Lösungsempfehlung“ war meistens Opera Mini. Ich
habe auch gelesen, dass es in den neueren Bada-Versionen besser sein soll.
Vielleicht hat aber auch einer unserer Leser das gleiche (oder ein
ähnliches) Gerät und das Problem mit den Zeilenumbrüchen bereits
gelöst. Wer eine Antwort weiß, möge uns doch bitte unter  schreiben. Wir leiten dies dann an Susan weiter.
schreiben. Wir leiten dies dann an Susan weiter.
Dominik Wagenführ
Python-Sonderausgabe
->
Ich fand die Idee, die Python-Artikel in eine Serie zu bringen, gut,
so lässt sich besser darauf verweisen, wenn ein Neuling nach einem
guten Tutorial fragt. Aber sollte man eine solche Sonderausgabe
nicht erst dann bringen, wenn die Serie beendet ist? Oder kommt
Teil 7 (und die nachfolgenden Teile, falls es noch welche geben
sollte) nachträglich in die Sonderausgabe, oder wie darf man sich
das vorstellen?
Ansonsten wäre es doch irgendwie schade, wenn man zwar eine separate
Python-Tutorial-Ausgabe hat, und dort nicht alle Teile vorhanden
sind.
Keba (Kommentar)
<-
Niemand weiß, wann die Serie fertig ist, daher würde es so eine
Sonderausgabe wohl nie geben. Andererseits wollen wir die einzelnen
Artikel der Serie auch nicht zurückhalten, bis so eine
Sonderausgabe komplett ist. Es ist dem Autor nicht zuzumuten, erst
einmal 50 Seiten Text zu schreiben, ohne auch nur ansatzweise eine
Reaktion zu sehen.
Die Teile 1 bis 6 der Python-Reihe gaben ein für sich
abgeschlossenes Werk, sodass man diese gut zusammenfassen konnte.
Sobald die Teile 7 bis X irgendwann fertig sind, werden diese
sicherlich auch wieder zusammengefasst und es gibt eine zweite
Python-Sonderausgabe.
Dominik Wagenführ
->
Es wird zwar sehr gut und passend auf den Unterschied von [Python-]Version
2.7 und 3 Rücksicht genommen, aber spätestens beim Einbinden des
Moduls mutagen kann man mit Version 3 aufhören. Das gibts nämlich
nicht für Version 3. Damit musste ich dann sowieso auf 2.7 umsteigen.
freeclimb (Kommentar)
<-
Danke für die Rückmeldung. Mutagen ist – wie einige andere populäre
Bibliotheken auch – tatsächlich (noch) nicht für Python 3
verfügbar. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das beim Schreiben des
entsprechenden Artikels nicht aufgefallen ist, da ich noch
überwiegend mit Python 2.x entwickle.
Für die Nutzer von Python 3.x ist die Situation tatsächlich
unbefriedigend. Natürlich möchte man mit der neusten Version seiner
(Lieblings-) Programmiersprache arbeiten. Im Fall von Python 3 ist
das leider zurzeit nur mit einigen Einschränkungen möglich. Nicht
ohne Grund liefern viele große Distributionen noch Python 2.x als
Standard aus. Und selbst bei denjenigen Distris, die Python 3 als
Standard ausliefern (wie Arch) ist Python 2.x zurzeit noch in
vielen Fällen nötig (oder gar unverzichtbar?).
Was bedeutet das für die Reihe? Zum einen werde ich nach Möglichkeit
weiterhin auf Unterschiede zwischen Python 2.x und 3.x hinweisen,
auch wenn es jetzt zugegebenermaßen einen Teil gab, der unter
Python 3.x nur mit Einschränkung (die Ersetzung von Mutagen)
lauffähig ist. Ich denke, dass man – möchte man sich zurzeit mit
Python beschäftigen – diesen Spagat machen muss. Sowohl unter Linux
als auch unter Windows ist es ja auch eigentlich unproblematisch,
beide Python-Varianten nebeneinander zu betreiben.
Falls ich aber noch mal auf eine Bibliothek zurückgreifen müsste, die
nur für Python 2.x verfügbar ist, würde ich natürlich darauf
hinweisen – schon allein, um den Lesern den Ärger zu ersparen, dass
die Codebeispiele nicht lauffähig sind.
Daniel Nögel
Fibonacci-Funktion in Scala
->
Die Fibonacci-Funktion wird bitte nicht so wie im Artikel
implementiert. Diese naive Version ist einer der Gründe, warum
viele irrtümlich glauben, Rekursion ist langsam und somit schlecht.
Bitte so:
def fib( n: Int ) = fib_rek( n, 1, 0 )
def fib_rek( n: Int, b: Int, a: Int): Int = {
if ( n < 1 ) a
else fib_rek( n-1, a+b, b)
}
Gero Schaffran (Kommentar)
<-
Es ging bei der Implementation nicht um Effizienz, sondern einfach
nur darum, dass ein praktisches Beispiel existiert, wie man einen
vorhandenen Algorithmus parallel abarbeiten lassen kann. Natürlich
gibt es effizientere Algorithmen, aber darum ging es in diesem
konkreten Fall nicht.
Stefan Bradl
->
In den Algorithmus für die Fibonacci-Reihe hat sich ein kleiner
Fehler eingeschlichen. Richtig wäre
def fib(n: Int): Int = {
if (n == 0) 0
else if (n == 1) 1
else fib(n - 1) + fib(n - 2)
}
damit auch die richtigen Werte rauskommen. ;)
Jan (Kommentar)
Links
[1] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Nash-Gleichgewicht
[2] http://www.geany.org/
[3] http://lostirc.sourceforge.net/
[4] http://lapackpp.sourceforge.net/
[5] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2010-07
[6] http://www.freiesmagazin.de/20110110-umfrage-mobilversion-freiesmagazin
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gegebenenfalls zu
kürzen. Redaktionelle Ergänzungen finden sich in eckigen Klammern.
Die Leserbriefe kommentieren
Zum Index
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Sie kennen eine Linux-Messe, welche noch nicht auf der Liste zu
finden ist? Dann schreiben Sie eine E-Mail mit den Informationen zu
Datum und Ort an .
Zum Index
.
Zum Index
freiesMagazin erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats. Die Juli-Ausgabe wird voraussichtlich am 3. Juli unter anderem mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Trine – Aller guten Dinge sind drei
- Rezension: Vi and Vim Editors
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
|
| Erscheinungsdatum: 5. Juni 2011 |
|
|
| Redaktion |
| Frank Brungräber | Thorsten Schmidt |
| Dominik Wagenführ (Verantwortlicher Redakteur) |
| |
| Satz und Layout |
| Ralf Damaschke | Nico Maikowski |
| Matthias Sitte | |
| |
| Korrektur |
| Daniel Braun | Stefan Fangmeier |
| Mathias Menzer | Karsten Schuldt |
| Stephan Walter | |
| |
| Veranstaltungen |
| Ronny Fischer |
| |
| Logo-Design |
| Arne Weinberg (GNU FDL) |
| |
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie
freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor.
freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren. Das
freiesMagazin-Logo
wurde von Arne Weinberg erstellt und unterliegt der
GFDL.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der
Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei
Randall Munroe.
Zum Index
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 5 Jun 2011, 10:07.