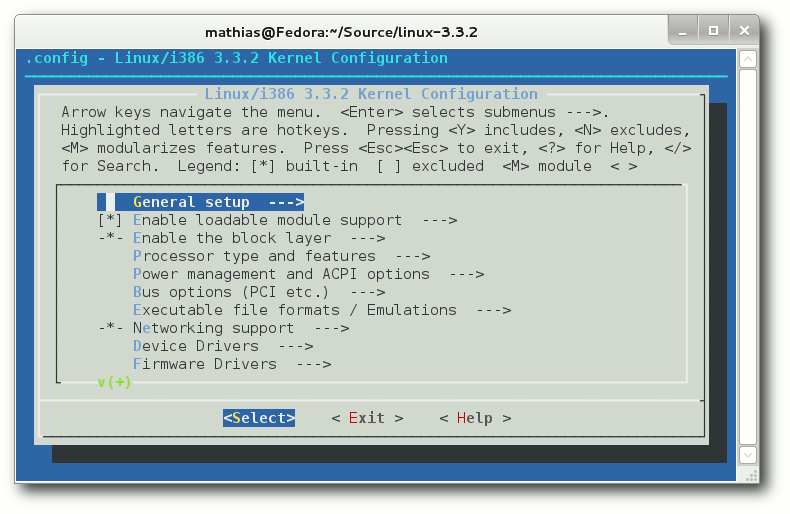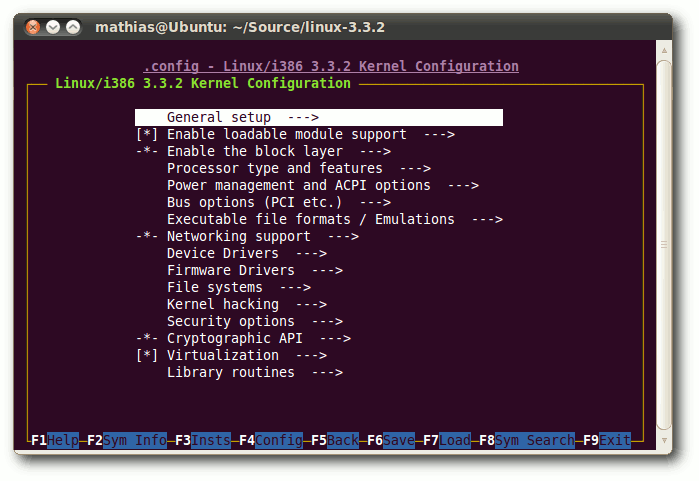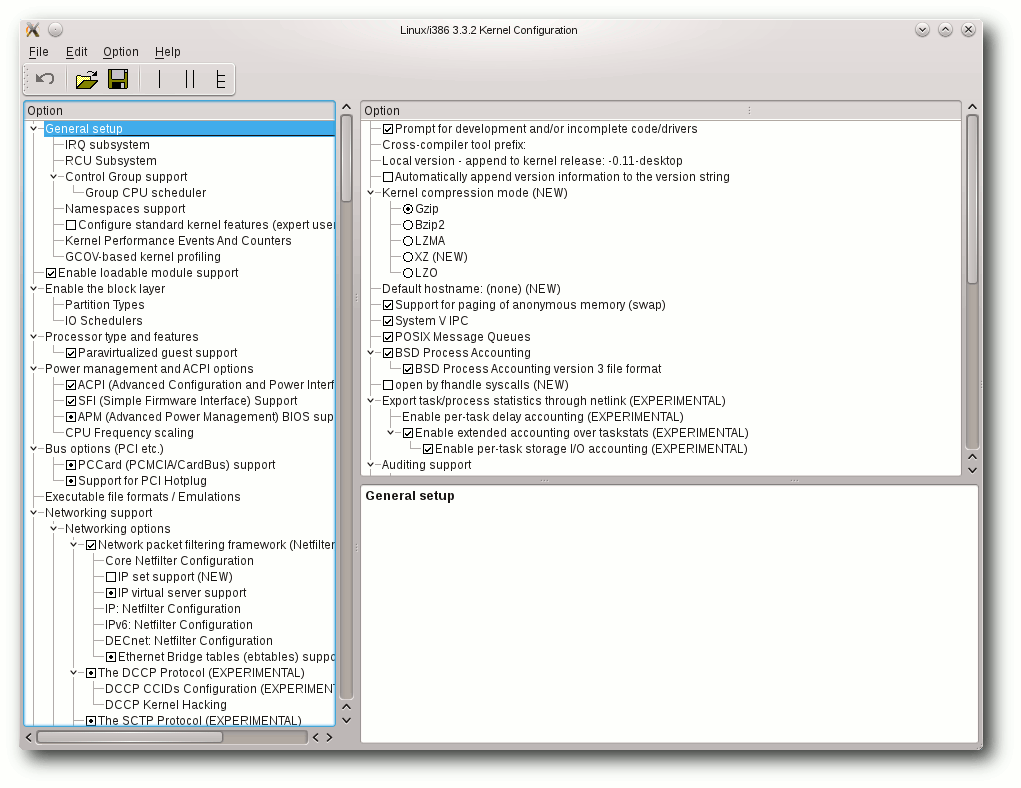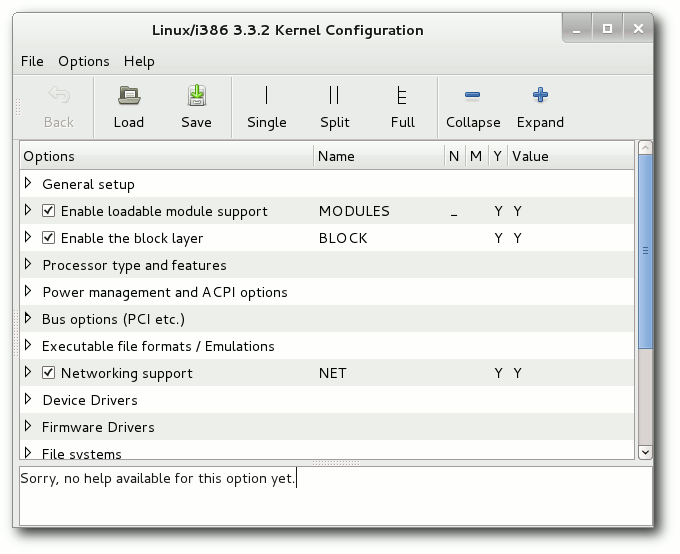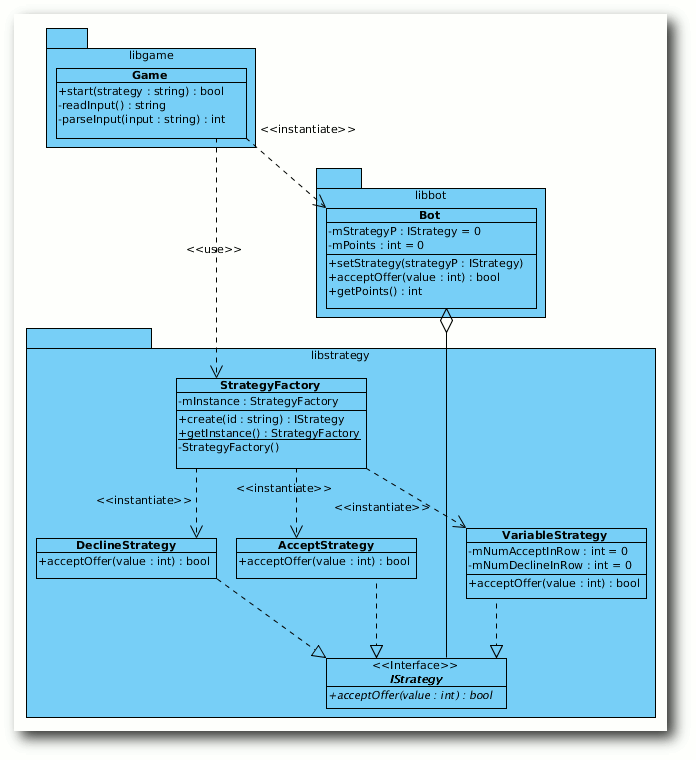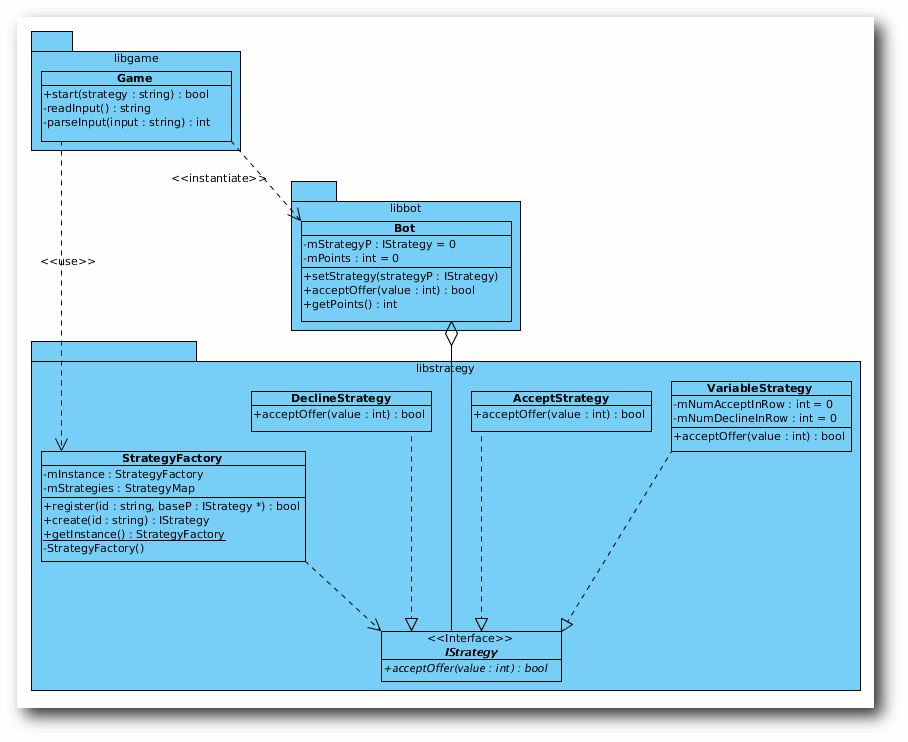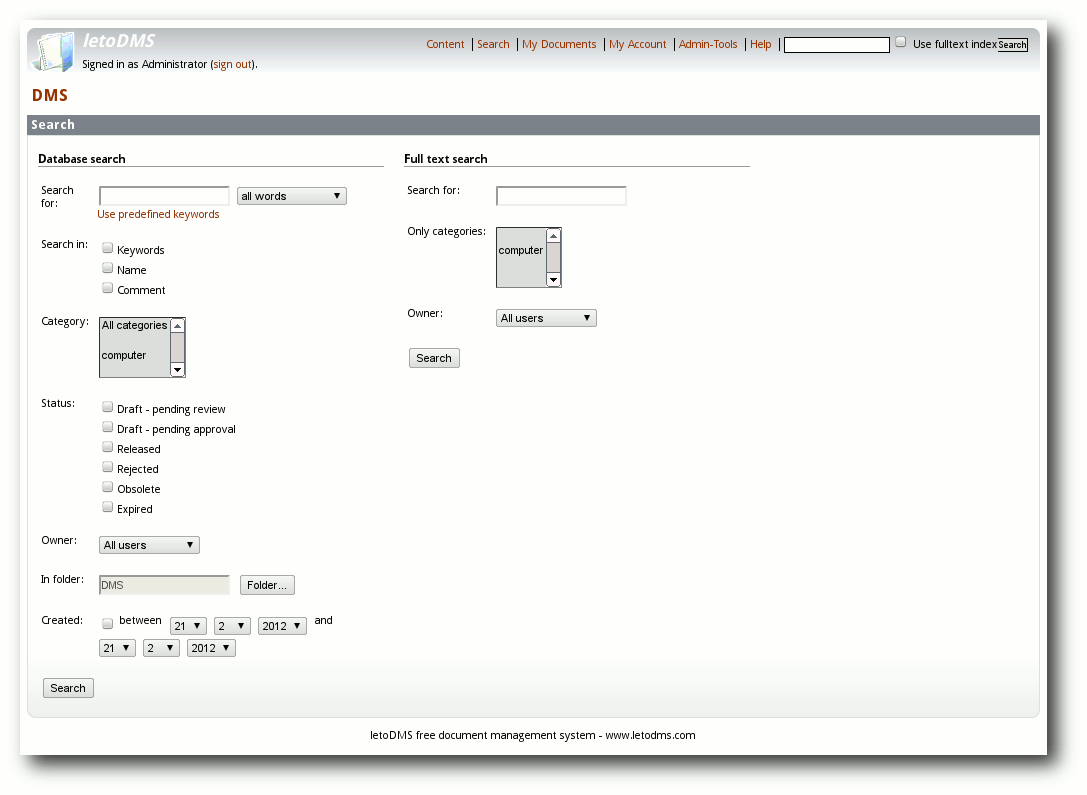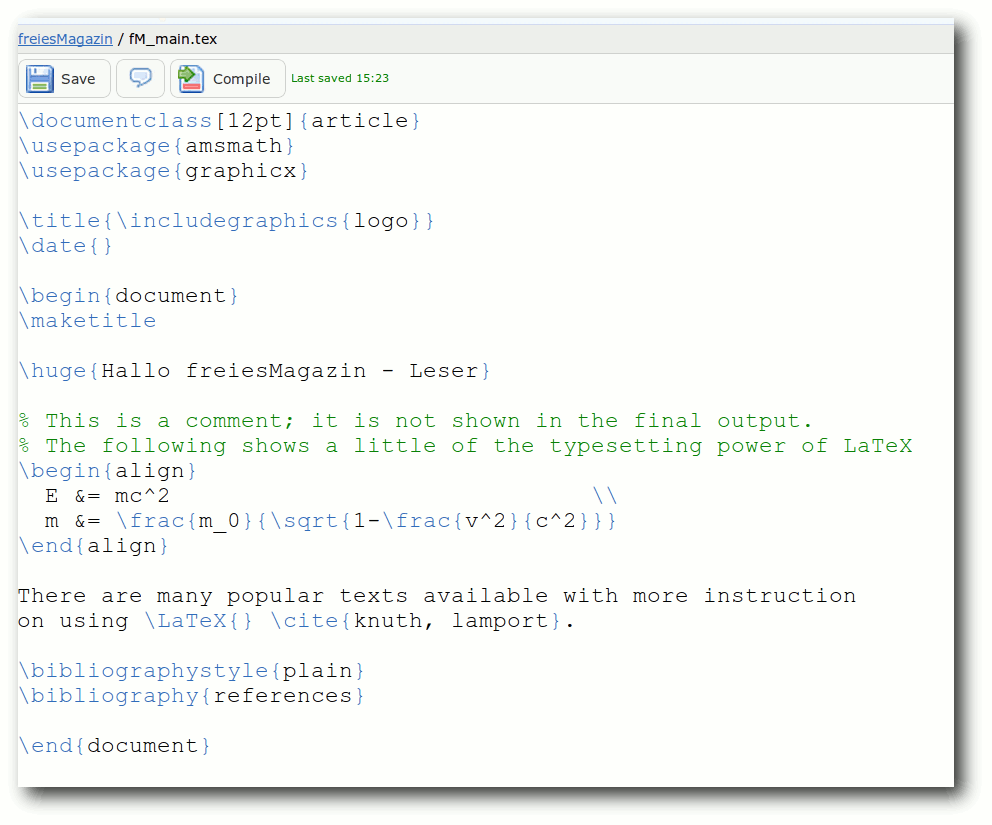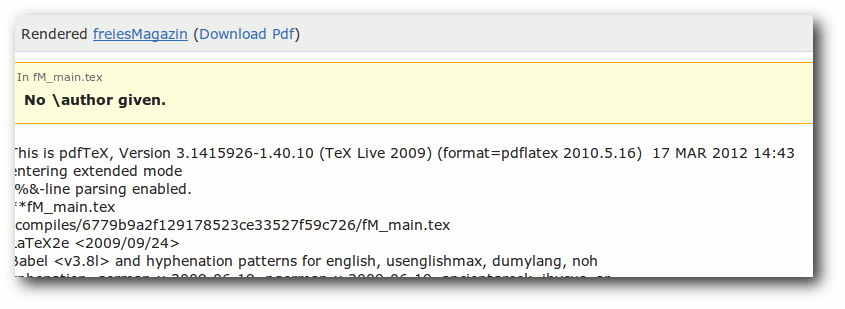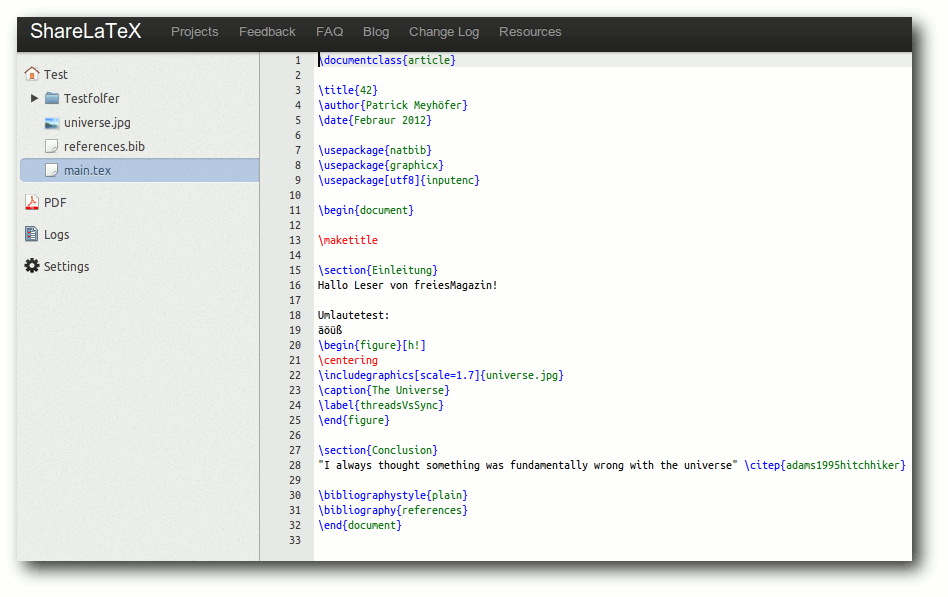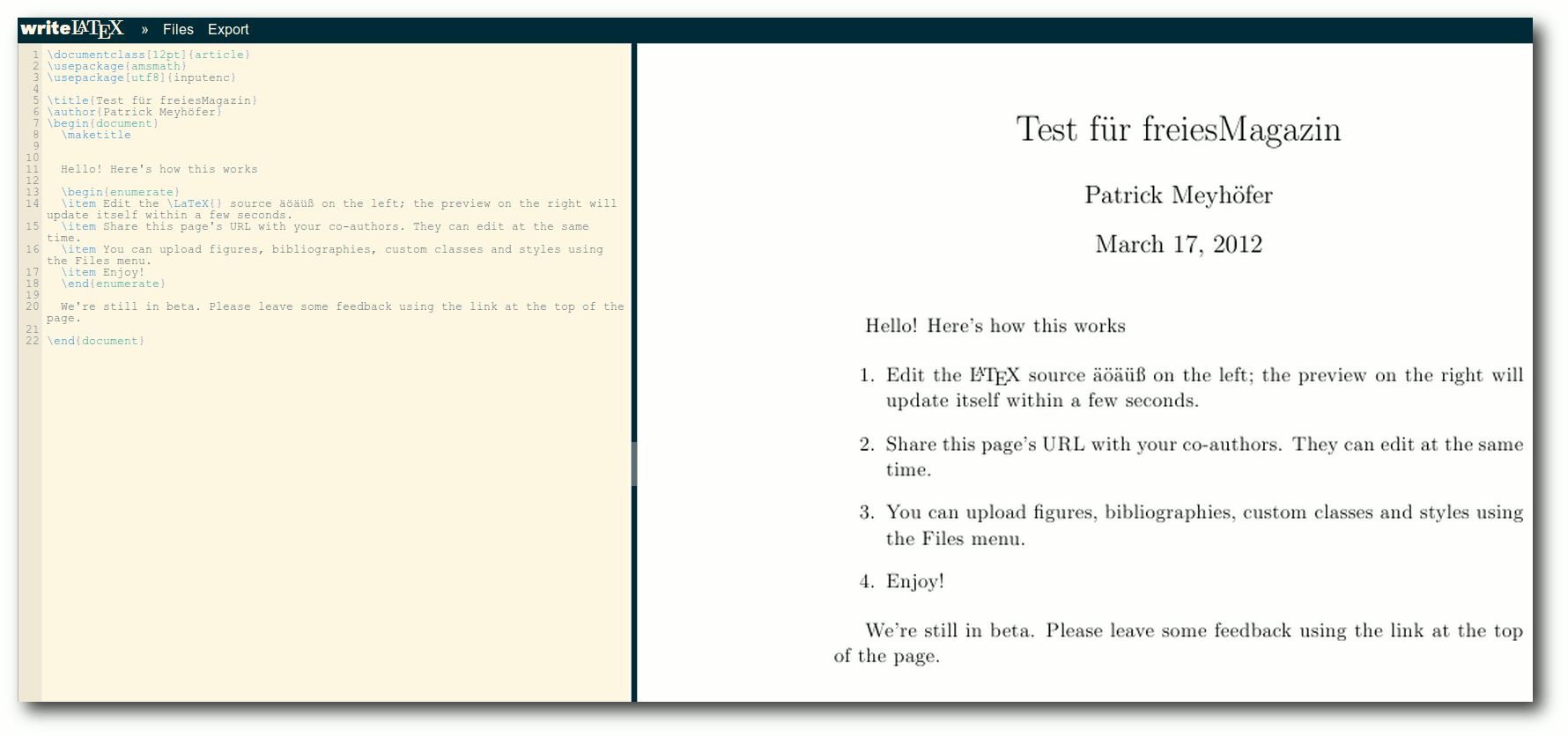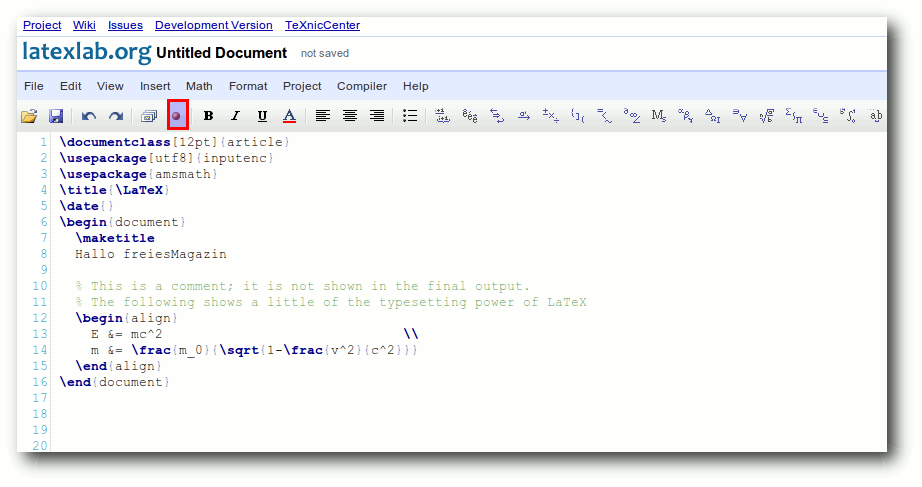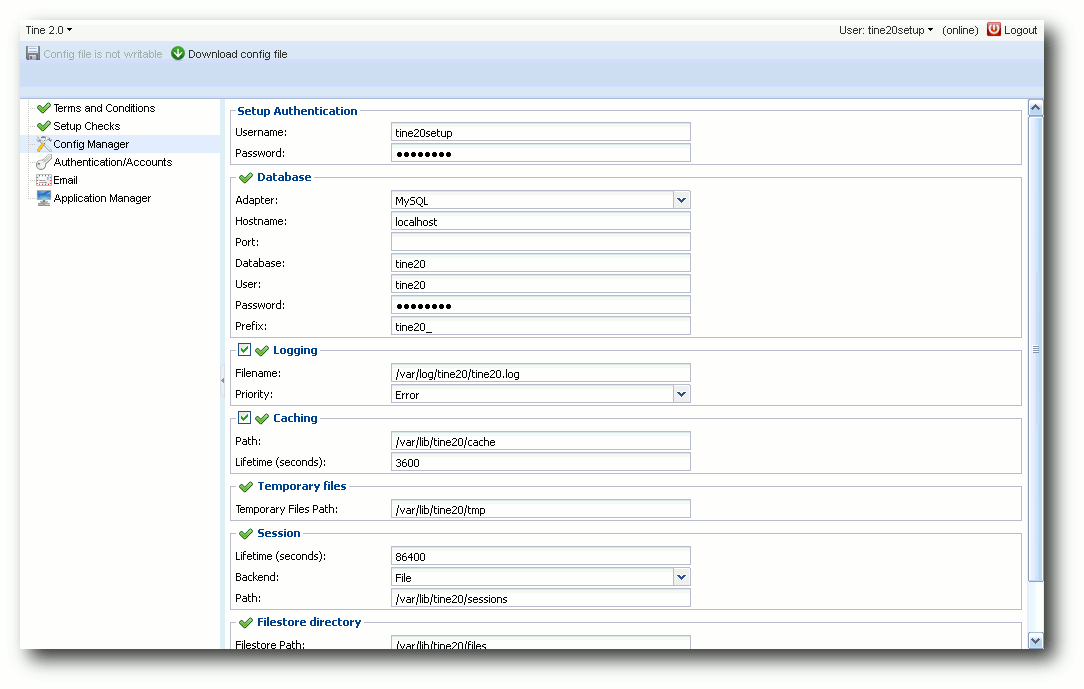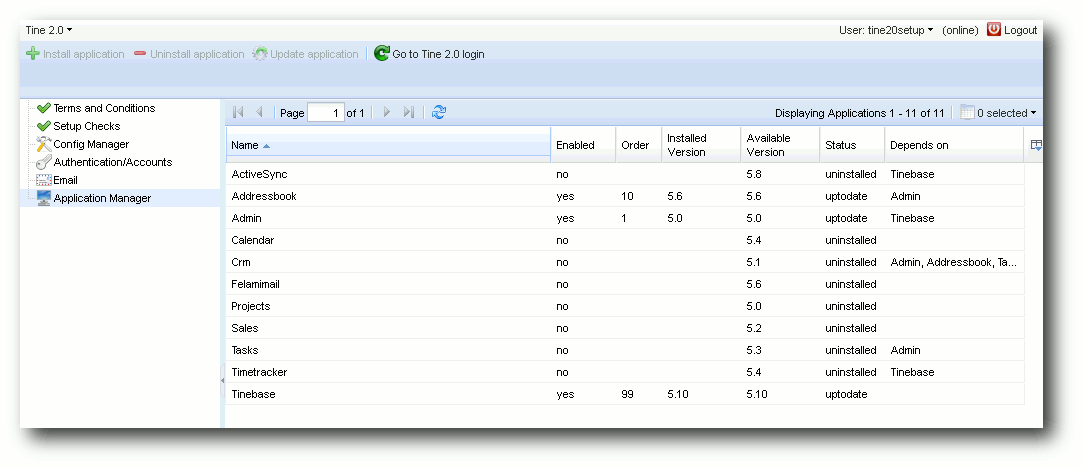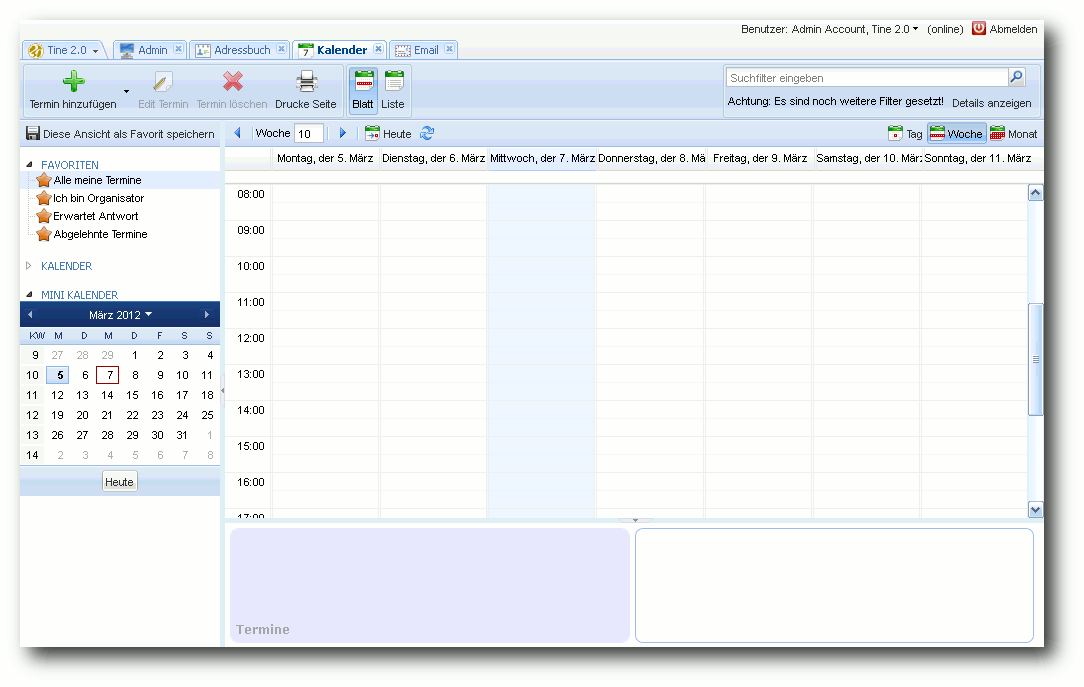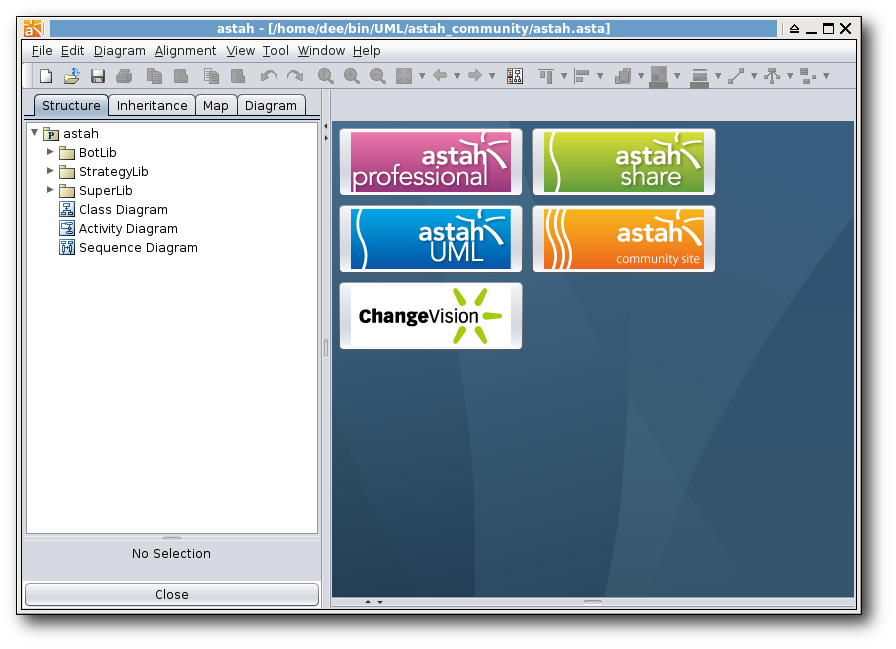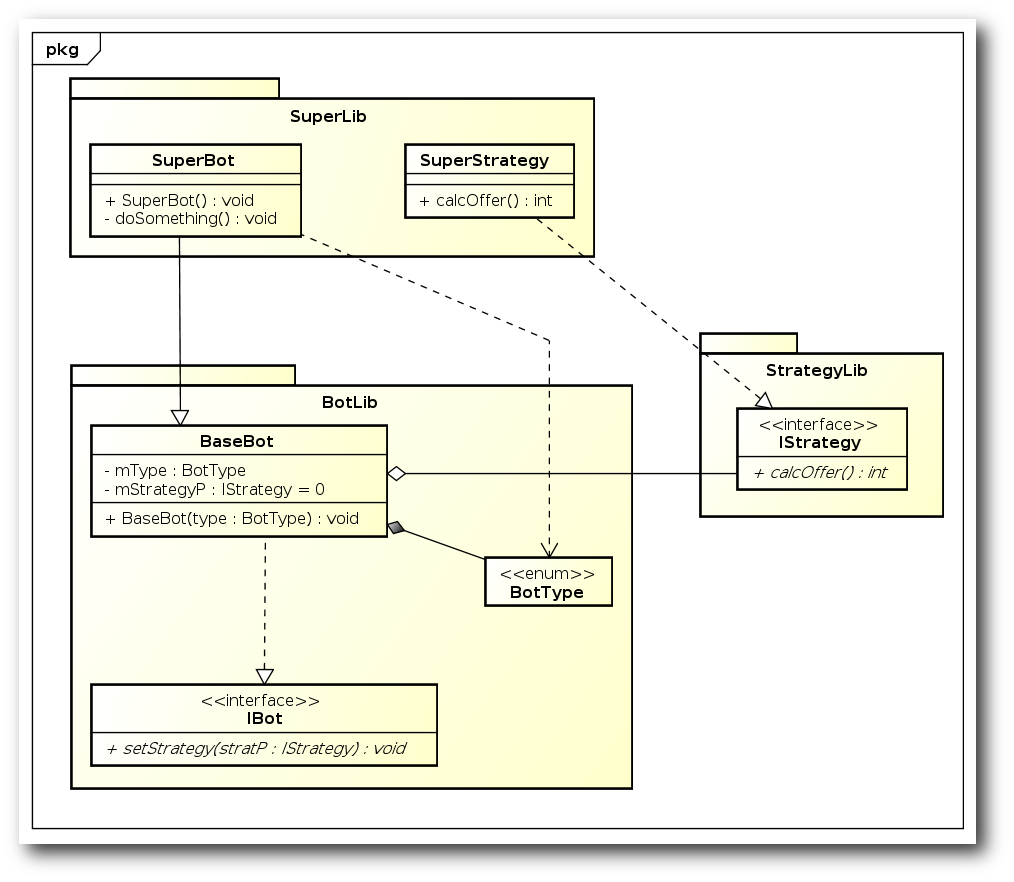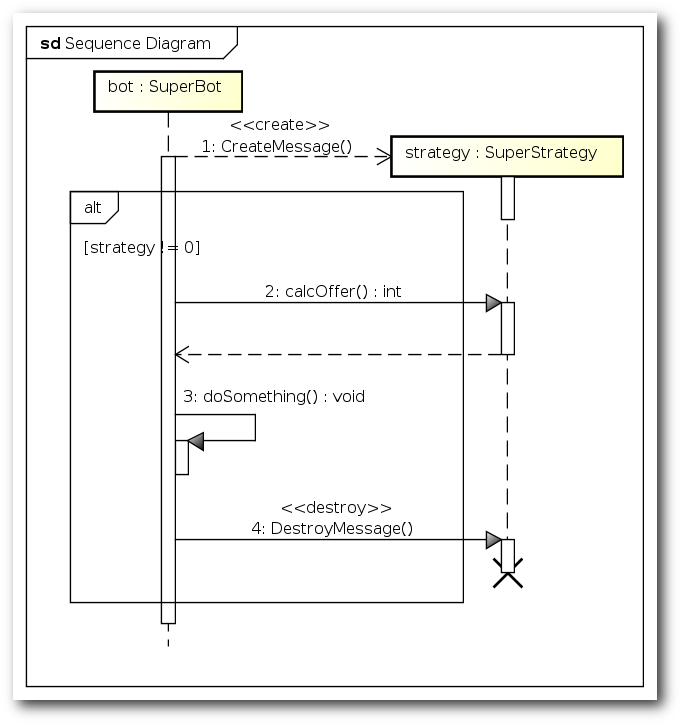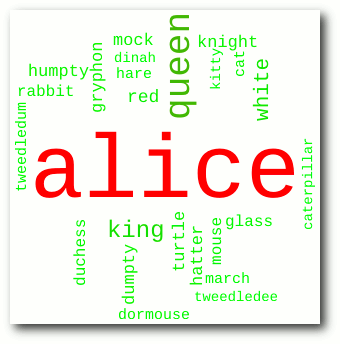Zur Version ohne Bilder
freiesMagazin Mai 2012
(ISSN 1867-7991)
Selbstgebacken 3: make
Das Bauen eines Kernels und das Aktualisieren der Quellen ist keine große Zauberkunst und, sofern man keine besonderen Extras haben möchte, mit ein paar make-Kommandos recht schnell erledigt, wobei make den Löwenanteil der Arbeit verrichtet. Es bekommt gesagt, was man möchte, den Rest erledigt es dann von alleine. Der Artikel soll das Geheimnis von make etwas lüften. (weiterlesen)
Kollaboratives Schreiben mit LaTeX
Ob im wissenschaftlichen oder privaten Bereich: Möchte man die volle Kontrolle über das Aussehen seiner erstellten Dokumente behalten, führt oft kein Weg an LaTeX vorbei. Die Standard TeX-Distribution zeigt jedoch ein paar Restriktionen auf. Sowohl die Online-Verfügbarkeit des Dokuments von jedem Ort aus sowie der kollaborative Ansatz, dass mehrere Personen zeitgleich an einem Dokument arbeiten können, ist mit den Standardmitteln der Desktopinstallation nicht zu erreichen. Die im Artikel vorgestellten Lösungen versuchen, die gewünschten Zusatzfunktionen bereitzustellen. (weiterlesen)
Astah – Kurzvorstellung des UML-Programms
Die Februar-Ausgabe von freiesMagazin enthielt einen kleinen Test diverser UML-Programme. Dabei wurde aber das UML- und Mindmap-Programm Astah übersehen. In dem Artikel soll gezeigt werden, ob das Programm mit den zuvor getesteten mithalten kann. (weiterlesen)
Zum Index
Linux allgemein
Selbstgebacken 3: make
Der April im Kernelrückblick
Anleitungen
Objektorientierte Programmierung: Teil 3
Dokumentenmanagement mit LetoDMS – Einrichten der Volltextsuche
Software
Kollaboratives Schreiben mit LaTeX
Tine 2.0 – Installation und Konfiguration
Astah – Kurzvorstellung des UML-Programms
Community
Rezension: PyQt und PySide
Rezension: C++11 programmieren
Rezension: Java 7 – Mehr als eine Insel
Magazin
Editorial
Ende des fünften Programmierwettbewerbs
Leserbriefe
Veranstaltungen
Vorschau
Konventionen
Impressum
Zum Index
Fünfter Programmierwettbewerb beendet
Der am 1. März 2012 gestartete fünfte freiesMagazin-Programmierwettbewerb [1]
ging offiziell am 15. April 2012 zu Ende. Thema war die Analyse
eines Textes, das Zählen von Worten und die Ausgabe als Wortwolke.
Die eingereichten
Programme wurden auf Herz und Nieren geprüft, sodass die Bewertung
erst Anfang Mai vorlag [2].
Es hatten sechs Programmierwillige ein Programm eingereicht, wobei
einer sein Programm während der Bewertungsphase zurückzog. Von den
restlichen fünf Programmen waren leider drei etwas fehlerhaft, sodass
wir keines von ihnen auf den dritten Platz setzen wollten. Daher gibt
es nur zwei Gewinner.
Der Wettbewerb hat auch gezeigt, dass eine Bewertung aufgrund von
Eigenschaften wesentlich schwieriger ist als wenn am Ende des
Wettbewerbs automatisch eine Punktzahl herausfällt, die genau
angibt, welche Platzierung ein Programm erreicht.
Das ist auch der Grund, wieso der nächste Wettbewerb wieder ein
spieltheoretisches Problem mit einer klaren Punktzahl am Ende
angehen wird. Voraussichtlicher Start des sechsten
freiesMagazin-Programmierwettbewerbs ist Anfang Oktober.
Abschied
Im April hieß es Abschied nehmen von einem langjährigen Teammitglied.
Thorsten Schmidt, seit 2007 als Autor, danach als Korrektor und
letztendlich seit drei Jahren als Redaktionsmitglied tätig, musste
aus privaten und zeitlichen Gründen das Team verlassen.
Wir wollen Thorsten an dieser Stelle für seine langjährige
Unterstützung danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.
Das Magazin existiert aber auch mit nur drei Redaktionsmitgliedern
weiter, auch wenn die Maiausgabe etwas dünner ist als die restlichen
Ausgaben. Nach wie vor benötigen wir immer neue Artikel, um das
Magazin mit Inhalt zu füllen.
Wenn Sie also eine Idee zu einem Artikel haben, schreiben Sie
uns unter  .
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
.
Ihre freiesMagazin-Redaktion
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/20120301-fuenfter-programmierwettbewerb-gestartet
[2] http://www.freiesmagazin.de/20120505-gewinner-des-fuenften-programmierwettbewerbs
Das Editorial kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Das Bauen eines Kernels und das Aktualisieren der Quellen ist keine
große Zauberkunst und, sofern man keine besonderen Extras haben
möchte, mit ein paar make-Kommandos recht schnell erledigt, wobei
make den Löwenanteil der Arbeit verrichtet. Es bekommt gesagt, was
man möchte, den Rest erledigt es dann von alleine. Der Artikel soll
das Geheimnis von make etwas lüften.
Was ist make?
make ist ein Werkzeug zum Erstellen von Programmen aus dem
Quelltext. Es gibt verschiedene Implementierungen, zum Beispiel
pmake unter BSD und „GNU make“, das bei Linux zur Anwendung kommt.
GNU make entstammt dem GNU-Projekt [1] und
kommt zusammen mit der GNU Compiler Collection (gcc) und der GNU C
Library (glibc) beim Bau des Linux-Kernels zum Einsatz. Unter
anderem darauf stützt sich der Initiator des GNU-Projekts, Richard
Stallman, wenn er darauf besteht, dass die korrekte Bezeichnung
GNU/Linux sei [2].
Kurz beschrieben funktioniert make so, dass es beim Aufruf ein
Kommando erhält, was es tun soll. Da die Entwickler von make nun
aber nicht jede Software und ihre speziellen Anforderungen kennen
können, haben Sie make als eine Art vollautomatische Werkzeugkiste
aufgebaut, die der zu kompilierenden Software dann quasi die
Aufbauanleitung entnimmt. Diese Anleitung heißt Makefile und enthält
die vom Entwickler vorgesehenen Anweisungen nebst den notwendigen
Hinweisen für make, was zu tun ist.
Mancher Kunde skandinavischer
Möbelhäuser würde sich darüber freuen, wenn ein „make Schrank
Türen-Anschlag-Links“ den Beipackzettel einlesen, das Zubehör auf
Vollständigkeit prüfen, alles Relevante heraussuchen, die
Anweisungen korrekt interpretieren und auch gleich den Aufbau
vornehmen würde.
Die verschiedenen Befehle, die make entgegennehmen kann, werden
„Targets“ genannt. Wofür Targets letztlich definiert werden,
bleibt den Software-Entwicklern überlassen. Neben dem eigentlichen
Kompilieren werden Targets auch für das Konfigurieren (z. B. make config)
oder das Aufräumen der Quellen nach einem
Kompilierungsvorgang (z. B. make clean) verwendet.
Wozu braucht der Linux-Kernel make?
Beim Linux-Kernel handelt es sich um ein komplexes Miteinander von
Bibliotheken, Komponenten und Modulen, die aufeinander aufbauen und
so ein verflochtenes Netzwerk aus Abhängigkeiten erzeugen.
Berücksichtigt man die Größe des Projekts, so wird schnell klar,
dass die Auflösung dieser Abhängigkeiten bei der Kernelkompilierung
eine Lebensaufgabe wäre, würde make einem nicht diese Arbeit abnehmen.
Angefangen von dem zentralen Makefile des Linux-Kernels, das im
Wurzelverzeichnis des Quellcode-Verzeichnisbaums zu finden ist, arbeitet
sich make entsprechend der Konfigurationsdatei .config durch den
Baum der einzelnen Subsysteme und bindet dann entsprechend der dort
zu findenden Makefiles wiederum andere Komponenten ein oder
kompiliert sie, bis es sie zum Schluss im System ablegt und zum
Beispiel beim Bootloader registriert.
Und auch schon bei der Erstellung der Konfigurationsdatei kann einem
make behilflich sein und spart dabei die Tipparbeit von bis zu 5000
Zeilen Text. Mehr als viele andere Projekte ist der Linux-Kernel also
auf make angewiesen.
Welche Targets gibt es?
Für den Linux-Kernel kennt make mehr als 60 Targets (Stand Linux
3.3). Nicht alle sind immer sinnvoll zu nutzen, da zum Beispiel auch
Targets für die Erstellung von RPM-Paketen mit dem fertig
kompilierten Kernel bestehen, die auf einem Debian-System nur wenig
Sinn ergeben. Dennoch ist ein Überblick über die gebräuchlichsten
Targets von Vorteil, wenn man mal von fertigen Kernel-Rezepten
abweichen möchte.
Konfigurieren
Die meisten Targets dienen der Erstellung einer gültigen
.config-Datei. Die einfachste Variante, make config, fragt auf
der Kommandozeile jede mögliche Einstellung vom Anwender ab,
wobei
die Standard-Einstellung immer vorausgewählt ist und nur mit
„Enter“ bestätigt werden muss. Für die annähernd 5000 Abfragen
sollte man allerdings viel Zeit mitbringen.
Die Variante make oldconfig wurde in den vorangegangenen Teilen
schon genutzt, sie übernimmt eine bereits vorliegende
.config-Datei und legt dem Nutzer nur noch die dort nicht
festgelegten Optionen zur Entscheidung vor.
make defconfig verzichtet dagegen ganz auf irgendwelche Abfragen
und übernimmt stattdessen die von den jeweiligen Entwicklern
vorgesehenen Standard-Einstellungen in die Konfigura-
tionsdatei, was
Zeit und Arbeit spart, die man gegebenenfalls anschließend
investieren muss.
Hierzu wären grafische Werkzeuge hilfreich, die ebenfalls über
verschiedene Targets aufgerufen werden können. Die einfachste
Version davon, die auch auf einem System ohne grafische
Benutzeroberfläche verwendet werden kann, sind die auf
ncurses [3] basierenden
make menuconfig und make nconfig (erforderliches Paket:
ncurses-devel). Alle Einstellmöglichkeiten für den Linux-Kernel
finden sich hier in einer Baumstruktur wieder. Der Natur einer
terminalbasierten Benutzeroberfläche ist es geschuldet, dass sich die Übersichtlichkeit hier
in Grenzen hält, man muss schon in etwa wissen,
wo sich eine bestimmte Einstellung finden lässt, wenn man
auf langes Suchen verzichten möchte. Apropos Suche: Beide Tools
bieten eine Möglichkeit, nach Optionen zu suchen, was bisweilen
einiges an Zeit ersparen kann.
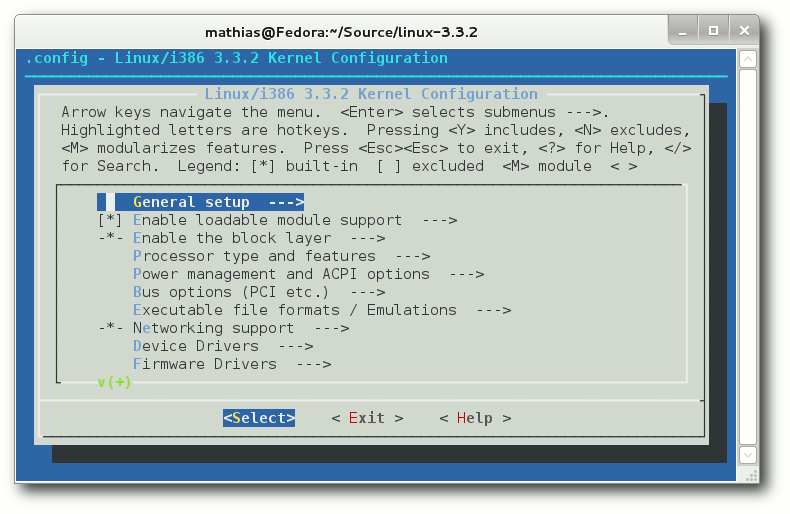
menuconfig präsentiert sich aufgeräumt.
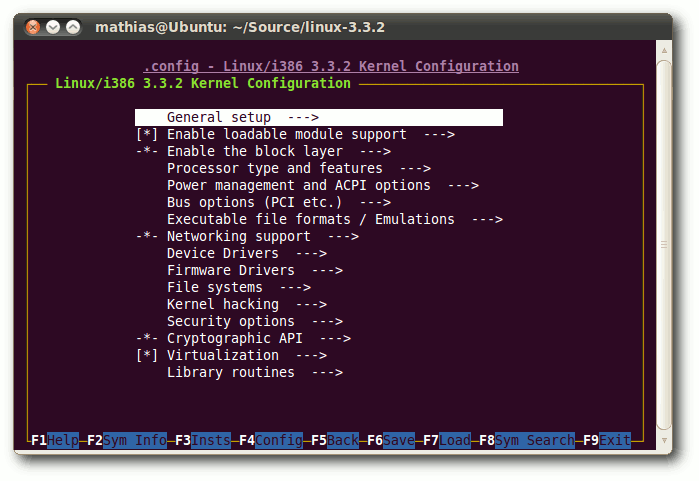
Die Belegung der F-Tasten ist in nconfig immer sichtbar.
Etwas übersichtlicher erscheinen dennoch make xconfig, das sich mit
seiner QT-Oberfläche für KDE-Umgebungen anbietet (erforderliches
Paket: qt), und das GTK+-basierte [4]
gconfig (erforderliche Pakete: gtk+-2.0, glib-2.0 und
libglade-2.0). Beide zeigen die gleiche Baumstruktur wie auch die
ncurses-Tools, jedoch
sorgen die ausklappbaren Unterpunkte für mehr
Übersichtlichkeit und erleichtern die manuelle Nachbearbeitung der
.config-Datei ungemein.
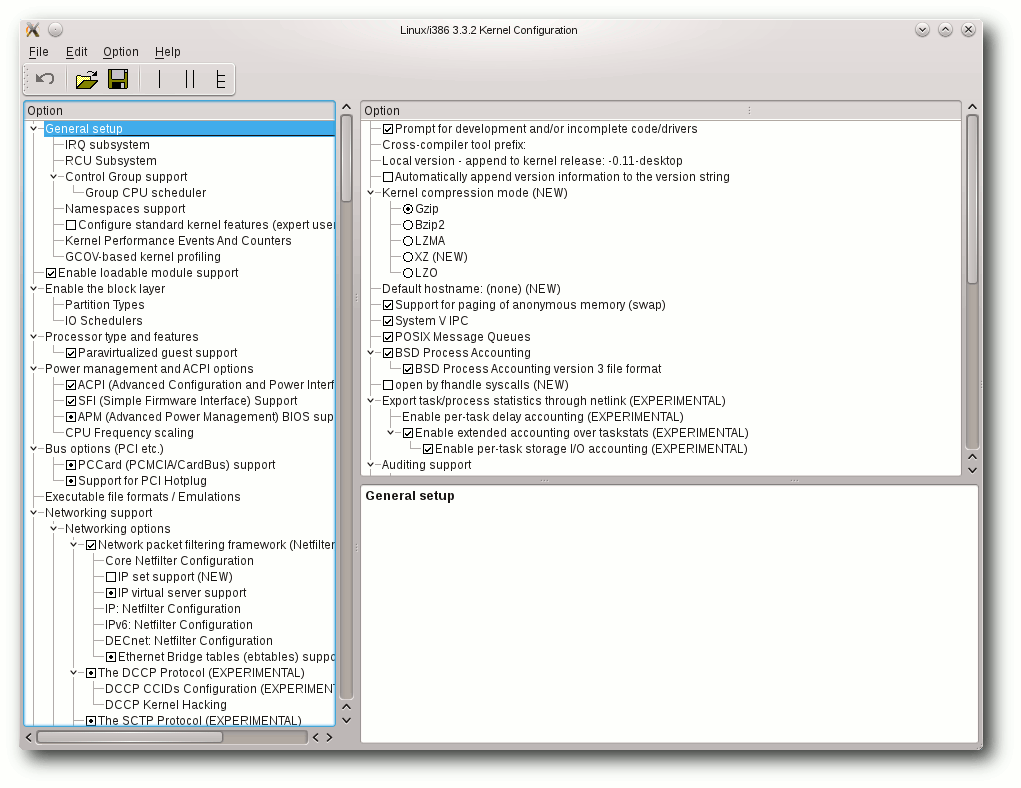
Die grafische Oberfläche von xconfig ist die bei weitem übersichtlichste.
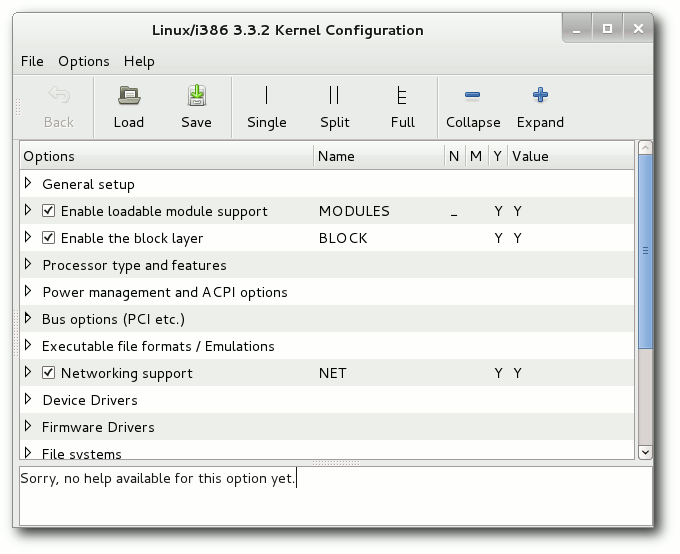
gconfig ist nicht ganz so übersichtlich wie das Qt-Pendant, kommt aber besser mit kleinen Bildschirmen klar.
Mit Vorsicht zu genießen ist das Target localmodconfig: Hier wird
eine vorliegende
Konfiguration genommen und alle Module, die gerade
nicht geladen sind, deaktiviert.
Dabei wird der Kernel zwar recht
schlank, jedoch müssen Komponenten für Hardware, die gerade nicht
aktiv war, anschließend wieder manuell in der Konfigurationen
aktiviert werden, um sie nutzen zu können.
localyesconfig geht noch einen Schritt weiter und sorgt dafür,
dass die entsprechenden Treiber direkt in den Kernel kompiliert
werden, sie müssen also nicht bei Bedarf nachgeladen werden, blähen
den Kernel jedoch auf.
Dem entgegen steht allmodconfig, das so
viele Treiber wie möglich versucht aus dem Kernel auszulagern und
als Module einbindet.
Es existieren noch weitere Targets, die nicht unbedingt täglich von
Nutzen sind. Während man eine Konfiguration, bei der alle Optionen
ein- oder ausgeschaltet sind, schon mal als Grundlage für eine manuelle
Nachbearbeitung erzeugen kann, dürfte randconfig eher etwas für
Nerds sein, die zu viel Zeit übrig haben, denn es beantwortet alle
Abfragen zu den Optionen mit Zufallswerten.
Hier eine Übersicht der Targets zum Konfigurieren des Kernels:
- config
- alle Einstellungen werden in der Kommandozeile abgefragt
- defconfig
- Kernel-Standardkonfiguration entsprechend der jeweiligen Architektur
- oldconfig
- vorliegende Konfiguration wird übernommen, neue Funktionen/Treiber werden in der Kommandozeile interaktiv abgefragt
- localmodconfig
- vorliegende Konfiguration wird übernommen, nicht aktive Module werden deaktiviert
- localyesconfig
- wie localmodconfig, aber die Module werden in den Kernel fest eingebunden
- allnoconfig
- neue Konfiguration, alle Abfragen werden mit „Nein“ beantwortet
- allyesconfig
- neue Konfiguration, alle Abfragen werden mit „Ja“ beantwortet
- allmodconfig
- neue Konfiguration, es werden Treiber als Modul konfiguriert
- alldefconfig
- neue Konfiguration, alle Komponenten mit Standard-Optionen
- randconfig
- neue Konfiguration, Optionen werden zufällig gesetzt
- menuconfig
- terminalbasierte Oberfläche, basierend auf ncurses
- nconfig
- terminalbasierte Oberfläche, basierend auf ncurses
- xconfig
- grafische Oberfläche, basierend auf Qt
- gconfig
- grafische Oberfläche, basierend auf GTK+
Kompilieren und Installieren
Wird make ohne Target aufgerufen, so entspricht dies
make all oder
make vmlinux bzImage modules.
Das bedeutet, es werden der
eigentliche Linux-Kernel (vmlinux), ein komprimiertes Kernel-Abbild
(bzImage) und die Module (modules) gebaut. vmlinux wird nicht mehr
oft verwendet, da aufgrund des Umfangs
der Griff zum komprimierten
Kernel-Abbild empfohlen wird.
Das bzImage wird beim Installieren
übrigens in vmlinuz umbenannt und findet sich unter diesem Namen
im /boot-Verzeichnis.
Was das Erstellen der Module anbetrifft, so
kann man sich dies unter Umständen sparen, wenn alle benötigten
Treiber statisch in den Kernel hineinkompiliert werden, z. B. beim
Einsatz von localyesconfig.
Installiert wird der Kernel natürlich mit make install, die Module
mit make modules_install. Letzteres berücksichtigt den Modul-Pfad,
wie ihn die jeweilige Distribution vorgibt (z. B. /lib/modules in
Ubuntu). Aber auch wie die eigentlich Installation abläuft ist
distributionsspezifisch, denn hier kommt das Skript
/sbin/installkernel zum Einsatz, das den Kernelquellen
nicht beiliegt, sondern vom Distributor entsprechend bereitgestellt wird.
Hier eine Übersicht der Targets zum Kompilieren und Installieren des Kernels:
- vmlinux
- erstellt den Kernel
- bzImage
- erstellt ein komprimiertes Kernel-Abbild
- modules
- erstellt alle konfigurierten Module
- install
-
installiert den Kernel und registriert ihn beim Bootloader
- modules_install
- installiert die Module in den Modul-Pfad des Systems
Weitere Werkzeuge
Ist man irgendwo mit Arbeiten fertig, so räumt man in der Regel auf
und fegt einmal durch. Auch beim Kernelbau sollte man das machen, um
beim Anwenden künftiger Patches keine Überraschung zu erleben. Hier
hilft make clean ungemein, denn es entfernt die Überreste, die
beim Kompilier-Vorgang angefallen sind. Die .config-Datei bleibt
jedoch erhalten.
Einen Überblick über neue Optionen erhält man mit dem Target
listnewconfig. Es stellt die Unterschiede zwischen einer
vorliegenden .config und den verfügbaren Einstellungen des aktuellen
Kernels dar. Und sollte man vergessen haben, was der für eine
Versionsnummer hat, so liefert make kernelversion die Antwort.
Hier eine (unvollständige) Übersicht anderer Targets:
- kernelversion
- zeigt die Versionsnummer aus dem Makefile
- listnewconfig
- listet hinzugekommene Optionen auf
- help
- listet alle Targets
- clean
- entfernt die beim Konfigurieren und Kompilieren erzeugten Dateien
- mrproper
- wie clean, entfernt jedoch auch die Konfiguration und Backup-Dateien
- distclean
- entfernt alle Dateien, die nicht zum Quellcode gehören
Fazit
In diesem Artikel wurden längst nicht alle Targets von make
angesprochen. Eine vollständige Übersicht liefert make help im
Wurzelverzeichnis des entpackten Linux-Quellcodes. Der Blick über
den Tellerrand lohnt sich in jedem Fall, wenn man seinen
Linux-Kernel selbst baut.
Auch wenn man sich letztlich meist mit nur
wenigen der Möglichkeiten, die make hier bietet durchs Leben
kompiliert, bietet die Vielzahl der Targets auch Lösungen für
ausgefallene Aufgaben – und wenn es nur der langweilige
Sonntagnachmittag ist, der mit make randconfig sehr interessant zu
werden verspricht.
| Paketübersicht nach Distributionen |
| Debian/Ubuntu | SuSE | Fedora |
| libncurses5-dev | ncurses-devel | ncurses-devel |
| libqt4-dev | libqt4-devel | qt4-devel |
| libgtk2.0-dev | gtk2-devel | gtk2-devel |
| libglib2.0-dev | gtk2-devel | gtk2-devel |
| libglade2-dev | libglade2-devel | libglade2-devel |
Links
[1] http://www.gnu.org/
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux-Namensstreit
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Ncurses
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/GTK+
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
ist zur Kernelkompilierung auf „make“ angewiesen. Ein Überblick über dessen Möglichkeiten ist da ganz nützlich.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Mathias Menzer
Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der
fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben
Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt
man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.
Fast wäre es ein Aprilscherz geworden, aber Linux 3.4-rc1 [1] erschien auch nach unserer Zeit noch am 31. März und signalisierte damit, dass die Zeit zum Einreichen von Änderungen abgelaufen ist.
Unter den Funktionen, die aufgenommen wurden, ist eine zusätzliche ABI [2] für die Ausführung von 32-Bit-Programmen auf 64-Bit-Systemen. Die neue x32-ABI erfordert extra für sie kompilierte Anwendungen, diese sollen dann jedoch schneller laufen als mit i386 oder x86_64. Der Nouveau-Treiber unterstützt nun auch die neuen Nvidia-Karten mit Kepler-Chip, was dem Einsatz des Entwicklers Ben Skegg zu verdanken ist.
Die zweite Vorabversion [3] lieferte neben den üblichen ersten Fehlerkorrekturen noch ein paar Nachzügler – Pull Requests, die zwar rechtzeitig eingereicht, aber zum -rc1 noch nicht berücksichtigt wurden. Dazu zählen HSI (High Speed Serial Interface), eine DMA-Puffer-Schnittstelle für DRM namens „PRIME“ und ein DMA-Mapping-Framework. Zu Linux 3.4-rc3 [4] hin ging die Zahl der Änderungen erwartungsgemäß zurück. Größere Änderungen waren hier der Treiber für die Kyro-Grafik-Chipsätze von STMicroelectronics, der bislang leider nicht mit x86_64-Systemen zurechtkam, und Fehlerkorrekturen an dem SSD-Treiber mtip32xx für Micron-SSDs.
Auf den ersten Blick schien -rc4 [5] ein Rückschritt zu sein, schoss doch die Zahl der geänderten Codezeilen erheblich in die Höhe. Der Grund lag hier jedoch darin, dass das Bootlogo der Architektur für Motorolas 68000er Serie von Mikroprozessoren von einem Bereich in einen anderen verschoben wurde und den Diff damit erheblich aufblähte, auch wenn er sonst nur kleinere Korrekturen zu bieten hatte. Wer nun auf eine weitere Beruhigung gehofft hatte, wurde von Linux 3.4-rc5 [6] nicht wirklich enttäuscht. Zwar war diese Entwicklerversion wieder etwas größer, doch die meisten Änderungen liegen in der Kategorie Fehlerkorrektur und fallen recht kompakt aus.
Als Longtime-Kernel werden einige ausgewählte Kernel-Versionen über zwei Jahre hinweg gepflegt, während die regulären produktiven Kernel nur bis zur Veröffentlichung ihres Nachfolgers mit Updates ausgestattet werden. Der jüngste Spross ist nun Linux 3.2, der künftig von Debian-Entwickler Ben Hutchings betreut werden wird [7]. Debian nutzt diese Version für das kommende Debian-Release, aber auch Ubuntu wird hiervon Nutzen ziehen, setzt doch die gerade veröffentlichte Version 12.04 Linux 3.2 ein.
Dagegen wird die Pflege eines anderen „Langzeit-Kernels“ nun eingestellt [8]. Willy Tarreau, der bislang die Kernel-Reihe 2.4 betreut hat, verkündete nun dass es keine weiteren Releases mehr geben werde [9]. Diese Reihe wird nun seit 2001 gepflegt, auch wenn seit Ende 2010 keine Veröffentlichung mehr stattfand. Damit ist 2.4 die bislang am längsten gepflegte Reihe, wenn man berücksichtigt, dass bereits 2003 der erste 2.6er Kernel erschien - ein echter Langzeit-Kernel.
Links
[1] https://lkml.org/lkml/2012/3/31/214
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Binärschnittstelle
[3] https://lkml.org/lkml/2012/4/7/123
[4] https://lkml.org/lkml/2012/4/15/179
[5] https://lkml.org/lkml/2012/4/21/180
[6] ttps://lkml.org/lkml/2012/4/29/2
[7] http://www.pro-linux.de/news/1/18290/linux-32-wird-langfristig-unterstuetzte-version.html
[8] http://www.pro-linux.de/news/1/18242/keine-neue-version-von-linux-24-mehr.html
[9] https://lkml.org/lkml/2012/4/9/127
| Autoreninformation |
| Mathias Menzer (Webseite)
hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels und erfährt
frühzeitig Details über interessante Funktionen.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Der Begriff der objektorientierten Programmierung (kurz
OOP [1])
existiert schon eine ganze Weile. Wer zuvor prozedural programmiert
hat, erwischt sich beim Übergang zu OOP öfter dabei, wie er die
früheren Funktionen einfach mit einer Klasse umgibt und dies als
objektorientierte Programmierung verkauft. Die Artikelreihe soll an
einem einfachen Beispiel zeigen, was man in so einem Fall besser
machen könnte.
Bevor man im Artikel fortfährt, sollte man sich den vorherigen Teil
der Reihe durchgelesen haben (siehe freiesMagazin
04/2012 [2]).
Ganz allein auf der Welt
Im letzten Teil wurde die StrategyFactory über statische Methoden
angesprochen. Prinzipiell ist das nicht falsch. Hierfür gibt es
aber auch ein Entwurfsmuster, was dafür Sorge trägt, dass es
im Programmablauf nur eine einzige Instanz einer Klasse gibt:
das Singleton [3].
Design
Das Singleton-Entwurfsmuster lässt sich sehr einfach umsetzen. Hierzu
ist es nur wichtig, dass der Konstruktor der StrategyFactory privat wird.
Manch einer wird sich fragen, wer dann überhaupt noch die Klasse
instanziieren darf. Ganz einfach: die Klasse selbst. Über die statische
Methode getInstance wird dann der Zugriff auf die als Attribut
gehaltene statische Instanz gewährt.
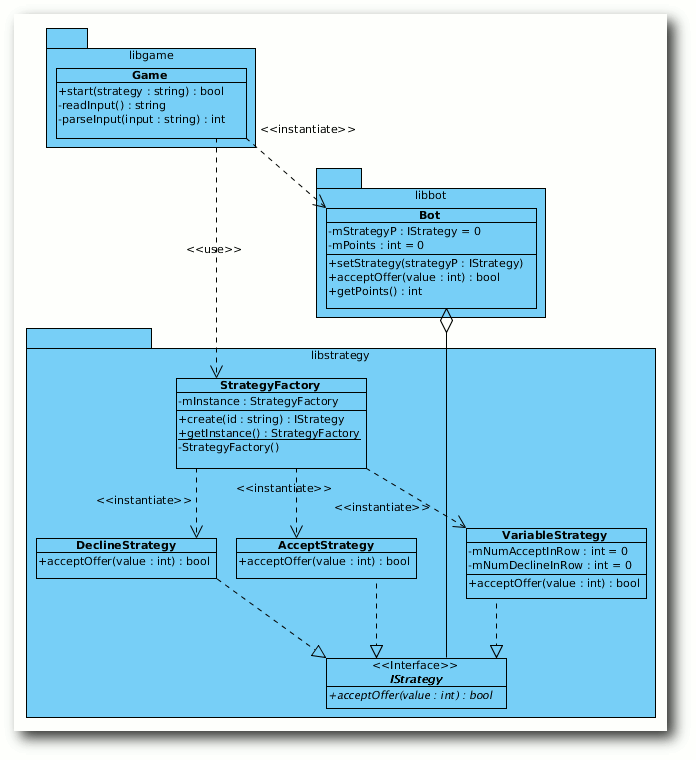
Die StrategyFactory als Singleton.
Klassenaufteilung
An den CRC-Karten hat sich zum letzten Teil nichts geändert, weswegen
diese hier nicht noch einmal extra dargestellt werden sollen.
Abhängigkeiten
Auch an den Abhängigkeiten hat sich zum letzten Teil nichts geändert.
Vor- und Nachteile
Es bestehen weiterhin die gleichen Vor- und Nachteile wie im
letzten Teil. Das heißt, Erweiterbarkeit und Wartbarkeit sind im
aktuellen Zustand sehr gut. Schlecht ist nach wie vor, dass die
Fabrik jedes Mal im Code angepasst werden muss, wenn eine neue
Strategie hinzukommt.
Was ist der Vorteil des Singletons? Es ist sehr klein, aber es
wird sichergestellt, dass es nur eine Instanz des Objektes gibt.
Natürlich hätte man dies auch mittels einer statischen Methode
und eines privaten Konstruktors der vorhergehenden Lösung erreichen können.
Dann hat man aber keine Kontrolle darüber, wann die Objekte, die
die Fabrik benötigt, erstellt werden. Mit dem Singleton ist dies
sichergestellt.
Man sollte sich aber über die Bedeutung des Singletons klar werden.
Selbst, wenn es zwei parallel stattfindende Spiele geben sollte
(also Instanzen von Game), nutzen diese beiden die gleiche
StrategyFactory.
Aufpassen muss man in diesem Kontext auch auf Threadsicherheit. Wenn
es möglich ist, dass die getInstance-Methode parallel aus zwei
Threads gerufen werden kann, muss diese so abgesichert werden, dass
dennoch nur eine Instanz generiert wird. Ansonsten hat man plötzlich
zwei Objekte des Singleton, mit denen gearbeitet wird.
Implementierung
In C++ lässt sich das Singleton-Pattern auf mehrere Arten umsetzen.
In der Beispielimplementierung wurde die einfache Methode gewählt.
Diese ist aber nicht threadsicher, sodass es, wenn es mehrere Threads
geben würde, zwei Instanzen der Fabrik zur gleichen Zeit geben könnte.
Die C++-Implementierung kann als Archiv
heruntergeladen werden: oop5-beispiel.tar.gz.
Registrier' Dich!
Ein Nachteil des bisherigen Designs war, dass die StrategyFactory
wissen musste, welche konkreten Strategien sie erstellt. Wieso
also das
Konzept nicht umkehren? Es wäre besser, wenn
jede Strategie sich bei der Fabrik anmeldet. Die Fabrik muss nicht
wissen, was sie genau dann erstellt, sie muss nur wissen, wie sie
es macht.
Design
Die Fabrik erhält neben der create-Methode auch eine
register-Methode. Die konkreten Strategien können sich nun mit
einem Identifier (als String) bei der Fabrik anmelden bzw. übernimmt
sinnvollerweise ein externer Strategie-Nutzer diese Anmeldung.
Zur Speicherung der Verbindung „Identifier Pfeil rechts Strategie“ wird eine
Klasse StrategyMap benutzt, die das assoziative Array darstellen
soll. Da dies aber in jeder Sprache anders umgesetzt wird, bleibt die
Klasse undefiniert.
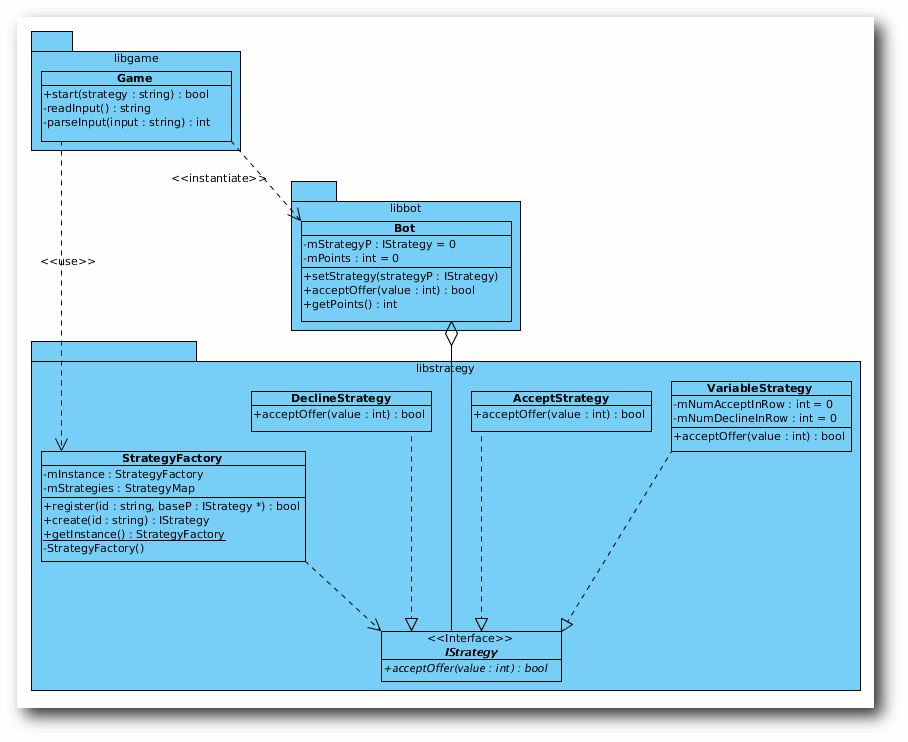
Die Strategien werden bei der Fabrik registriert.
Hinweis: Ein Interface unter der StrategyFactory, welches die
konkreten Strategien zum Registrieren benutzen könnten, lässt sich
nicht oder nur schwer umsetzen, da die StrategyFactory ein Singleton
ist. (Da fällt einem die Design-Entscheidung von vorher auf die Füße.)
Klassenaufteilung
Gegenüber des letztes Teils hat sich nur die CRC-Karte der
StrategyFactory geändert.
- Klasse:
- StrategyFactory
- Benötigt:
- IStrategy
- Verantwort.:
- lässt neue Strategien anmelden und erstellt diese auf Zuruf
Abhängigkeiten
Die Anzahl der Abhängigkeiten hat sich theoretisch verringert, da
die StrategyFactory nun nicht mehr von allen konkreten Strategien
abhängig ist. Dies ist natürlich nur die halbe Wahrheit, da jemand
außerhalb (normalerweise die Hauptroutine) die Anmeldung der
konkreten Strategien übernehmen muss und somit von diesen abhängig
ist.
Vor- und Nachteile
Theoretisch ist man nun am Ziel angekommen. Jede Klasse hat nur
eine Verantwortlichkeit. Die Abhängigkeiten zwischen den
Paketen/Bibliotheken sind sehr gering. libgame muss nur neu
erstellt werden, wenn sich in der Deklaration der StrategyFactory
etwas ändert (was hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird)
und libbot muss nur neu erstellt werden, wenn sich das Interface
IStrategy ändert (was hoffentlich auch nicht passiert).
Ein weiterer Vorteil der Lösung ist, dass zur Laufzeit neue
Strategien hinzukommen können. Man könnte sogar überlegen, eine
unregister-Methode hinzuzufügen, sodass zur Laufzeit manche
Strategien wieder entfernt werden.
Implementierung
Wie oben beschrieben übernimmt am besten die Hauptroutine die
Anmeldung der konkreten Strategien bei der Fabrik. In C++ ist das
die main-Funktion. Dies ist auch sinnvoll, da nur das Hauptprogramm
und nicht irgendeine genutzte Bibliothek weiß, welche Strategien
überhaupt eingesetzt und angeboten werden sollen. Hier könnte man
bei einer Erweiterung mit eigenen Strategien diese ebenfalls anmelden.
Die C++-Implementierung der obigen Klassen kann als Archiv
heruntergeladen werden: oop6-beispiel.tar.gz.
Ausblick
Das Tutorial ist fast am Ende. Im abschließenden Teil soll
es möglich gemacht werden, dass während der Laufzeit die Strategien
eigenständig zu anderen Strategien wechseln können.
Links
[1] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Objektorientierte_Programmierung
[2] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-04
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Singleton_(Entwurfsmuster)
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
ist C++-Software-Entwickler und hat täglich mit Software-Design zu
tun. Dabei muss er sich immer Gedanken machen, dass seine Software
auch in Zukunft einfach wartbar und leicht erweiterbar bleibt.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Uwe Steinmann
Ein DMS ohne Volltextsuche ist kein DMS. Deshalb verfügt auch LetoDMS
seit der Version 3.2.0 über eine solche Suche, die auf den Lucene-Klassen des
Zendframeworks beruht.
Bei der Installation von LetoDMS
stößt man schon auf Einträge
für die Konfiguration der Volltextsuche, jetzt geht es daran, diese korrekt zu setzen.
Zunächst aber gilt es, das Zendframework und das PEAR-Paket
LetoDMS_Lucene zu installieren. Zendframework ist in den Repositorys
vieler Distributionen vorhanden, kann aber alternativ auch direkt von der
Webseite von Zend [1] heruntergeladen werden.
LetoDMS_Lucene findet man im Download-Verzeichnis von LetoDMS. Alle
Anpassungen in der LetoDMS-Konfiguration können über die Einstellungen-Seite
erfolgen. Damit es funktioniert, müssen zunächst beide Pakete so installiert
werden, dass sie über den PHP-Include-Path
gefunden werden.
LetoDMS_Lucene kann man alternativ auch parallel zu
LetoDMS_Core auspacken und dann in den Einstellungen den
Pfad unter
„Lucene LetoDMS directory:“ entsprechend setzen.
Wichtig ist noch das
Verzeichnis lucene unterhalb des Content-Verzeichnisses und die Angabe
des Pfads in den Einstellungen unter „Directory for full text index:“.
Hier wird später der Volltext-Index abgelegt.
Es muss sichergestellt sein, dass
das Verzeichnis vom User des Webservers geschrieben werden kann. Als Letztes
muss noch die Volltextsuche in den Einstellungen eingeschaltet werden und in der
Bedienoberfläche sollte eine Checkbox hinter dem Suchfeld in der Kopfzeile
erscheinen.
Ein Klick auf „Suchen“ (ohne Eingabe eines Suchtextes) zeigt ein
zweigeteiltes Suchformular. Links erscheint die schon bekannte Datenbanksuche
und rechts die neue Volltextsuche.
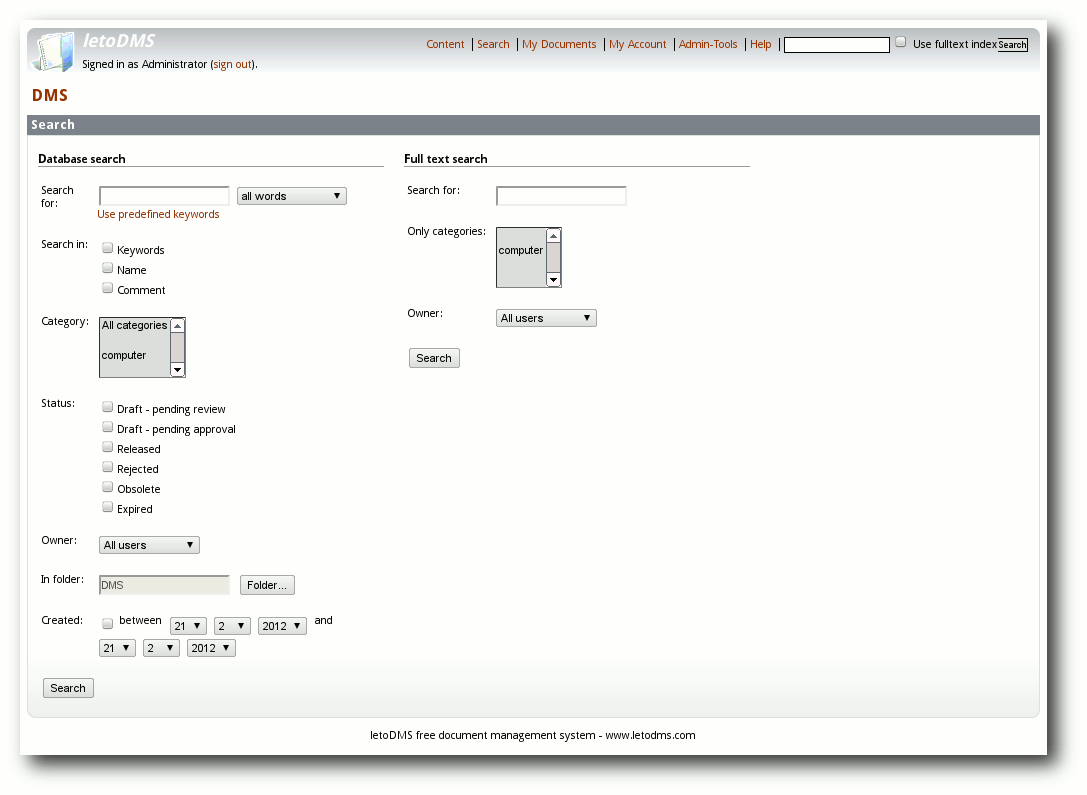
Erweitertes Suchformular mit Datenbank- und Volltextsuche
Jeder Versuch etwas zu suchen wird jedoch zunächst noch scheitern, weil zuvor
der Index angelegt werden muss. Dafür genügt ein Mausklick auf „Create
Fulltext index“ in den Admin-Tools. Je nach Anzahl und Größe der Dokumente kann
dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Ergebnis ist eine eingerückte Liste
mit allen Dokumenten, die indiziert wurden, und einem Index auf der Festplatte.
Zur Kontrolle bietet sich jetzt ein Klick auf „Fulltext index info“ auf
der Seite mit den Einstellungen an. Das Ergebnis ist eine Liste aller
indizierten Wörter und wo sie auftreten, denn es werden nicht nur die Inhalte,
sondern auch die Metadaten der Dokumente indiziert. Die Einträge in der Liste,
die mit „title:“ beginnen, sind beispielsweise Wörter aus dem Titel eines
Dokuments. Wenn man hier keine Einträge findet, die mit „content:“ beginnen
(dies sind indizierte Wörter aus dem Inhalt), dann befindet sich entweder kein
indizierbares Dokument im DMS oder es fehlen noch Programme, die den Inhalt der
Dokumente in eine Textdatei konvertieren. LetoDMS kann in der Version 3.3.0
bisher nur die Formate application/pdf, application/msword,
application/vnd.ms-excel, audio/mp3, audio/mpeg und text/plain indizieren.
Dafür benötigt man die zusätzlichen Programme pdftotext, catdoc, ssconvert und
id3. In der Version 3.4.0 wird man weitere Formate und die passenden Programme
zur Indizierung in der Konfiguration ablegen können.
Werden neue Dokumente eingestellt, dann erscheinen diese nicht sofort im
Fulltext-Index. Dafür ist es notwendig, über den Verweis „Update fulltext
index“ auf der Einstellungen-Seite den Index zu aktualisieren. Den Index nicht
mit jedem Upload eines neuen Dokuments zu aktualisieren, liegt vor allem darin
begründet, dass dies mitunter sehr lange dauern und den Webserver erheblich
belasten kann, insbesondere wenn mehrere Dokumente gleichzeitig oder sehr große
Dokumente hochgeladen werden. Die Aktualisierung sollte daher regelmäßig vom
Administrator (ggf. über einen Cronjob) durchgeführt werden. Dabei werden immer
nur die Dokumente berücksichtigt, die sich seit der letzten Aktualisierung
geändert haben.
Die Suche selbst über das bereits erwähnte zweite Suchformular ist eher
einfach. Ein Feld für den zu suchenden Text sowie zwei Felder (Kategorie und
Besitzer), um das Suchergebnis einzuschränken, sorgen für Übersichtlichkeit. In
zukünftigen Entwicklungen ist eine Erweiterung um weitere Suchkriterien nicht
ausgeschlossen. Auch die Verschmelzung von Datenbank- und Volltextsuche ist
denkbar.
Es bleibt nur noch zu erwähnen, dass man zur Volltextsuche wie auch zu allen
anderen Fragen zu LetoDMS im Forum von
LetoDMS [2] oder unter der deutschen
Webseite [3] Hilfe bekommen kann.
Links
[1] http://framework.zend.com
[2] http://forums.letodms.com/
[3] http://www.letodms.de
| Autoreninformation |
| Uwe Steinmann
ist seit 1996 Entwickler Freier Software und seit Version 3.0.0
hauptverantwortlich für LetoDMS.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Patrick Meyhöfer
Ob im wissenschaftlichen oder privaten Bereich: Möchte man die volle
Kontrolle über das Aussehen seiner erstellten Dokumente behalten,
führt oft kein Weg an LaTeX vorbei. Auch freiesMagazin basiert auf
den vielfältigen Möglichkeiten von LaTeX [1].
Eine LaTeX-Umgebung ist mit TeX-Live auch recht schnell auf allen
Betriebssystem eingerichtet [2].
Dieser Standardweg zeigt jedoch ein paar Restriktionen auf. Sowohl
die Online-Verfügbarkeit des Dokuments von jedem Ort aus sowie der
kollaborative Ansatz, dass mehrere Personen zeitgleich an einem
Dokument arbeiten können, ist mit den Standardmitteln der
Desktopinstallation nicht zu erreichen. Daher sollen nachfolgend
Lösungsansätze vorgestellt werden, die versuchen, die gewünschten
Zusatzfunktionen bereitzustellen.
Cloud-Anbieter oder eigene Hosting-Lösung?
Vorangestellt sei an dieser Stelle angemerkt, dass es zwei
grundlegende Optionen gibt, um das Ziel der Kollaboration in
Verknüpfung mit der Online-Verfügbarkeit zu erreichen:
- Hosting der LaTeX-Dokumente bei einem Cloud-Dienstleister
- eigener Server in Verbindung mit einem Versionskontrollsystem
(SVN, Git, Mercurial usw.)
Die Vor- und Nachteile sind grundsätzlich nicht verschieden zur klassischen
Diskussion über Nutzen und Gefahren
des sogenannten Cloud-Computing, bei dem alle Daten und die eigentliche
Anwendung auf die Infrastrukturen eines Anbieters ausgelagert werden und in
dessen Verantwortungsbereich
liegen [3]. Ebenso sollte man
sich im Voraus Gedanken zu Sicherheit und Seriosität des entsprechenden
Anbieters machen. Auch die mögliche Gefahr einer plötzlichen Schließung des
Dienstes mit dem eventuellen Verlust seiner Daten gehört stets mit in die
Risikobetrachtung. Dennoch bieten die Cloud-Lösungen für den Anwender eine
schnelle und komfortable Einrichtung, die in der Regel in wenigen Sekunden
bereitsteht.
Online-LaTeX-Editoren
Durch den zunehmenden Fortschritt der Webtechnologien und die deutlich größer
werdenden Möglichkeiten, Dokumente in Echtzeit über das
Internet zu bearbeiten,
haben sich verschiedene Anbieter etabliert, die eine bereits fertig
konfigurierte LaTeX-Umgebung bereitstellen.
So findet man neben dem reinen Online-Editor mit integriertem
Syntax-Highlighting auch Möglichkeiten, die erstellten Dateien auf dem
jeweiligen Server zu kompilieren und anschließend zu betrachten. Um eine Auswahl zu treffen, bietet sich ein Vergleich der gängigsten
Anbieter an.
Hinweis: Es werden jeweils nur die kostenlosen Angebote der
einzelnen Anbieter getestet, viele Angebote können jedoch über
Abgabe eines kleinen Betrages zusätzlich erweitert werden.
ScribTeX
Ein interessantes Angebot macht das seit Januar 2009 am Markt
bestehende ScribTeX [4]. Nach einer
kurzen Registrierung auf der Webseite kann man drei verschiedene
Projekte anlegen und insgesamt 50 MB an Speicher für seine Dokumente,
Bilddateien etc. verwenden.
Leider stehen in der kostenlosen Version die Möglichkeiten der
kollaborativen Bearbeitung an Dokumenten nicht zur Verfügung,
wodurch das ansonsten gute Angebot etwas getrübt wird.
Der Editor und die Benutzeroberfläche wirken aufgeräumt. Es stehen
in der Menüleiste lediglich die Möglichkeiten zu speichern,
Kommentare zu
verfassen und das Dokument zu kompilieren zur Verfügung.
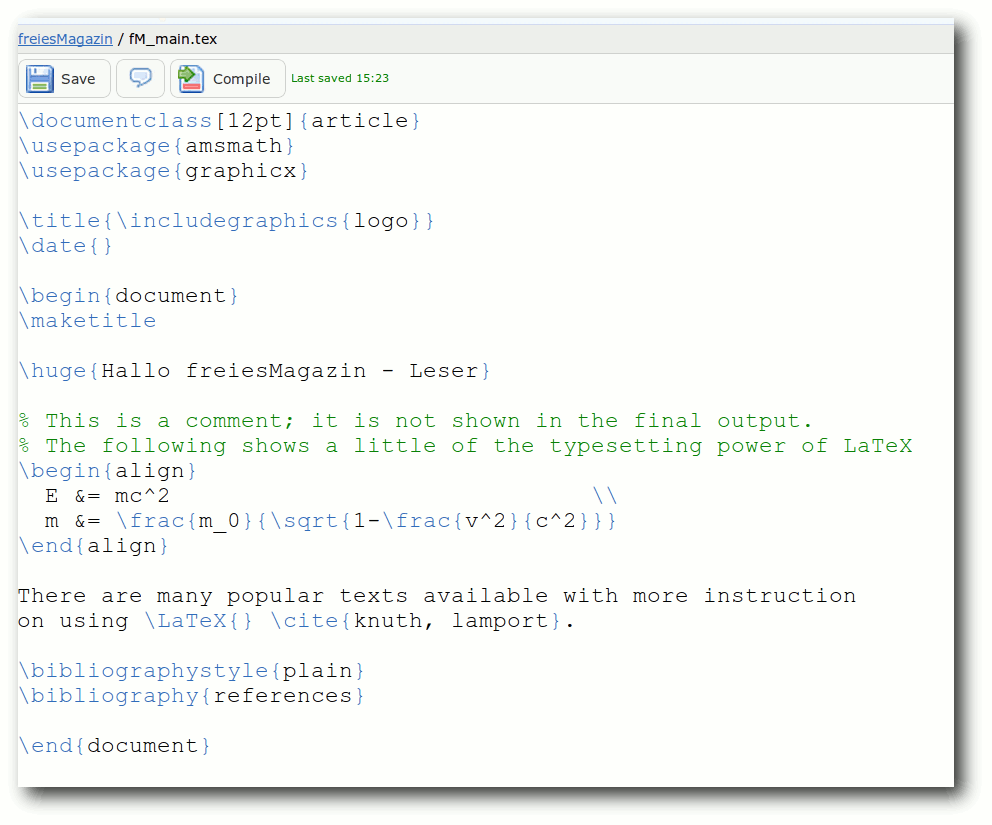
LaTeX-Editor von ScribTeX.
Nach den Klick auf „Compile“ wird das Dokument im Hintergrund
kompiliert und man bekommt im Anschluss das fertig gerenderte
PDF-Dokument in einer Vorschau oder alternativ zum Download
angeboten. Der Kompilierungsvorgang geht schneller als auf meinem
Desktop-Rechner.
Sofern Fehler auftreten oder Warnungen seitens des LaTeX-Compilers
bestehen, sind diese jederzeit im Reiter „Log“ der PDF-Vorschau
einsehbar.
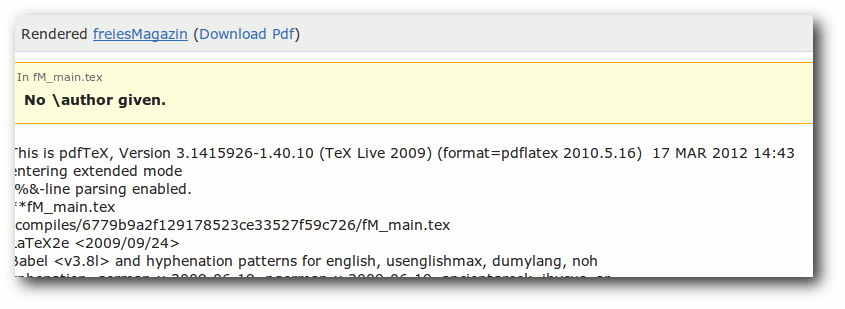
PinsLog-Datei von ScribTeX.
Die Vorteile von ScribTeX liegen neben der Versionskontrolle für die
einzelnen Dateien besonders auf der Unterstützung für das
Versionskontrollsystem Git für all seine Projekte [5].
Insgesamt macht ScribTeX einen ordentlichen Eindruck, die fehlenden
Möglichkeiten der
Zusammenarbeit in der kostenlosen Version trüben
jedoch den guten Eindruck ein wenig.
ShareLaTeX
Im Gegensatz zu ScribTeX ist ShareLaTeX [6]
noch ein junges Projekt, welches sich aktuell noch in der Beta-Phase
befindet, ohne jegliche Differenzierungen zwischen Bezahlaccounts
und kostenlosen Accounts.
Der Aufbau und die Funktionsweise ist ähnlich komfortabel wie bei
ScribTeX, auch hier steht ein Online-Editor zur Verfügung, der
neben Syntax-Highlighting auch die zugehörigen Klammernpaare anzeigt.
Einzig ein Befehlsvorschlag mit den in Frage kommenden Befehlen, wie
man es aus gewöhnlichen Entwicklungsumgebungen kennt, wäre
wünschenswert.
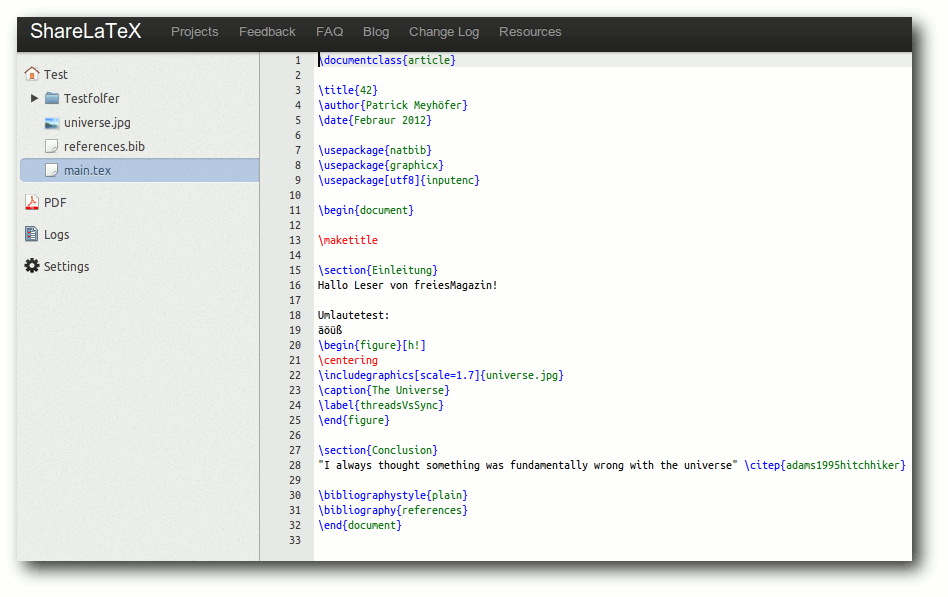
Oberfläche von ShareLaTeX.
Der Vorteil von ShareLaTeX liegt vor allem auch im Bereich der
Kollaboration. Es ist sehr einfach, über die Einstellungen einen
weiteren Benutzer zum aktuellen Projekt mit Lese- und
Schreibberechtigungen auszustatten, sodass der Zusammenarbeit nichts
entgegen steht.
In Zukunft denkt man zur Refinanzierung des Projektes darüber nach,
die Anzahl der Projekte zu limitieren. Es soll aber jederzeit einen
kostenlosen Account geben [7].
Man sollte hier jedoch beachten, dass die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen [8]
derzeit noch bearbeitet werden und man sie sich nach Ablauf der
Beta-Phase noch einmal anschauen sollte.
writeLaTeX
Ein dritter Vertreter, der sogar komplett ohne Registrierung auskommt,
ist writeLaTeX [9]. Die Bedienung ist sehr
einfach und intuitiv, denn nach dem Klick auf „Start Writing Now“ wird
man automatisch zu einem LaTeX-Dokument weitergeleitet, welches
direkt bearbeitet werden kann. Hierfür wird ein eindeutiger Link
generiert, den man jetzt einfach seinen Freunden und Mitarbeitern am
Projekt weiterleiten kann, die dann ebenfalls
direkt mit dem
Editieren des Dokuments beginnen können.
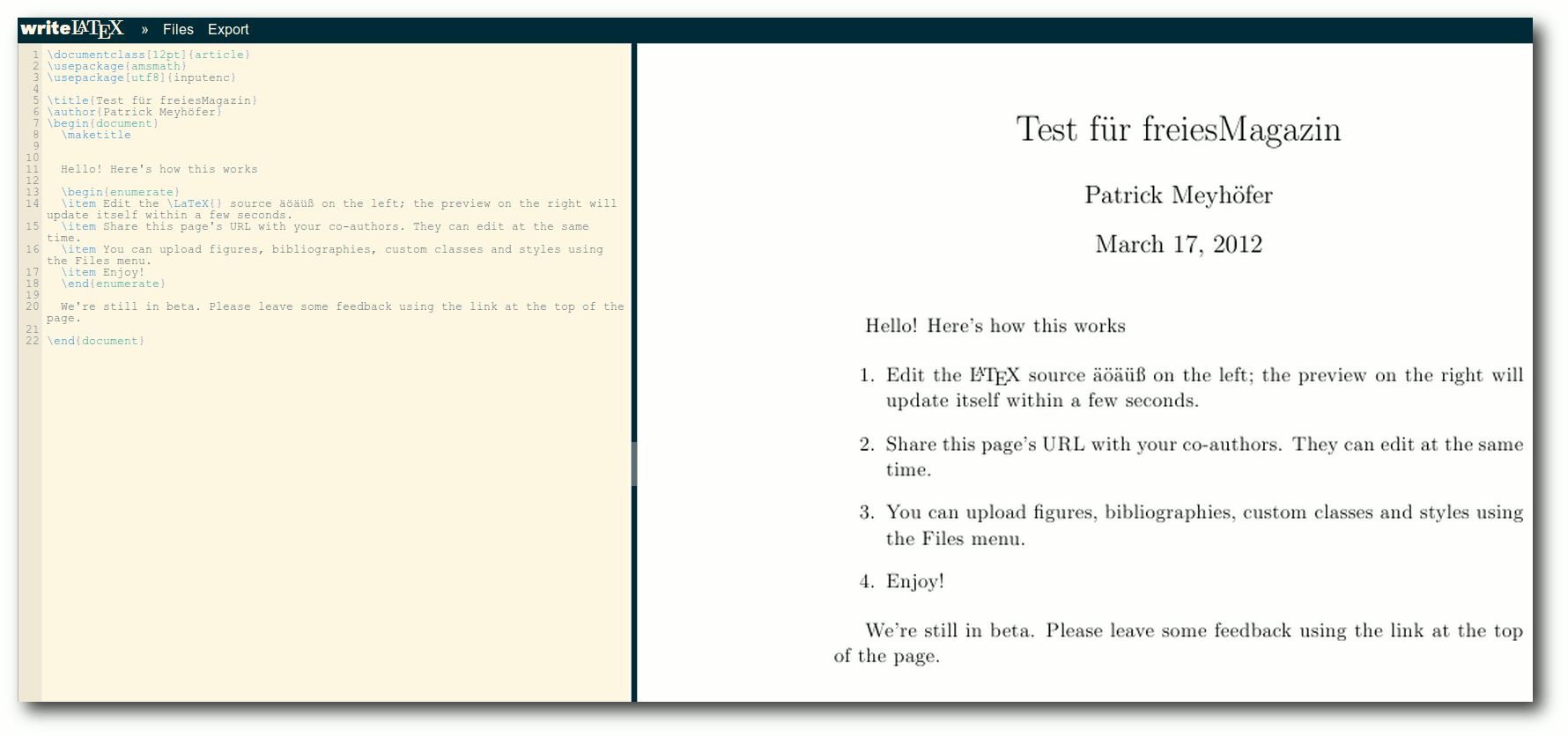
Schlicht gehaltene Oberfläche von writeLateX.
Die gesamte Benutzeroberfläche ist in zwei horizontale
Fenster geteilt, wodurch man mit einer kurzen Verzögerung das
Ergebnis direkt auf der rechten Seite sieht, welches man im
Code-Editor auf der linken Seite definiert hat.
Das Projekt setzt auf dem durchaus populären Etherpad [10]
auf, welches bereits die komfortablen Möglichkeiten der gemeinsamen
Online-Bearbeitung von Dateien in mehren Projekten bewiesen hat
(siehe u.a. auch das Piratenpad der Piratenpartei [11])
Generell ist writeLaTeX eine der einfachsten und schnellsten
Möglichkeiten, gemeinsam an LaTeX-Dokumenten zu arbeiten. Es besteht
ebenfalls die Möglichkeit, weitere Dokumente hochzuladen sowie das
PDF-Dokument bzw. alle Dateien als Zip-Datei anschließend
herunterzuladen. Hier ist man allerdings auf maximal 10 zusätzlich
hinzufügbare Dateien (Bilder, .tex-Dateien, Bibliographie-Dateien
usw.) limitiert, wodurch writeLaTeX eher für relativ kleine und
schnell umzusetzende Projekte geeignet ist.
LaTeX Lab
Einen etwas anderen Ansatz als die bisher vorgestellten Lösungen
verfolgt LaTeX Lab [12]. Das Projekt steht
unter der Apache Licence Version 2 und wird auf Google Code
gehostet [13]. Es setzt direkt
auf einer der bekanntesten Plattformen für Zusammenarbeit an Texten
auf, nämlich auf Google Docs, und integriert in dieses einen
LaTeX-Editor. Demzufolge muss man sich hier auch nicht neu
registrieren, sondern man muss über OAuth lediglich der Anwendung
den Zugriff auf Google Docs erlauben, damit LaTeX Labs auch die
Dateien im Google-Docs-Account speichern kann. Voraussetzung ist hierfür
lediglich, dass man auch bereits ein Google-Konto angemeldet hat.
Der Vorteil von LaTeX Lab liegt auf der Hand: Man nutzt die
Google-Technologien und hat ein einheitliches Bild wie aus Google
Docs
bekannt, lediglich mit den speziellen Funktionen auf LaTeX
angepasst.
Generell erinnern die Funktionen am ehesten an die der klassischen
Desktop-Umgebungen wie
Kile [14] oder Texmaker [15]. So stehen u.a.
Möglichkeiten über das Menü zur Verfügung, um sich Aufzählungen
generieren zu lassen, mathematische Zeichenbefehle ausgeben zu
lassen, grundlegende Formatierungen zu nutzen und vieles mehr. Über
die Iconleiste hat man zudem einfach die Möglichkeit, das Dokument zu
kompilieren und als PDF-Vorschau im Browser angezeigt zu bekommen.
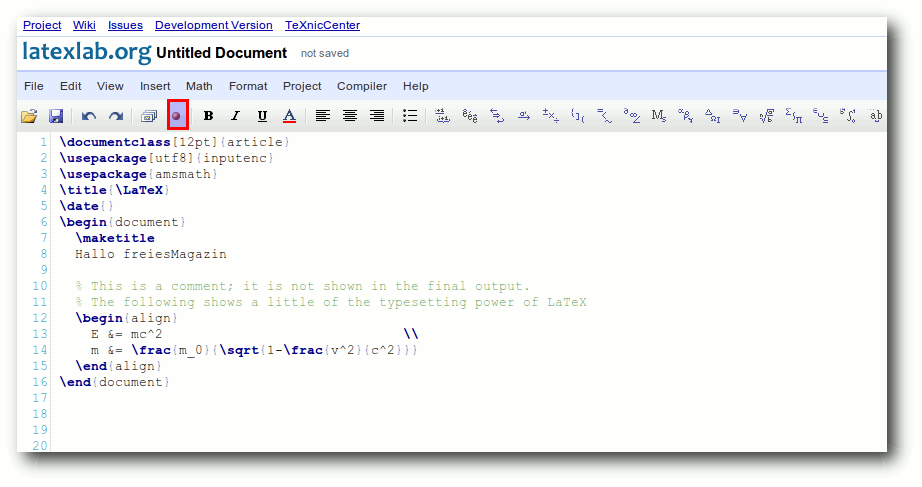
LaTeX-Labs-Oberfläche im Stile von Google Docs.
Der große Vorteil liegt bei LaTeX Labs an der tiefen Integration in
Google Docs. So kann man 1 GB an Daten speichern und hat die
LaTeX-Dateien bei seinen normalen Dokumenten jederzeit verfügbar,
sofern man keine Aversionen allgemeiner Art gegenüber Google hegt.
Zudem steht auch bei Google Docs standardmäßig eine
Versionierungsoption zur Verfügung, mit der man auf vorherige
Versionen
zurückspringen kann,
falls man einmal diese früheren Änderungen braucht.
Eigene Hosting-Lösung über ein Versionskontrollsystem
Wer seine Daten nicht aus der Hand geben will, weil er entweder den
vorgestellten Anbietern der verschiedenen Dienste nicht vertraut
oder weil es einfach vertrauliche Dateien sind, die keinem
Cloud-Anbieter anvertraut werden sollten, kann sich dennoch behelfen, um
eine möglichst umfangreiche Zusammenarbeit und Verfügbarkeit seiner
Dokumente zu erreichen.
Hierfür benötigt man lediglich einen eigens aufgesetzten Server. Grundsätzlich
ist es egal, ob man diesen mit einem zentralen Versionskontrollsystem wie
Subversion [16] oder mit einem dezentralen
System wie Git [17] installiert.
In Anbetracht der Möglichkeiten der Versionierung und Nachvollziehbarkeit, wer
welche Änderungen am Dokument vorgenommen hat, sind diese durchaus den
Online-Lösungen überlegen,
die häufig nur eine gewisse Anzahl an Änderungen in
der Versionshistorie abspeichern, während man bei SVN & Co. alle Änderungen
von Beginn des Dokuments einsehen
kann [18].
Der Nachteil liegt eher bei der Zusammenarbeit in Echtzeit. Man kann hier
die Änderungen am Dokument nicht so direkt und komfortabel verfolgen, wenn man nicht
ständig Updates der Quelldateien machen möchte. Hier sind die Online-Tools
deutlich im Vorteil.
Im Gegenzug ist man bei der Projektgröße oder der Anzahl an
Mitarbeitern am Projekt auf
keinerlei Limitierungen von fremden
Anbietern angewiesen, sondern einzig auf die Limitierungen, die der
selbst aufgesetzte Server besitzt.
Bei freiesMagazin setzt man ebenfalls auf die eigene Hosting-Lösung
mit einem Subversion-Server, da man die eigenen Daten und die der
Autoren nicht aus der Hand geben will.
Links
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX
[2] http://wiki.ubuntuusers.de/LaTeX
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud-Computing
[4] http://www.scribtex.com/
[5] http://support.scribtex.com/entries/420897-accessing-your-projects-with-git
[6] https://www.sharelatex.com/
[7] https://www.sharelatex.com/blog/posts/welcome.html
[8] https://www.sharelatex.com/termsAndConditions.html
[9] http://writelatex.com/
[10] http://etherpad.org/
[11] http://www.piratenpad.de/
[12] http://docs.latexlab.org
[13] https://code.google.com/p/latex-lab/
[14] http://kile.sourceforge.net/
[15] http://www.xm1math.net/texmaker/
[16] http://subversion.tigris.org/
[17] http://git-scm.com/
[18] https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Collaborative_Writing_of_LaTeX_Documents
| Autoreninformation |
| Patrick Meyhöfer (Webseite)
erkundet gerne neue und relativ unbekannte Software und veröffentlicht
entsprechende Erfahrungsberichte regelmäßig in seinem Blog.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Andreas Weber
Anfang März 2012 wurde die neue Version „Milan” der Groupware
Tine 2.0 veröffentlicht. Höchste Zeit also, sich die neue Version
anzusehen. Im folgenden Artikel werden die gebräuchlichsten
Installationsmethoden sowie die Grundkonfiguration von Tine 2.0
beschrieben.
Einleitung
Bei Tine 2.0 [1] handelt es sich um eine
browser-basierte Groupware, zu deren Ausstattung unter anderem folgende
Elemente gehören:
- ein Adressbuch
- ein Kalender
- eine E-Mail- und Aufgaben-Verwaltung
- ein Projekt-Management
- die Anbindung an Asterisk [2]
- eine Customer-Relationship-Management-Software (CRM)
- die Synchronisation von mobilen Geräten mittels ActiveSync, CalDAV und
CardDAV,
- und seit Milan auch ein Datei-Manager
Zusätzlich kann der Funktionsumfang mit Hilfe von Community-Downloads erweitert
werden. Dadurch ist zum Beispiel die Anbindung an Sipgate [3] möglich.
Tine 2.0 war ursprünglich als neue Version der bekannten Lösung
EGroupware [4] gedacht und entstand nach
Unstimmigkeiten zwischen den Entwicklern unabhängig und von Grund auf neu. Es
handelt sich also nicht um einen Ableger (Fork) von EGroupware, sondern um eine
vollständig neu entwickelte Software. Der Vorteil dieser kurzen Historie ist,
dass Tine 2.0 auf moderner Technik basiert. In den Grundfunktionen ist
die Groupware bereits ausgereift und für den produktiven Einsatz geeignet.
Darüber hinaus steht Tine 2.0 mit vollem Funktionsumfang als
Open-Source-Software zur Verfügung. Kommerzielle
Unterstützung [5] und Hosting [6] wird durch das Unternehmen Metaways [7] angeboten, welches das Projekt finanziert.
Voraussetzungen
Für die Installation von Tine 2.0 wird ein Webserver mit PHP (mindestens
in der Version 5.2.1, empfohlen ist Version 5.3) benötigt. Als Webserver kann
Apache, lighttpd, nginx oder der IIS von Microsoft verwendet werden. Wichtig
ist dabei, dass der Webserver das URL-Rewriting [8] unterstützt, da dies für ActiveSync
und andere Komponenten relevant ist. Ferner muss ein MySQL-Server in Version
5.0 oder höher vorhanden sein. Da diese Software-Voraussetzungen mittlerweile
auf allen Betriebssystemen erfüllbar sind, kann man Tine 2.0 sowohl auf
Linux- und BSD-Distributionen als auch unter Mac OS X oder Windows
installieren. Für Tine 2.0 sollte man aber einen
aktuellen Browser verwenden.
Installation
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Tine 2.0 zu installieren. In diesem
Artikel sollen die Installation mittels Paketquelle (Repository) und die
manuelle Installation beschrieben werden. Der Vorteil bei der Installation
mittels Paketquelle liegt darin, dass die Installation schnell und einfach
durchgeführt wird und man sich viele manuelle Schritte spart. Allerdings steht
diese Variante nur für Debian-basierte Linux-Distributionen zur Verfügung.
Kommt eine andere Linux- oder BSD-Distribution, Mac OS X oder Windows zum
Einsatz oder möchte man statt des Apache- oder lighttpd-Webservers einen
anderen Webserver einsetzen, so muss man die manuelle Installation verwenden.
Beide Installationsmöglichkeiten setzen jeweils voraus, dass ein MySQL-Server
bereits installiert worden ist.
Installation mittels Paketquelle
Da in den großen, bekannten Linux-Distributionen keine Tine 2.0-Pakete
in den offiziellen Paketquellen vorhanden sind, muss zuerst die Tine
2.0-eigene Paketquelle eingebunden werden. Diese existiert wie gesagt nur
für Debian Squeeze und Ubuntu Natty Narwhale [9].
Nach dem Einbinden der Paketquelle und der Aktualisierung der
Paketverwaltung kann man das Paket tine20 installieren.
Gleich zu Beginn der Installation erscheint eine Abfrage, ob Apache oder
lighttpd als Webserver verwendet werden soll. Es wird jedoch empfohlen, Apache
als Webserver zu verwenden, da beim Setup die Integration von lighttpd noch
nicht ganz abgeschlossen ist [10].
PHP und alle
notwendigen Erweiterungen installiert das Setup, sofern nötig, automatisch.

Auswahl des Webservers.
Im Verlauf der Installation wird die Datenbank für Tine 2.0 entsprechend
eingerichtet. Außerdem muss ein Benutzername samt Passwort für den
browser-basierten Teil des Tine 2.0-Setups angegeben werden. Damit ist
der konsolen-basierte Teil der Installation abgeschlossen. Der browser-basierte
bzw. grafische Teil der Installation wird im Anschluss an den Abschnitt über
die manuelle Installation beschrieben.
Manuelle Installation
Für eine erfolgreiche manuelle Installation ist eine bereits vorkonfigurierte
Umgebung bestehend aus Webserver mit PHP-Unterstützung und einem MySQL-Server
notwendig. Zudem muss eine Datenbank mit dazugehörigem Benutzer für Tine
2.0 bereits eingerichtet sein. Als Erstes lädt man das aktuelle Archiv
herunter und entpackt es in das Root-Verzeichnis des Webservers
(/var/www/ unter Linux):
$ wget http://www.tine20.org/downloads/2012-03-2/tine20-allinone_2012-03-2.tar.bz2
# mkdir /var/www/tine20
# tar xfvj tine20-allinone_2012-03-2.tar.bz2 -C /var/www/tine20
Da Tine 2.0 eine Konfigurationsdatei verwendet, erstellt man eine Kopie
der im Archiv enthaltenen Vorlage:
# cd /var/www/tine20
# cp config.inc.php.dist config.inc.php
Nun editiert man die Datei config.inc.pgp (mit Root-Rechten), um die Konfiguration für die Datenbank und den
Setup-Benutzer samt Passwort vorzunehmen. Ist die Konfigurationsdatei für den
Webserver nicht beschreibbar, so kann man nach Abschluss der Konfiguration eine
aktuelle
Version aus dem grafischen Teil des Setups herunterladen und auf dem
Webserver platzieren. Bei der manuellen Installation sind weitere Schritte
notwendig, um die Weiterleitungsregeln für ActiveSync, CalDAV und CardDAV
einzurichten. Diese unterscheiden sich allerdings nach dem Typ des Webserver,
der eingesetzt wird [11] [12].
Grundkonfiguration
Tine 2.0 bietet eine Fülle an Funktionen und Möglichkeiten. Im Setup
kann sowohl die Anbindung an einen Mail-Server als auch an Verzeichnisdienste
konfiguriert werden, Pfade und Protokoll-Einstellungen können vorgenommen und
die Anwendungen von Tine 2.0 können installiert oder auch deinstalliert
werden.
Das Tine 2.0-Setup wird in einem Browser über die Adresse
http://www.hostname.tld/tine20/setup.php aufgerufen. Nach erfolgreicher
Anmeldung müssen zunächst die diversen Lizenzverträge und die
Datenschutzvereinbarung angenommen werden, da das Tine 2.0-Gesamtpaket
aus einer Vielzahl an Open-Source-Lizenzen (AGPLv1, AGPLv3, New BSD License,
LGPLv2.1, LGPLv3, Apache License 2.0 und GPLv3) besteht. Danach folgt ein
erster Test der Umgebung.
Im Abschnitt „Config Manager“ werden die
Datenbank-Verbindung und verschiedene Verzeichnis-Pfade konfiguriert oder
geändert, jedoch ist bei einer Installation über die Paketquelle an dieser
Stelle in der Regel keine Änderung notwendig.
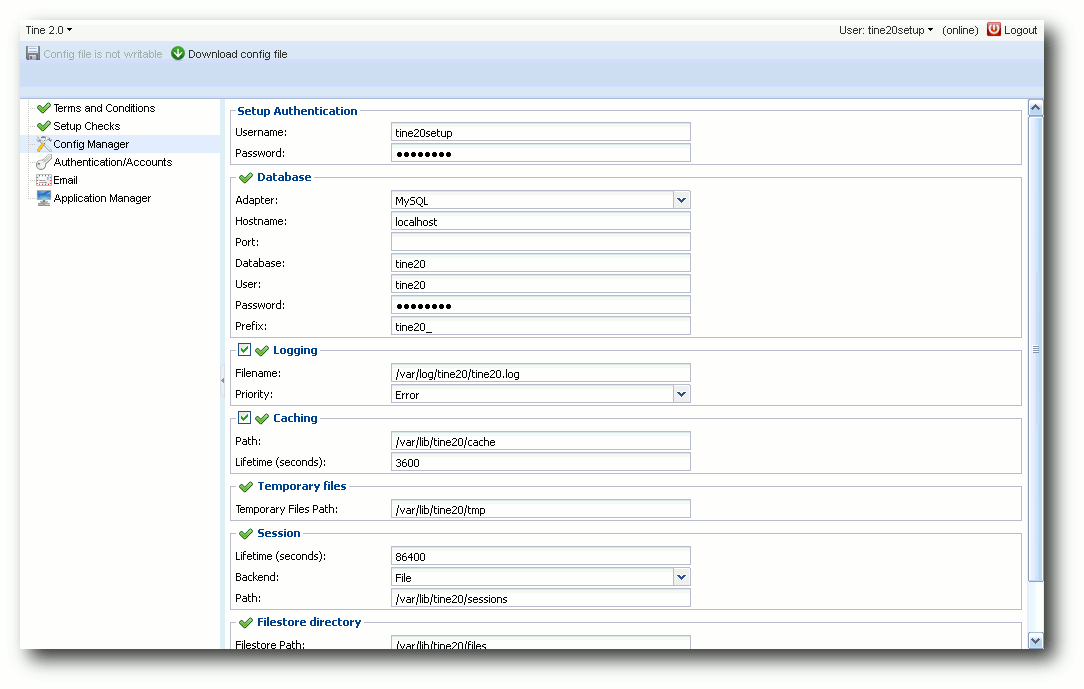
Tine 2.0-Setup – Config Manager.
Im Abschnitt „Authentifizierung/Benutzerkonten“ muss der initiale
administrative Benutzer mit
zugehörigem Passwort angelegt werden. Erst nachdem
dieser Schritt vollzogen ist, kann die weitere Konfiguration erfolgen. Ferner
kann hier konfiguriert werden, ob Benutzer mit SQL, LDAP oder IMAP
authentifiziert werden.
Im Abschnitt „Email“ wird die Konfiguration für den IMAP- und SMTP-Server
vorgenommen. Hier können sowohl der jeweilige Standard, als auch DBmail, Cyrus,
Dovecot und Postfix konfiguriert werden. Zwar ist für den Betrieb von
Tine 2.0 grundsätzlich kein Mail-Server notwendig, allerdings benötigt
man diesen für die diversen Kalenderalarme, Termineinladungen usw.
Im Abschnitt „Application Manager“ können die einzelnen Tine
2.0-Anwendungen installiert werden. Direkt nach der Installation ist neben der
„Tinebase“ nur der administrative
Teil und das Adressbuch vorinstalliert.
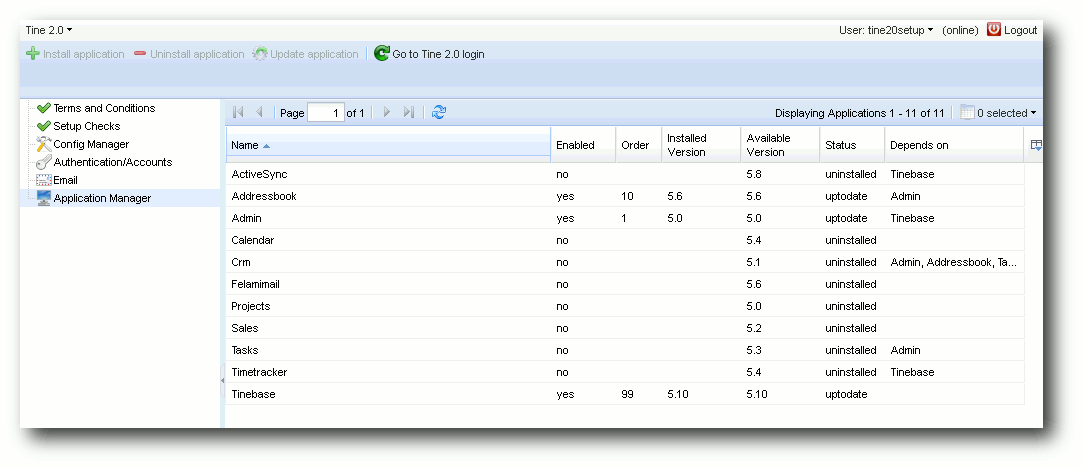
Tine 2.0-Setup – Application Manager.
Im Grunde kann Tine 2.0 bereits jetzt als Adressbuch genutzt werden. In
der Regel werden mittels einer Groupware Adressbuch, Kalender und E-Mail zur
Verfügung gestellt. Welche Anwendungen man nun innerhalb von Tine 2.0
installiert, ist von den jeweiligen Anforderungen abhängig. Man kann mehrere
Anwendungen auf einmal installieren, indem man die betroffenen Anwendungen
auswählt und auf „Install application“ klickt. Nach einem kurzem Moment stehen
die Anwendungen dann zur Verfügung. Nun kann man sich vom Setup ab- und am
eigentlichen Tine 2.0 anmelden.
Kalenderalarme
Damit Kalenderalarme funktionieren, muss neben der erforderlichen
E-Mail-Konfiguration ein Cronjob angelegt werden. Diesen fügt man durch den
Aufruf von
# crontab -e
mittels folgender Zeile hinzu:
* * * * * php -d include_path=.:/usr/share/tine20:/usr/share/tine20/library:/etc/tine20 /usr/share/tine20/tine20.php --method Tinebase.triggerAsyncEvents
Der Befehl muss bei einer manuellen Installation von Tine 2.0
entsprechend angepasst werden. Durch diesen Cronjob prüft Tine 2.0 jede
Minute, ob Kalenderalarme auszulösen sind. Ist das der Fall, versendet die
Groupware eine E-Mail an die am Termin teilnehmenden Benutzer.
Die erste Anmeldung
Um sich in Tine 2.0 anzumelden, ruft man in einem Browser die Adresse
http://www.hostname.tld/tine20 auf. Je nachdem, wie die
Benutzerauthentifizierung durchgeführt wird, kann man sich ggf. mit einem
bestehenden Benutzer anmelden. Ist keine Authentifizierung mittels LDAP oder
IMAP konfiguriert, wird gegen die Tine 2.0 eigene Benutzerverwaltung,
die innerhalb der MySQL-Datenbank liegt, authentifiziert. Daraus ergibt sich,
dass man sich bei der ersten Anmeldung nur mit dem im Setup definierten,
initialen administrativen Benutzer anmelden kann.
Sobald man angemeldet ist,
kann man weitere Benutzer anlegen. Dazu wählt man links oben den Reiter „Tine
2.0“ aus und klickt dort auf „Admin“. In diesem Bereich können die Benutzer
verwaltet, Berechtigungen vergeben und weitere Konfigurationen vorgenommen
werden. Je nachdem, welche Anwendungen installiert und über das
Berechtigungssystem für die Benutzer zugelassen wurden, steht dem Anwender nach
der Anmeldung der entsprechende Funktionsumfang zur Verfügung.
Nach der ersten
Anmeldung sieht man zunächst noch nicht allzu viel, da die einzelnen
Anwendungen noch nicht direkt angezeigt werden. Um nun eine Anwendung
aufzurufen, muss man links oben auf „Tine 2.0“ klicken und die gewünschte
Anwendung aufrufen. Daraufhin öffnet sich eine neue Registerkarte innerhalb
der Groupware. Die Registerkarten kann man frei anordnen und Tine 2.0 merkt
sich, welche Anwendungen man zuletzt in welcher Reihenfolge geöffnet hatte. Die
Oberfläche wirkt aufgeräumt und die meisten Funktionen sind selbsterklärend.
Von Vorteil ist, dass vom Projekt immer wieder Umfragen vorgenommen werden, bei
denen es um die Benutzbarkeit (Usability) geht. Die Ergebnisse dieser Umfragen
fließen in das Produkt ein, wodurch man deutlich die intuitive Bedienung und
den Arbeitsablauf (Workflow) spürt.
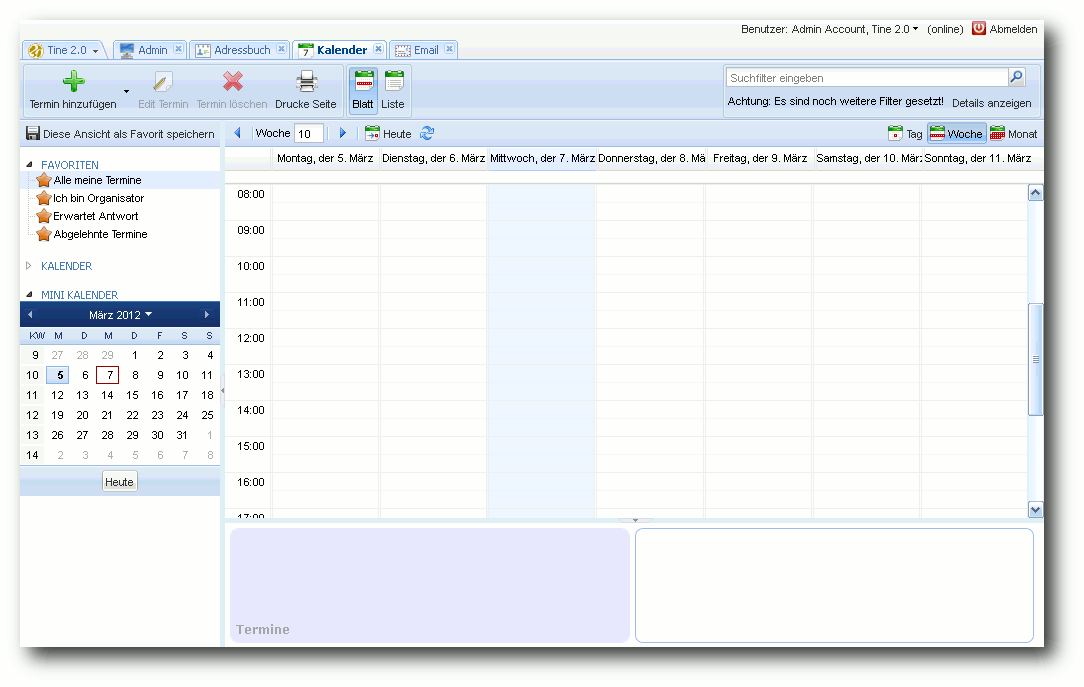
Tine 2.0 – Geöffnete Anwendungen.
Fazit
Tine 2.0 ist eine leicht zu installierende Groupware, die auf moderner
Technik beruht und
sich im Browser nahezu wie eine klassische Anwendung
verhält. Die vielen Möglichkeiten zur Synchronisierung von mobilen Geräten
machen die Software gerade für Unternehmen mit Außendienst-Mitarbeitern
interessant. Im Gegensatz zu manch anderer Open-Source-Lösung steht der volle
Funktionsumfang zur Verfügung, so dass keine zusätzlichen Module oder
Programmteile kostenpflichtig lizenziert werden müssen.
Die stete
Weiterentwicklung und Verbesserung sorgen ihrerseits dafür, dass die Community
weiter wächst. Für Fragen und Hilfe steht neben der kommerziellen Unterstützung
ein Forum zur Verfügung, in dem die Entwickler selbst mitlesen und antworten.
Von großem Vorteil ist auch die Plattformunabhängigkeit der Groupware, denn so
ist man nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. Man kann den bzw. die
zugrunde liegenden
Serversysteme je nach Kundenwunsch oder -projekt auswählen.
Ferner dürfte es im Zuge des Investitionsschutzes für Unternehmen interessant
sein, vorhandene Betriebssystemlizenzen für Tine 2.0 nutzen zu können,
ohne zwingend auf ein System wechseln zu müssen, für das unter Umständen keine
Expertise im Haus vorhanden ist.
Links
[1] http://www.tine20.org/
[2] http://www.asterisk.org/
[3] http://www.sipgate.de
[4] http://www.egroupware.org/
[5] http://www.tine20.com/
[6] http://www.officespot.net/
[7] http://www.metaways.de/
[8] http://de.wikipedia.org/wiki/Rewrite-Engine
[9] http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Install_Howto
[10] http://www.andysblog.de/tine-2-0-lighttpd-als-webserver
[11] http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Synchronisation
[12] http://www.tine20.org/wiki/index.php/Admins/Thunderbird-Synchronisation
| Autoreninformation |
| Andreas Weber (Webseite)
ist selbständiger IT-Dienstleister und Blogger. Er ist seit über
10 Jahren in der IT tätig und beschäftigt sich täglich mit Themen rund um
Server und Netzwerke.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Die Ausgabe von freiesMagazin [1] im Februar
enthielt einen kleinen Test diverser UML-Programme. Dabei wurde aber
das UML- und Mindmap-Programm Astah [2] übersehen,
worauf mich Scott Reece von der entwickelnden Firma Change Vision
per E-Mail aufmerksam machte. In diesem Artikel soll gezeigt werden,
ob die E-Mail-Nachricht eine gute Idee war und ob das Programm mit
anderen mithalten kann.
Einleitung
Astah (auch astah* geschrieben) gibt es bereits seit 1996 auf dem
Markt. Damals hieß es noch JUDE (nicht wie der Religionsangehörige
ausgesprochen, sondern wie der Schauspieler Jude Law), wurde aber
wegen Bedenken von deutschen Nutzern aufgrund der Doppeldeutigkeit
des Namens 2009 in Astah
umbenannt [3].
Astah auf ein UML-Programm zu degradieren wäre ungerecht, da es auch
andere Funktionen wie Mind Maps, Entity-Relationship-Diagramme,
Flowcharts und mehr unterstützt. Diese Funktionen sind aber fast
ausschließlich der kostenpflichtigen Professional
Edition [4] von Astah vorbehalten. Daneben
gibt es noch eine kostenpflichtige UML-Edition, welche vor allem die
UML-Funktionalität mitbringt.
Für den Artikel wurde die kostenlose Community Edition von Astah
getestet, welche alle benötigten UML-Funktionen zur Verfügung stellt
und
sich so mit anderen UML-Programmen messen kann. Mir wurde zwar
angeboten, am „Friends of Astah“-Programm [5]
teilzunehmen, bei dem man eine 1-Jahres-Lizenz für die Professional
Edition bekommt, aber die Funktionen der Community Edition reichen
für den Test aus.
Dennoch ist es schön zu sehen, dass Change Vision den Community-Gedanken
fördert und aktive Blogger, Autoren und Referenten durch so ein
Angebot unterstützen will. Daneben werden auch diverse Open-Source-Projekte
mit Lizenzen gestützt [6].
Insgesamt versucht man aber
natürlich, mit dem Vertrieb von Lizenzen
kommerziell erfolgreich zu sein.
Der Test
Wie bei den im Februar getesteten Programmen soll ein
simples UML-Klassendiagramm erstellt werden, welches die
gebräuchlichen Elemente wie Klassen, Interfaces, Enums,
Realisierung, Generalisierung, Abhängigkeit, Komposition und
Aggregation beinhalten soll. Daneben wurde aber auch noch ein kurzer
Blick auf Sequenz- und Aktivitätsdiagramme geworfen.
Installation und Start
Auf der Downloadseite für die Community-Edition [7]
gibt es neben den Windows- und Mac-Versionen auch mehrere Pakete
für Linux, darunter die bekannten DEB- und RPM-Pakete, die über
die Paketverwaltung installiert werden können.
Für den Test wurde die Zip-Version ohne Java Runtime Environment
(JRE) und ohne Installer heruntergeladen. Das Zip-Archiv wird einfach
entpackt und danach kann man (nach dem Ausführbarmachen der Startdatei)
Astah aufrufen:
$ unzip astah-community-6_5_1.zip
$ cd astah_community
$ chmod +w astah
$ ./astah
Für die Benutzung muss eine JRE wie OpenJDK installiert sein. Die
Oberfläche ist leider nur in Englisch vorhanden.
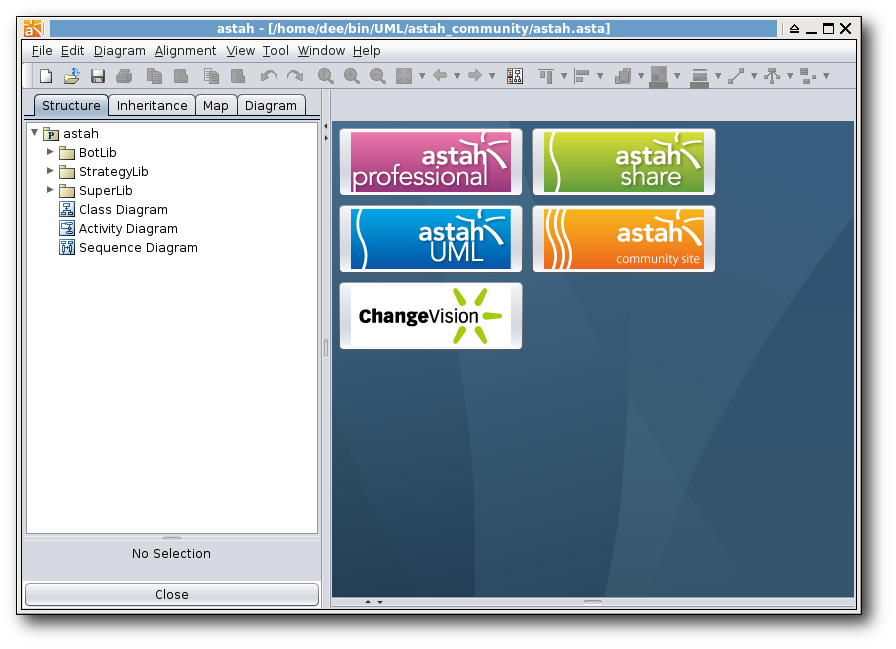
Das Startbild von Astah im Nimbus-Look.
Klassendiagramme
Die Pakete und Klassen lassen sich in Astah sehr intuitiv erstellen.
Entweder man klickt mit der
rechten Maustaste in die Klassenübersicht
und wählt dort „Create Model“ oder man klickt das gewünschte Icon
in der Symbolleiste über dem Diagramm an. Daneben kann man auch
direkt auf eine Klasse im Diagramm klicken und erhält dort zwei
kleine, farbige Symbole, um Methoden (grün) oder Attribute (orange)
hinzuzufügen.
Die Eingabe der Methoden und Namen kann man praktischerweise direkt
in die jeweilige Zeile eintippen, muss sich dabei aber an die
UML-Notation halten. Alternativ kann man in der linken Übersicht
über zahlreiche Reiter die Methoden und Attribute genau spezifizieren.
Schade ist es dabei, dass alle Methoden zwingend einen
Rückgabewert
benötigen, der im Notfall eben void ist. Dies ist etwas verwirrend,
da beispielsweise Konstruktoren gewöhnlich keine Rückgabewerte haben.
Sehr schön sind die Voreinstellungen für Attribute und Operationen.
So sind Attribute per Standard private, Operationen dagegen sind
public, so wie das der Regelfall sein sollte. Bei Interfaces werden
Methoden auch gleich als abstrakt gekennzeichnet.
Enums kann man leider nicht direkt eingeben, dafür kann man aber
jeglichen Stereotyp eingeben und auch Enums darstellen.
Die Verbindungslinien zwischen Elementen kann man gerade, eckig oder
rund darstellen und auch manuell routen, indem man die Linie per
Drag&Drop dahin zieht, wo sie hin soll. Bei der Selektion ist aber
zum Beispiel die Auswahl eines Paketes ungewöhnlich, da man nicht in
das Paket direkt klicken darf, sondern den Paketrand bzw. -kopf
anklicken muss. Hieran gewöhnt man sich aber schnell.
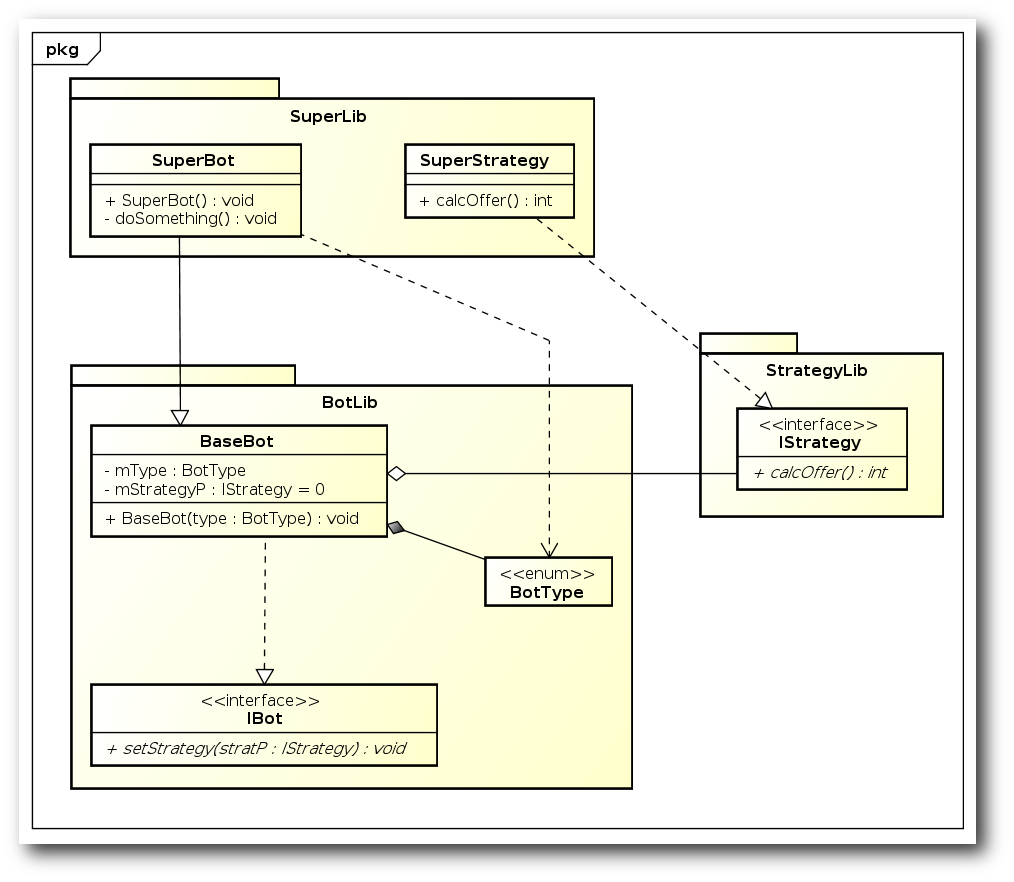
Die Klassendiagramme sind optisch ansprechend.
Die Sichtbarkeit von einzelnen Attributen oder Operationen lässt sich
über die rechte Maustaste auf eine Klasse und der Wahl von
„Extended Visibility“ einstellen. Schade ist, dass es keine direkte
Möglichkeit gibt, Elemente auszublenden.
Positiv hervorzuheben ist das Auto-Resize der Klassen, sodass diese
automatisch immer so viel Raum einnehmen, wie sie echt benötigen.
Bei den Paketen hat man sich diese Funktion leider gespart, sodass man
immer manuell nachbereiten muss, wenn ein Bild wenig Platz einnehmen
soll.
Das Auto-Layout konnte nicht getestet werden, da es in der
Community-Edition nicht zur Verfügung steht.
Insgesamt sind die Diagramme mit den Farbverläufen und ihrer klaren Schrift
schön anzusehen. Der Schatten um alle Elemente ist etwas störend,
kann aber leicht in den Optionen deaktiviert werden.
Andere Diagramme
Die anderen Diagramme wie Sequenzdiagramm oder Aktivitätsdiagramm sind
gut nutzbar und bieten viele Optionen. So gibt es bei den
Sequenzdiagrammen alle relevanten Artefakte, die man benötigt.
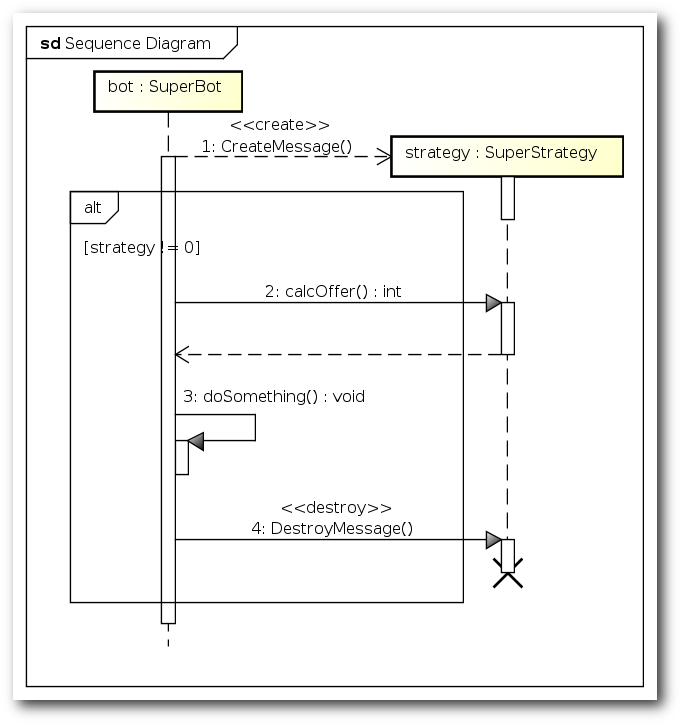
Auch das Sequenzdiagramm bietet alles,
was man benötigt.
Fazit
Es sei sicherheitshalber vorab gesagt, dass nicht jede Option und
Einstellung von Astah getestet wurde. Im Test wurde nur versucht, ein
paar Diagramme zu zeichnen und zu prüfen,
wie intuitiv und gut sich
das Programm testen lässt.
Dadurch, dass Astah auf Java zurückgreift, ist es zwar etwas langsamer
in der Bedienung, kann dafür aber plattformunabhängig eingesetzt
werden – für die Interoperabilität über mehrere Plattformen hinweg
ein nicht von der Hand zu weisendes Argument.
Eher von Nachteil ist, dass das Programm nur in Englisch bereit
steht. Natürlich haben die meisten Menschen im Informatik-Umfeld damit
keine Probleme, dennoch wäre eine Lokalisierung schön gewesen.
Wichtig für Linux-Nutzer ist, dass Astah nicht frei ist. Die Firma
Change Vision will mit Astah Geld verdienen und stellt die Community
Edition nur kostenlos zur Verfügung. Wer damit ein Problem hat, muss
sich eine der freien Alternativen anschauen, wovon es aber kaum
welche gibt, die vollends überzeugen können.
Ganz bugfrei ist Astah nicht. So wechselte im Test die gesamte
Schriftfarbe im Diagramm plötzlich auf Türkis und es wurde eine
sehr pixelige Schriftart benutzt. Aber nach einem Speichern und
Laden des Programm war der Darstellungsfehler behoben, sodass dies
zu verschmerzen ist.
Das Fazit fällt also überaus positiv aus. Astah ist ein gutes
UML-Programm, was auch in der Community Edition zahlreiche
Funktionen für die Erstellung von Software-Designs bietet. Wer
andere UML-Programme kennt, wird sich in Astah auf alle Fälle
schnell zurechtfinden. Die optisch ansprechende Gestaltung macht es
dabei zu einer echten Alternative zu dem in freiesMagazin 02/2012
empfohlenen Visual Paradigm [1].
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2012-02
[2] http://astah.net/de
[3] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Astah#History
[4] http://astah.net/editions
[5] http://astah.net/friends-of-astah
[6] http://astah.net/friends-of-astah/friends
[7] http://astah.net/download#community
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
ist Software-Entwickler und wirft täglich mit UML-Diagrammen um
sich. |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Jochen Schnelle
Die Qt-Bibliothek [1] gehört zu den bekanntesten
und populärsten, wenn es um die Erstellung von grafischen
Benutzeroberflächen geht. Das vorliegende Buch namens „PyQt und PySide“,
welches Anfang dieses Jahres neu erschienen ist, möchte in die
Nutzung der Bibliothek in Kombination mit Python einführen. Das
verdeutlicht auch der Untertitel des Buchs: „GUI- und
Anwendungsentwicklung mit Python und Qt“.
Umfang
Die Qt-Bibliothek ist sehr leistungsfähig und umfangreich, die im Buch
beschriebenen Python-Module PyQt und PySide unterstützen
nahezu den kompletten Funktionsumfang. Von daher ist es auffällig,
dass das Buch relativ dünn ist, es hat nur etwas mehr als 200 Seiten.
Die offizielle Dokumentation von Qt – ebenso wie die von PyQt/PySide –
ist um ein Vielfaches umfangreicher. Das Anliegen des Buchs ist aber, die Leser
in die Nutzung von Qt aus Python heraus einzuführen, also quasi den
initialen Anstoß zu geben, und kein umfassendes Referenzwerk zu sein.
Dies wird auch explizit in der Einleitung erwähnt.
Da Qt plattformübergreifend eingesetzt werden kann, geht das Buch
auch auf die verschiedenen, gängigen Betriebssysteme ein. Dies sind in
erster Linie Linux und Windows. Wo immer notwendig, wird aber auch MacOS
erwähnt. Des Weiteren werden die beiden gängigen Python-Module zur
Anbindung von Qt, PyQt und PySide, ebenfalls äquivalent behandelt.
Auch hier wird nach Notwendigkeit im Beispielcode immer auf Unterschiede
bei der Nutzung eingegangen.
Inhalt
Insgesamt umfasst das Buch sechs Kapitel. Das Erste, welches mit etwas
mehr als 50 Seiten auch das Umfangreichste ist, bietet eine Einführung
in die Nutzung von PyQt/PySide. Diese beinhaltet unter anderem
gängige grafische Elemente und Dialoge sowie das Konzept von Signalen
und Slots. Im zweiten Kapitel wird auf die Internationalisierung
eigener Programme sowie den Einsatz des Qt-Designers zur Gestaltung von
grafischen Benutzeroberflächen eingegangen. Im folgenden Kapitel
beschreibt der Autor, wie (umfangreichere) eigene Programmprojekte
strukturiert werden können. Auch wird hier die Erstellung von Paketen
für Linux und Installer für Windows beschrieben. Das vierte Kapitel
widmet sich dem Thema Qt-Quick und QML,
welches wohl in Zukunft zunehmend Bedeutung für Qt gewinnen wird.
Mit Hilfe von QML wird hier ein einfacher Feedreader
entwickelt, welcher bei einem Klick auf einen Feedtitel die
entsprechende Seite direkt innerhalb der Qt-Anwendung anzeigt.
Die
letzten beiden Kapitel beschreiben dann noch vier Beispielanwendungen,
bei denen ein einfacher Webbrowser, ein Codeeditor für
Javascript-Code, welcher direkt innerhalb des Editors
ausgeführt werden kann, ein Bildbetrachter und ein
Audioplayer mit Hilfe von PyQt/PySide realisiert werden.
Dabei wird für die Erstellung der Oberfläche an den meisten Stellen
auch wieder auf QML zurück gegriffen.
Darstellung
In allen Kapiteln findet man viele Codebeispiele zu den behandelten
Themen. Hier fällt positiv auf, dass alle Beispiele komplett und
lauffähig sind, es gibt keine Codefragmente oder ähnliches. Leider
schweigt sich das Buch darüber aus, ob man die Beispiele auch im
Internet herunterladen kann.
Weiterhin enthält das Buch relativ viele
Bilder von den grafischen Oberflächen und Programmen, welche im Rahmen
des Buchs entwickelt werden. Diese sind zwar durchgehend in Graustufen
gedruckt, nichtsdestotrotz aber gut lesbar und aussagekräftig.
Die weiter oben erwähnten Beispielanwendungen bieten alle einen guten
Einblick in die Möglichkeiten von Qt für ein paar gängige
Einsatzgebiete von (Heim-)Computern wie dem Surfen im Internet oder
dem Betrachten von Bildern. Alle Programme sind ohne weiteres
einsatzfähig, nur ist der Funktionsumfang natürlich entsprechend
gering. Nichtsdestotrotz bieten sie eine solide Codebasis für
eigene Weiterentwicklungen und Erweiterungen. Lediglich der
Audioplayer fällt gegenüber den anderen Anwendungen etwas ab, weil
er nur mit WAV-Dateien umgehen kann. Dies ist aber wenig dem Autor
anzulasten als vielmehr der Qt-Bibliothek. WAV-Dateien sind im
Moment nämlich die einzigen, die über alle Plattformen hinweg von Qt
unterstützt werden.
Schon erstellter Code wird im Laufe des Buchs, wo passend, auch immer
wieder aufgegriffen und verfeinert oder alternativ implementiert,
wodurch das Buch einen guten Zusammenhalt und eine Art „roten Faden“
erhält.
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, soll das Buch als Einführung in
das Thema Qt mit Python dienen. Entsprechend findet man an vielen
Stellen weiterführende Links, mit denen das gerade Gezeigte vertieft
werden kann. Die Links sind dabei durchgehend als Fußnoten ausgeführt, was
dem Lesefluss zugute kommt.
Apropos Lesefluss: Der Schreibstil des Autors lässt sich als
„unspektakulär“ beschreiben. Sprich: Sachlich, gut und flüssig
zu lesen, ohne negative (oder positive) Auffälligkeiten. Somit liegt
der Fokus auch durchweg auf dem Inhalt.
Fazit
„PyQt und PySide – GUI- und Anwendungsentwicklung mit Python und
Qt“ bietet eine gute Einführung in das Thema. Neues oder Highlights
bietet das Buch zwar nicht – äquivalente Informationen sind wohl auch
im Internet zu finden. Allerdings dann sicherlich nicht so kompakt und
in sich schlüssig zusammengefasst. Wer sich mit der Nutzung von Qt aus
Python heraus beschäftigen möchte, findet in dem Buch eine solide
Grundlage für den Einstieg in das Thema.
| Buchinformationen |
| Titel | PyQt und PySide – GUI- und Anwendungsentwicklung mit Python und Qt |
| Autor | Peter Bouda |
| Verlag | Open Source Press, 2012 |
| Umfang | 224 Seiten |
| ISBN | 978-3941841505 |
| Preis | 29,99 €
|
Links
[1] http://qt.nokia.com/
| Autoreninformation |
| Jochen Schnelle (Webseite)
programmiert gerne in Python und nutzt zur Erstellung von grafischen
Oberflächen die Qt-Bibliothek über PySide.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Dominik Wagenführ
Das Buch „C++11 programmieren“ von Torsten T. Will wirbt mit dem
Untertitel „60 Techniken für guten C++11-Code“. Die Rezension soll
zeigen, ob das stimmt.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem Verlag Galileo Computing für die
Bereitstellung des Rezensionsexemplars.
Hintergrund
Der neueste C++-Standard sollte eigentlich im letzten Jahrzehnt
veröffentlicht werden, nachdem die letzte Standardisierung 2003
stattfand. Der Prozess zog sich aber hin, sodass aus dem angedachten
C++0x irgendwann ein C++11 wurde. Im Oktober 2011 wurde der Standard
dann offiziell verabschiedet [1].
Das Buch „C++11 programmieren“ liefert einen Überblick über einen
Teil der Neuerungen von C++11 und richtet sich damit vorrangig an
erfahrene C++-Programmierer, die auf dem neuesten Stand der Technik
gehalten werden wollen. Auch wenn das Buch keine vollständige Liste
der Neuerungen beinhaltet, kann es sicherlich auch als
Nachschlagewerk benutzt werden. Für den Einstieg in die
C++-Programmierung ist es aber gänzlich ungeeignet.
Aufbau
Wer sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, dem fällt auf, dass der
erste Teil erst bei Seite 27 beginnt. Was treibt der Autor die
26 Seiten davor? Etwas, was man sich von mehr technischen Büchern
wünschen würde: ein Vorwort, in dem die Zielgruppe klar definiert
wird, sowie ein Beispielkapitel, in dem der Aufbau und die Syntax
der späteren echten Kapitel erklärt wird (S. 17 ff.). So hat man
keine Probleme, den Text und die Auszeichnungen zu verstehen.
Der Aufbau eines Kapitels beginnt mit einer kurzen Einleitung, in
der man auch mithilfe von kurzen Codebeispielen das neue Thema klar
und verständlich erläutert bekommt. Danach folgt ein Abschnitt mit
detaillierten Hintergründen, die sehr genau auf die Beispiele
eingehen und alles erklären. Am Ende des Kapitels steht ein Mantra,
welches noch einmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfasst, was
die Essenz des Kapitels ist.
Thematisch gliedert sich das Buch in fünf Teile. Der erste Teil
soll dabei an C++03 erinnern (also den C++Standard aus 2003), damit
man die Neuerungen von C++11, die in anderen Teilen beschrieben werden,
besser versteht. Prinzipiell wäre das eine gute Idee, wenn der Autor
dies konsequent eingehalten hätte. So vermischen sich in diesem Teil
C++03- und C++11-Syntax, was das Verständnis der Beispiele nicht
erleichtert. Ständig fragt man sich: ‚Hm, das kannte ich ja gar nicht.
Ist das schon C++11 oder kenne ich nur den C++03-Standard nicht gut
genug?‘
Was vielleicht auch nicht so praktisch, aber teilweise verständlich
ist: So gut wie nichts wird mit Klassen definiert, sondern es werden
nur Strukturen genutzt. Der Autor weist aber am Anfang darauf hin,
dass dies für eine echte Programmierung sehr schlechter Stil wäre
und man sich daran kein Beispiel nehmen sollte (S. 22).
Der zweite Teil ist dann der interessanteste des Buches, denn es wird
auf die neuen Sprachmechanismen von C++11 eingegangen. So kommen
unter anderen die neue Art der Initialisierung, Typsicherheit,
const_expr, finale Klassen und Ableitungen, die neue
Verschiebesemantik und RValues sowie Templates vor. Ob auf alles
Wichtige des C++11-Standards eingegangen wird, kann ich nicht
beurteilen; die 200 Seiten lesen sich aber sehr informativ und
man bekommt ein sehr guten Einblick in die neue Syntax. Vor allem
kann man sehr leicht herausfiltern, was einem selbst wichtig
erscheint und welches Sprachfeature man eher nicht sinnvoll einsetzen
kann. Interessant wäre noch zu wissen, ob die
Dreierregel [2]
mit der neuen Verschiebesemantik in eine Fünferregel umgeschrieben
werden muss. Torsten T. Will deutet so etwas jedenfalls an, zumal
C++ nun noch weniger Standard-Konstruktoren und -Operatoren erstellt,
wenn man es nicht explizit sagt.
Mir selbst haben vor allem die neuen const-Möglichkeiten
gefallen (S. 102), in die auch in Teil 1 (S. 39) eingegangen wird.
So kann durch ein const an der richtigen Stelle ein fehlerhaftes
Design entlarvt werden. Aber auch die neuen Eigenschaften für
Klassenoperationen wie override und final (S. 139 ff.) bzw. delete
und default (S. 196 ff.) finden sicherlich sinnvolle Verwendung.
Der dritte Teil beschäftigt sich ausgiebig mit Containern, Pointern
und Algorithmen. Die Aussage am Anfang des Buches (S. 36), dass man
in C++ auf void-Pointer oder Pointer-Casts verzichten kann, wird
beispielsweise durch die neuen unique_ptr und shared_ptr
unterstrichen (S. 275 ff.). Insgesamt ist das Kapitel sehr sinnvoll
für alle, die bereits einige Hilfsmittel der STL (Standard Template
Library) einsetzen.
Und in Teil 4 geht es auch mit der STL weiter, denn es werden die
Features beschrieben, die dort neu Einzug gehalten haben. Vorrangig
ist das sicherlich das Thema Multithreading (S. 321), welches auf
knappen 34 Seiten abgehandelt wird. Dennoch bekommt man einen guten
Einblick in die Möglichkeiten, die C++ hier bietet. Aber auch
reguläre Ausdrücke sowie Einheiten und Umrechnungen
werden nun direkt in C++ unterstützt.
Im Anhang findet man zum einen eine kurze Übersicht, was man in C++11
nicht mehr tun sollte, da einige Sprachelemente wie register als
veraltet deklariert wurden. Noch sinnvoller ist aber die Compilerübersicht
in Anhang C (S. 402), die aufzeigen soll, welche C++11-Features welcher
Compiler alles umsetzt. Da es sich natürlich um eine gedruckte Liste
handelt, ist sie im Buch veraltet, im Apache-Wiki findet man aber den
aktuellen Stand [3].
Nur für den GNU-Compiler GCC gibt es diese Liste bei
gnu.org [4].
Fazit
Hält das Buch, was es mit „60 Techniken für guten C++11-Code“
verspricht? Zuerst sei gesagt, dass die 60 sich aus den 62
Kapiteln im Buch ableitet, ansonsten aber keine Bewandtnis hat. Und
ob es wirklich guter Code ist, den Torsten T. Will zeigt, soll gar nicht
beurteilt werden, da Programmierer wie Künstler sind jeder seinen
eigenen Stil pflegt.
Die Frage lautet eher: Wird einem Leser
aber der neue C++-Standard verständlich beigebracht? Und hier ist
die Antwort definitiv ja.
Der Aufbau der Kapitel ist sehr klar und strukturiert. Teilweise
Popkultur-Referenzen auf Star Wars, Star Trek oder Herr der Ringe
regen zum Schmunzeln an (wenn man mit der Thematik vertraut ist).
Sehr schön ist auch, dass die Kapitel zu einem Thema gut ineinander
übergehen und sich gegenseitig referenzieren. Die Aufteilung wirkt
dadurch sehr gut durchdacht.
Autor Torsten T. Will schafft es auch, die Leser in eine fremde
Thematik einzuführen. So gehören Lambda-Funktionen, RValues oder
Multithreading nicht zu den Alltagsfragen eines Programmierers, dennoch
schafft man es auch ohne viel Wissen in dem Gebiet (fast) alles zu
verstehen. Daneben gibt es auch viele Hinweise auf guten Programmierstil
bzw. Hintergrundinformationen, die sich etwas von C++11 entfernen, aber
dennoch nicht jedem C++-Programmierer bekannt sind. So wissen viele
nicht, was ein const in Zusammenhang mit Zeigern an der richtigen
Stelle für Auswirkungen hat (S. 39).
Eigentlich selbstverständlich, aber leider immer wieder erwähnenswert
ist die Fehleranzahl im Buch. Obwohl es sich um die erste Auflage
handelt, findet man erfreuliche wenige Fehler im Buch. An einigen
Stellen gibt es zwar Buchstabendreher, aber in der Regel erschließt
sich sofort aus dem Kontext, wie es richtig lauten muss.
Einen kleinen Problempunkt sehe ich in der Ansprache der Leser.
So wird im Text oft von „wir“ gesprochen, womit der Autor sich und
die Lesergemeinde meint. An andere Stelle bezeichnet das „wir“ aber
den Autor und ggf. die anderen am Buch beteiligten Personen. Im Text
selbst wird der Leser dann mit „Sie“ angesprochen, in den Mantras am
Ende eines Kapitels aber immer mit „du“. Dies wirkt noch etwas
durcheinander, ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt.
Zweiter, kleiner Negativpunkt ist die Mischung des Inhaltes. So
setzt Torsten T. Will auch in frühen Kapiteln Syntaxelemente aus
C++11 ein, die er erst viel später dem Leser bekannt macht. Für
Entwickler, die nicht hundertprozentig den C++03-Standard auswendig
kennen – und dies kann wohl keiner – ist damit nicht immer klar, ob
es sich um ein C++03- oder ein C++11-Feature handelt.
Insgesamt kann man dem Buch aber eine sehr gute Note ausstellen. Es
ist übersichtlich, klar strukturiert und interessant geschrieben. Für
C++-Entwickler, die den neuen Standard kennen lernen wollen, kann
daher eine klare Empfehlung ausgesprochen werden. Für C++-Einsteiger
ist das Buch nicht geeignet, aber auch nicht gedacht.
Redaktioneller Hinweis: Da es schade wäre, wenn das Buch bei Dominik Wagenführ
verstaubt, wird es verlost. Die Gewinnfrage lautet:
„Welches neue Feature bietet der C++11-Standard in Bezug auf
Klassenvererbung, welches es bei Java schon lange gibt?“
Die Antworten können über die Kommentarfunktion unterhalb des
Artikels oder per E-Mail an  geschickt werden. (Hinweis:
Es gibt ggf. mehrere richtige Antworten.)
geschickt werden. (Hinweis:
Es gibt ggf. mehrere richtige Antworten.)
| Buchinformationen |
| Titel | C++11 programmieren |
| Autor | Torsten T. Will |
| Verlag | Galileo Computing, 2012 |
| Umfang | 414 Seiten |
| ISBN | 978-383621732-3 |
| Preis | 29,90 Euro
|
Links
[1] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/C++11#Weiterentwicklung_der_Programmier"ßprache_C.2B.2B
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Dreierregel_(C++)
[3] http://wiki.apache.org/stdcxx/C++0xCompilerSupport
[4] http://gcc.gnu.org/projects/cxx0x.html
| Autoreninformation |
| Dominik Wagenführ (Webseite)
entwickelt beruflich Software in C++ und muss sich deshalb auch
auf den neuen C++11-Standard vorbereiten.
|
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
von Michael Niedermair
Das neue
Werk [1]
„vom Java-Champion“ Christian Ullenboom ergänzt das Grundlagenbuch
„Java ist auch eine Insel“ (inzwischen 10. Auflage), indem es die
Java-Standard-Bibliothek in den einzelnen Bereichen behandelt. Es
stellt ein Nachschlagewerk/eine Referenz für die einzelnen Bereiche dar
und erklärt an praxisnahen Beispielen die Thematik.
Der Autor ist Diplom-Informatiker und seit 1997 Trainer und Berater für
Java-Technologien. Ob das Buch mit allen seinen Facetten die Ansprüche
an einen „Java-Champion“, wie es auf dem Buch-Cover steht, gerecht
wird, wird im Folgenden beleuchtet.
Redaktioneller Hinweis: Wir danken dem Verlag Galileo Computing für
die Bereitstellung eines Rezensionsexemplares.
Was steht drin?
Das Buch ist in 23 Bereiche mit Vorwort und Index aufgeteilt und
umfasst 1433 Seiten. Am Ende finden sich sieben Seiten Werbung zu anderen
Büchern.
Abgeschlossen wird es mit dem Index, der neun Seiten umfasst. Er
enthält Stichworte, Programmkonstanten und Methoden.
Zu den Standard-Bibliothek-Funktionen von Java7-SE hat sich auch so
manche externe Bibliothek zu den einzelnen Themengebieten
geschlichen, z. B. JDOM bei der XML-Verarbeitung oder Apache
HttpComponents bei der Netzwerkprogrammierung.
Wie liest es sich?
Das Buch ist für den schon erfahrenen Java-Anwender geschrieben und
setzt die Grundlagen aus dem Buch „Java ist auch eine Insel“ vom
selben Autor voraus. Es dient als Nachschlagewerk/Referenz für die
einzelnen Bereiche der Java-Standard-Bibliothek und die neuen
Funktionen von Java 7. Jeder Bereich ist in sich abgeschlossen und die
Bereiche bauen im Wesentlichen nicht aufeinander auf, so dass man mit
jedem Bereich nach Vorkenntnissen und Vorlieben beginnen kann.
Die
einzelnen Bereiche lassen sich gut lesen (das Zusammenspiel von
Layout, Schrift, Tabellen, Quelltext und Bildern ist sehr angenehm)
und sind mit praxisnahen Beispielen versetzt, denen man leicht folgen
kann. Dabei werden nur die wesentlichen Codebereiche abgedruckt.
Entsprechende Klassenbeziehungen/-vererbungen werden durch
UML-Diagramme grafisch dargestellt.
Zur Aufheiterung findet man ein paar Comics, welche den Sachverhalt
lustig darstellen.
Kritik
Das Buch ist für den schon erfahrenen Java-Anwender, der das Buch als
Nachschlagewerk oder Referenz verwenden will, sehr gut geeignet. Ein
Java-Anfänger sollte besser auf das parallele Werk „Java ist auch eine
Insel“ ausweichen und das hier besprochene Werk erst später lesen.
Man merkt deutlich, dass der Autor viel Erfahrungen mit Java und als
Java-Trainer hat und ein Experte auf diesem Gebiet ist. Alle Beispiele
sind methodisch sehr gut aufgebaut, alle „Fallstricke“ und
„Stolpersteine“ werden gut erklärt, so dass man dem Inhalt sehr gut
folgen kann.
Der Index ist sehr umfangreich und sehr gut aufgebaut.
Die meisten Einträge haben weniger als drei Verweise, so dass man sehr
schnell findet, was man sucht.
Das Buch erscheint als Hardcover-Version und liegt trotz seiner Dicke
gut in der Hand, auch wenn es über 1400 Seiten hat. Es hat ein
Lesebändchen und ein Daumenkino für die einzelnen Bereiche.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier sehr gut. Der Aufdruck auf dem
Cover „vom Java-Champion“ ist hier gerechtfertigt, wobei ein paar
Schatten auf den Schein fallen.
Die im Buch verwendeten UML-Diagramme sind als Pixelgrafik
eingebunden, was dazu führt, dass schräge Linien in kleinen
Treppenstufen erscheinen.
Auch stellt man bei den UML-Diagrammen fest,
dass diese nicht einheitlich sind, manche Klassendiagramme haben nur
einen Rahmen, andere werden zusätzlich mit einem Schatten versehen.
Bei manchen Klassendiagrammen hätte ich mir deutlich weniger Methoden
gewünscht, so dass das Diagramm z. B.
keine ganze Seite einnimmt und
nur die Methoden enthält, die man wirklich darstellen muss.
Bei zwei Themen habe ich mich gefragt, ob diese
wirklich sinnvoll sind. JNI wird mit gerade einmal 18 Seiten angeschnitten. Hier hätte ich
mir entweder deutlich mehr gewünscht oder man hätte die Seiten einem
anderen Bereich widmen können.
Was der Bereich JSP und Servlets in der
Standard-Edition zu suchen hat, habe ich nicht ergründen können. Das
ist eindeutig ein Enterprise-Thema. Hier würde ich mir eher vom Autor
ein eigenes Buch mit 1400 Seiten zu dem Thema wünschen.
Optisch hat die Druckerei dem „Java-Champion“ einen Bärendienst
erwiesen. Die Druckbögen wurden leider nicht sauber geschnitten, was
dazu führt, dass das Daumenkino einen Versatz von bis zu zwei
Millimetern hat, was einen sehr ausgefransten Rand ergibt und den
optischen Gesamteindruck doch stört.
Trotz der „Schatten“ ist das Buch sehr gut und ich werde das Buch als
Openbook-Version [2] in meinem
Unterricht einbauen und meinen Schülerinnen und Schülern empfehlen.
| Buchinformationen |
| Titel | Java 7 – Mehr als eine Insel |
| Autor | Christian Ullenboom |
| Verlag | Galileo Computing, 2012 |
| Umfang | 1433 Seiten |
| ISBN | 978-3836215077 |
| Preis | 49,90 Euro
|
Links
[1] http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-2253
[2] http://openbook.galileocomputing.de/java7/
| Autoreninformation |
| Michael Niedermair
ist Lehrer an der Münchener
IT-Schule und unterrichtet hauptsächlich
Programmierung, Datenbanken und IT-Technik. Er beschäftigt sich seit
Jahren mit vielen Programmiersprachen. |
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
Am 1. März 2012 startete der fünfte freiesMagazin-Programmierwettbewerb [1].
Es ging dabei nicht wie sonst um ein theoretisches Spiel, sondern um
eine reale Anwendung. Gesucht wurde ein Wortwolken-Generator, der
Texte einliest, die Worthäufigkeit zählt und alles als Wortwolke
ausgibt. Einige Programmierwillige haben sich dieser Aufgabe gestellt.
Teilnehmer
Die Teilnahme am Wettbewerb war erwartungsgemäß geringer, da es sich
um ein recht spezielles Thema handelte, wobei das eigentliche Einlesen
der Dateien und Zählen auch für Programmieranfänger eine Kleinigkeit
gewesen sein sollte. Die Darstellung als Wortwolke war dagegen etwas
anspruchsvoller.
Insgesamt hatten sechs Teilnehmer am Wettbewerb teilgenommen, wobei
einer seinen Beitrag während der Auswertung zurückgezogen hatte. Die
fünf Programme sind ausschließlich in Python oder Java geschrieben.
Neben den offiziellen Abgaben gab es auch noch eine
Referenzimplementierung von Dominik Wagenführ in TCL. Diese sollte
als Ausgangsbasis dafür dienen, was die Programme alles können sollten.
Alle Programme inkl. der erstellten Wortwolken und der Testdaten
können als Archiv heruntergeladen werden [2].
Bewertung
Die Bewertung sollte nach folgenden Gesichtspunkten vorgenommen werden:
- Geschwindigkeit des Programms (15 %)
- Funktionsvielfalt des Programms (30 %)
- Bedienung des Programms (25 %)
- Aussehen der Wortwolke (30 %)
Jedes Gebiet wurde in konkrete Eigenschaften aufgeteilt und diesen
dann eine bestimmte Punktzahl zugeordnet. Bei voller Punktzahl hätte
ein Teilnehmer auf 100 Punkte kommen können.
Die Programme der Teilnehmer wurden nach Abgabe ausgiebig getestet
und vor verschiedene Testdaten gestellt, die sie analysieren mussten.
Die gesamte Liste mit der detaillierten Bewertung inkl. Begründung
für die Punkte kann man als ODS-Datei herunterladen [3].
Gewinner
Mit 67 Punkten belegt somit das Programm von Steve Göring den ersten
Platz, das vor allem mit einer sehr schön dargestellten Wortwolke
begeistern kann. Der zweite Platz geht an das Programm von Tom Richter,
welches eine hohe Funktionsvielfalt aufweist.
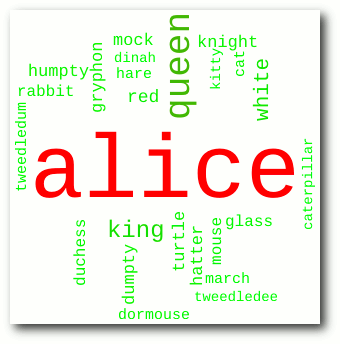
Die Wortwolke zu „Alice“.
Die anderen drei Programme liegen alle sehr dicht beisammen. Da sie
aber alle kleine Eigenheiten aufweisen, die eine unabhängige und
aussagekräftige Analyse eines Textes nicht zulassen, haben wir uns
entschieden, den dritten Platz unbesetzt zu lassen.
Insgesamt danken wir aber allen fünf Teilnehmern für die Teilnahme,
da ohne sie kein Wettbewerb zustande gekommen wäre.
Fazit
Der Wettbewerb hat gezeigt, dass es zum einen nicht so einfach ist,
dass man als Teilnehmer wirklich alle Fälle behandelt, wie der
Anwender später das Programm auch nutzen könnte. Zum anderen ist
die Bewertung extrem schwer gewesen, da neben den eigentlichen
Anforderungen vor allem die freiwilligen Zusatzanforderungen und
Features eine starke Rolle spielten.
Aus dem Grund wird der nächste Wettbewerb auch wieder einen
spieltheoretischen Ansatz verfolgen, sodass am Ende des Wettbewerbs
für jeden Teilnehmer eine Punktzahl errechnet wird, die klar angibt,
welcher Platz erreicht wurde.
Links
[1] http://www.freiesmagazin.de/20120301-fuenfter-programmierwettbewerb-gestartet
[2] http://www.freiesmagazin.de/ftp/2012/freiesMagazin-2012-05-ergebnisse.tar.gz
[3] http://www.freiesmagazin.de/ftp/2012/freiesMagazin-2012-05-bewertung.ods
Diesen Artikel kommentieren
Zum Index
Für Leserbriefe steht unsere E-Mailadresse
 zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
zur Verfügung - wir freuen uns über Lob,
Kritik und Anregungen zum Magazin.
An dieser Stelle möchten wir alle Leser ausdrücklich ermuntern,
uns auch zu schreiben, was nicht so gut gefällt. Wir bekommen
sehr viel Lob (was uns natürlich freut), aber vor allem durch
Kritik und neue Ideen können wir uns verbessern.
Leserbriefe und Anmerkungen
Genderismus
->
Ich lese leider erst jetzt die Ausgabe 03/2012 von freiesMagazin und
möchte mein Feedback zur dort im Editorial aufgeworfenen Frage über
Genderismus geben.
Dieses Thema wird leider immer wieder von einzelnen (aber sehr lauten)
Agitatoren, oft in vorwurfsvollem Ton, vorgebracht. Es geht ganz
offensichtlich nach der Devise „steter Tropfen höhlt den Stein“.
Die vorgebrachte Forderung nach expliziter Nennung der weiblichen
Teilmenge mit gleichzeitiger Behauptung, die normale Form würde nur die
männliche Teilmenge ansprechen, ist sachlich unhaltbar, also falsch. In
der deutschen Sprache fallen das Wort für einen männlichen Menschen und
die allgemeine Form (zufällig) zusammen (z. B. „der Leser“), nur für
einen weiblichen Menschen gibt es eine eigene Variante („die Leserin“).
Obendrein wird bei der Mehrzahl
in jedem Fall der weibliche Artikel
„die“ verwendet (z. B. „die Leser“).
Es stellt die deutsche Sprache also sowieso schon eine eindeutige
Bevorzugung der weiblichen Teilmengen her.
Die meist als Diskriminierung verunglimpfte normale Form ist also ganz
im Gegenteil keine Diskriminierung von Frauen.
In diesem Sinne bitte ich, auch weiterhin sämtliche Artikel in normalem
Deutsch zu verfassen, und das auch von den Autoren zu verlangen. Es wäre
sehr schade, wenn ihr die selbe – nur noch als Gesinnungsterrorismus zu
bezeichnende – Schiene wie die Hochschülerschaft an der Uni Wien
einschlägt, die nicht „gegenderte“ Artikel beinhart zensuriert.
Johann Glaser
<-
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und Ihre Meinung zu dem Thema.
Da wir das genauso sehen, müssen Sie nicht befürchten, demnächst von
„Lesern und Leserinnen“ lesen zu müssen (auch wenn wir diese Ansprache ab
und zu in der Tat benutzen, was aber weniger etwas mit pseudo-genderfreier
Sprache zu tun hat).
Dominik Wagenführ
Kernel kompilieren nach Rezept
->
Ich lese freiesMagazin schon seit Jahren (ich glaub seit Erscheinen) und ich
wollte zwar schon oft die Redakteure belobigen, aber da ich meistens
kein Internet auf der Maschine habe, auf der ich das Magzin lese,
hab ich meistens vergessen, es daheim nachzuholen. Aber an dich
[Anmerkung der Redaktion: Gemeint ist der Autor des Kernel-Artikels
Mathias Menzer] muss ich mal ein großes Lob loswerden. Super
geschrieben, 'ne schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung und obwohl ich
schon seit fünf Jahren Linux auf dem Desktop einsetze, hab' ich mich noch
nie getraut, 'was am Kernel zu machen. Und siehe da, jetzt hocke ich
sogar vor meinem „eigenen“ Kernel, hat alles auf Anhieb geklappt! Danke!
hypnotoad (Kommentar)
April-Ausgabe
->
Ich finde es sehr gut, dass die April-Ausgabe tatsächlich im April
erscheint und nicht wie bei anderen Magazinen gefühlte zwei Monate
früher.
Und auch: danke für die Arbeit!
bronsen (Kommentar)
->
Wieder schöne und interessante Artikel dabei. Allerdings sehr
programmier- bzw. techniklastig diesmal.
Aber [das] ist natürlich abhängig von den Interessen Eurer Autoren,
ab und an würde ich mir mehr Programmvorstellungen wünschen, so als
Art „Programm des Monats“.
Andre (Kommentar)
<-
Ja, viele der Autoren (aber auch viele der Leser) stammen aus dem
IT-affinen Umfeld und haben daher eher Interesse an solchen Themen.
Gegen mehr Programmvorstellungen haben wir aber nichts einzuwenden
und freuen uns, wenn auch nicht-technik-freudige Leser den Griff zur
Tastatur wagen und einfach eines ihrer Lieblingsprogramme auf zwei,
drei Seiten vorstellen.
Wer Ideen hat, kann diese einfach unter  einrreichen.
einrreichen.
Dominik Wagenführ
Mobilausgabe als MOBI
->
Ist es eventuell auch möglich, statt oder zusätzlich das Format MOBI
anzubieten? Z. B. der Kindle kann mit dem Format EPUB nichts anfangen …
Sebroe (Kommentar)
<-
Nein, MOBI bieten wir nicht an, weil es sich um ein proprietäres
Format von einem einzelnen Hersteller handelt.
EPUB ist offen und
herstellerunabhängig und wird von allen (bis auf einen)
Ebook-Readern unterstützt. Mittels Calibre kann man am PC aber EPUB
in MOBI konvertieren.
Dominik Wagenführ
Objektorientierte Programmierung
->
Also ich finde den Artikel beziehungsweise die ganze Artikelreihe
sehr interessant. Ich freue mich auf folgende Artikel zur OOP. :-)
Tim Holzschuh (Kommentar)
->
Vielen Dank für diesen tollen zweiten Artikel zur OOP. Ich programmiere
schon länger objektorientiert und hing schon oft an den angesprochenen
konzeptionellen Schwierigkeiten fest. Der Artikel hat dort echt gut
geholfen! Ich freue mich schon auf Teil 3.
Gast (Kommentar)
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gegebenenfalls zu
kürzen. Redaktionelle Ergänzungen finden sich in eckigen Klammern.
Die Leserbriefe kommentieren
Zum Index
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Sie kennen eine Linux-Messe, welche noch nicht auf der Liste zu
finden ist? Dann schreiben Sie eine E-Mail mit den Informationen zu
Datum und Ort an  .
Zum Index
.
Zum Index
freiesMagazin erscheint immer am ersten Sonntag eines Monats. Die Juni-Ausgabe wird voraussichtlich am 3. Juni unter anderem mit folgenden Themen veröffentlicht:
- Objektorientierte Programmierung: Teil 4
- Trine 2
Es kann leider vorkommen, dass wir aus internen Gründen angekündigte Artikel verschieben müssen. Wir bitten dafür um Verständnis.
Zum Index
An einigen Stellen benutzen wir Sonderzeichen mit einer bestimmten
Bedeutung. Diese sind hier zusammengefasst:
| $: | Shell-Prompt |
| #: | Prompt einer Root-Shell – Ubuntu-Nutzer können
hier auch einfach in einer normalen Shell ein
sudo vor die Befehle setzen. |
| ~: | Abkürzung für das eigene Benutzerverzeichnis
/home/BENUTZERNAME |
Zum Index
freiesMagazin erscheint als PDF, EPUB und HTML einmal monatlich.
Erscheinungsdatum: 6. Mai 2012
Dieses Magazin wurde mit LaTeX erstellt. Mit vollem Namen
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung
der Redaktion wieder. Wenn Sie freiesMagazin ausdrucken möchten, dann
denken Sie bitte an die Umwelt und drucken Sie nur im Notfall. Die
Bäume werden es Ihnen danken. ;-)
Soweit nicht anders angegeben, stehen alle Artikel, Beiträge und Bilder in
freiesMagazin unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported. Das Copyright liegt
beim jeweiligen Autor. freiesMagazin unterliegt als Gesamtwerk ebenso
der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 Unported mit Ausnahme der
Inhalte, die unter einer anderen Lizenz hierin veröffentlicht
werden. Das Copyright liegt bei Dominik Wagenführ. Es wird erlaubt,
das Werk/die Werke unter den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz
zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren.
Die xkcd-Comics stehen separat unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-NC 2.5 Generic. Das Copyright liegt
bei Randall Munroe.
File translated from
TEX
by
TTH,
version 3.89.
On 6 May 2012, 13:36.